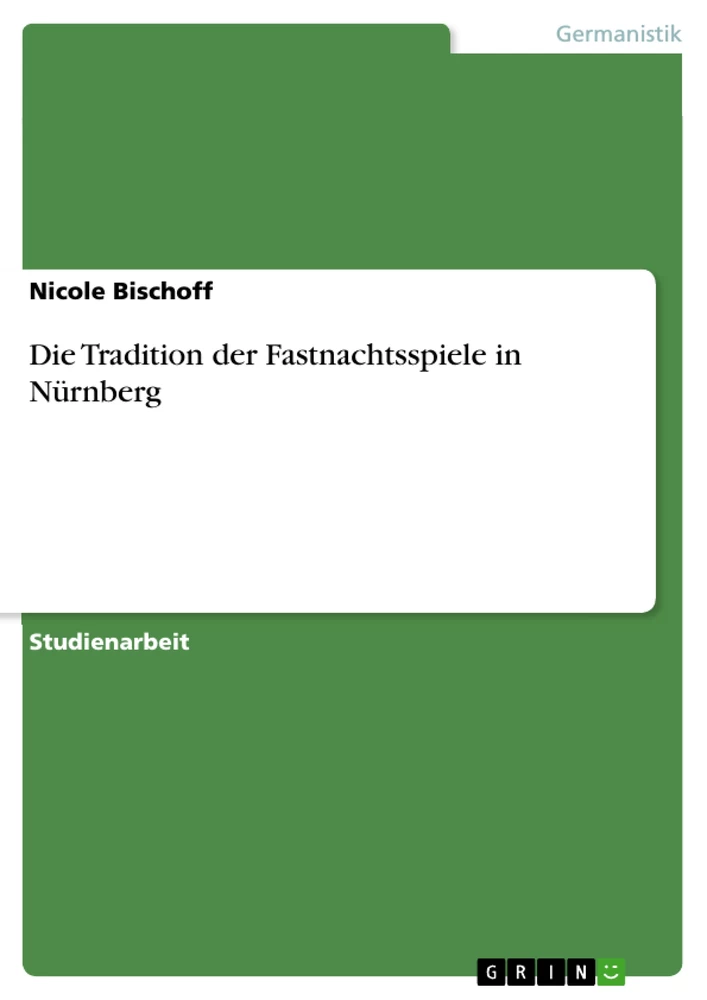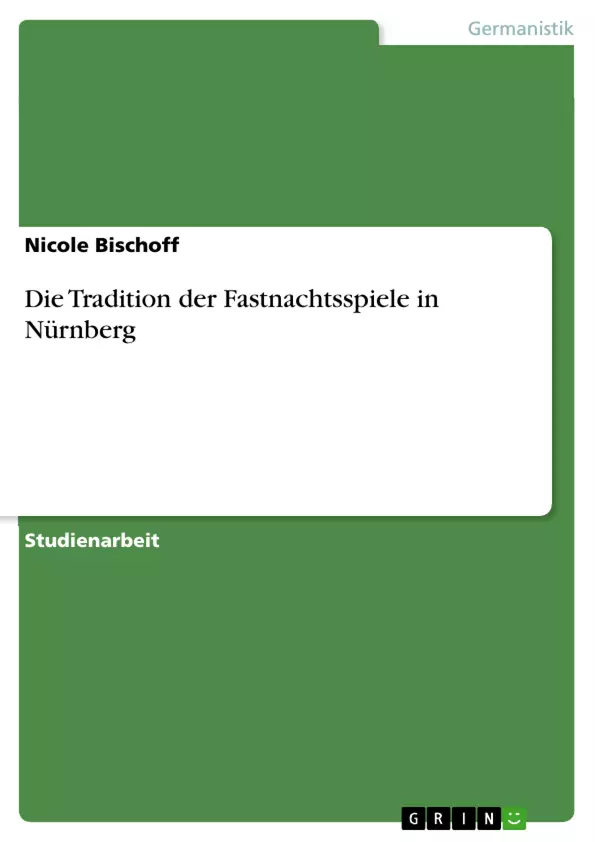In meinem Aufsatz werde ich die Tradition des weltlichen Schauspiels in Nürnberg knapp skizzieren. Zunächst geht es um die Entstehung und grobe Einordnung der Nürnberger Spiele. Im folgenden Kapitel gehe ich auf die Stoffe und die Aufführungen an sich ein. Als Beispiel dient hier das Fastnachtsspiel „Der Juden Messias“ von Hans Folz. Im dritten Punkt sind die drei Autoren Hans Rosenplüt, Hans Folz sowie Hans Sachs thematisiert, welche die Nürnberger Tradition des Fastnachtsspiels begründet haben und wegweisend für andere Städte waren.
Inhaltsverzeichnis
- Entstehung
- Die Aufführungen
- Beispiel: Hans Folz „Der Juden Messias"
- Die drei wichtigsten Vertreter in Nürnberg
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz befasst sich mit der Tradition der Fastnachtsspiele in Nürnberg im Spätmittelalter. Er beleuchtet die Entstehung und Entwicklung dieser Spielform im städtischen Kontext, analysiert die Inhalte und Aufführungspraxis der Spiele und stellt die drei wichtigsten Vertreter der Nürnberger Fastnachtsspieltradition - Hans Rosenplüt, Hans Folz und Hans Sachs - vor.
- Entstehung und Entwicklung der Fastnachtsspiele in Nürnberg
- Inhalte und Darstellungsform der Fastnachtsspiele
- Die Rolle von Hans Rosenplüt, Hans Folz und Hans Sachs in der Nürnberger Fastnachtsspieltradition
- Literarisierung der Fastnachtsspiele
- Der Einfluss der Fastnachtsspiele auf die städtische Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Entstehung der Fastnachtsspiele in Nürnberg. Es wird erläutert, dass diese Spielform im Kontext der städtischen Festkultur des 15. und 16. Jahrhunderts entstand und sich aus verschiedenen Vorläufern wie dem Kinderwlegenspiel entwickelte. Die Fastnachtsspiele dienten als Medium der Unterhaltung und wurden von Laien aufgeführt. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Rates für die Organisation und Regulierung der Spiele. Die Spiele wurden zumeist in den Monaten Dezember, Januar und Februar aufgeführt und fanden an drei Feiertagen statt: dem Sonntag esto mihi, dem gallen Montag und dem „rechte vasnacht" genannten Dienstag.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Aufführungen der Fastnachtsspiele in Nürnberg. Es wird dargestellt, wie die Spiele im 15. Jahrhundert durch Hans Rosenplüt und seine Nachfolger Folz und Sachs sowie Jakob Ayrer im 16. Jahrhundert zur Tradition wurden. Die Spiele wurden von Spielrotten aufgeführt, die von Haus zu Haus zogen und ihre Stücke präsentierten. Das Kapitel beleuchtet die Organisation der Spielrotten, die Anzahl der Akteure und die Spielorte. Es wird auch auf die Inhalte der Spiele eingegangen, die sich thematisch rund um den Karneval, die Minnethematik und Schivänken bewegten. Häufige Motive waren das Vergnügen an Geschlechtlichkeit und Exkrementen, die Darstellung des Bauern in der Narrenrolle und die Figur des Narren.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Fastnachtsspiel „Der Juden Messias" von Hans Folz. Es wird die Entstehung des Spiels und die Bedeutung der Antichristberichte, der Sibyllen-Weissagungen und der Tradition der „Judensau" für die Handlung beleuchtet. Der Inhalt des Spiels wird zusammengefasst, wobei die Rolle der Prophetin Sibylla, die Verhöhnung der Juden und die Darstellung des Antichristen im Mittelpunkt stehen. Das Kapitel analysiert die Rolle der Narren im Spiel und beleuchtet die politische Zielsetzung des Stückes, nämlich die Vertreibung der Juden aus Nürnberg.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Fastnachtsspiele, die städtische Kultur, die Nürnberger Tradition, die Literarisierung, Hans Rosenplüt, Hans Folz, Hans Sachs, „Der Juden Messias", Antijudaismus, Karneval, Minnethematik, Schivänken, Narrenrolle, Bauer, Spielrotten, Rat, Aufführungspraxis, Inhalte, Darstellungsform.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Nürnberger Fastnachtsspiele?
Es handelt sich um eine spätmittelalterliche Form des weltlichen Schauspiels, das zur Karnevalszeit in Nürnberg von Laien zur Unterhaltung aufgeführt wurde.
Wer waren die wichtigsten Autoren dieser Spiele?
Die Nürnberger Tradition wurde maßgeblich von Hans Rosenplüt, Hans Folz und später Hans Sachs begründet und geprägt.
Worum geht es in Hans Folz' "Der Juden Messias"?
Dieses Spiel ist ein Beispiel für die Literarisierung der Fastnachtsspiele und thematisiert religiöse Konflikte sowie den Antijudaismus der damaligen Zeit.
Wie wurden die Spiele im 15. Jahrhundert aufgeführt?
Sogenannte "Spielrotten" zogen von Haus zu Haus und präsentierten ihre Stücke, die oft derbe Motive rund um Geschlechtlichkeit, Bauern und Narren enthielten.
Wann fanden diese Aufführungen statt?
Die Spiele wurden traditionell in den Monaten Dezember bis Februar aufgeführt, mit dem Höhepunkt am Fastnachtsdienstag.
- Citation du texte
- Nicole Bischoff (Auteur), 2007, Die Tradition der Fastnachtsspiele in Nürnberg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204420