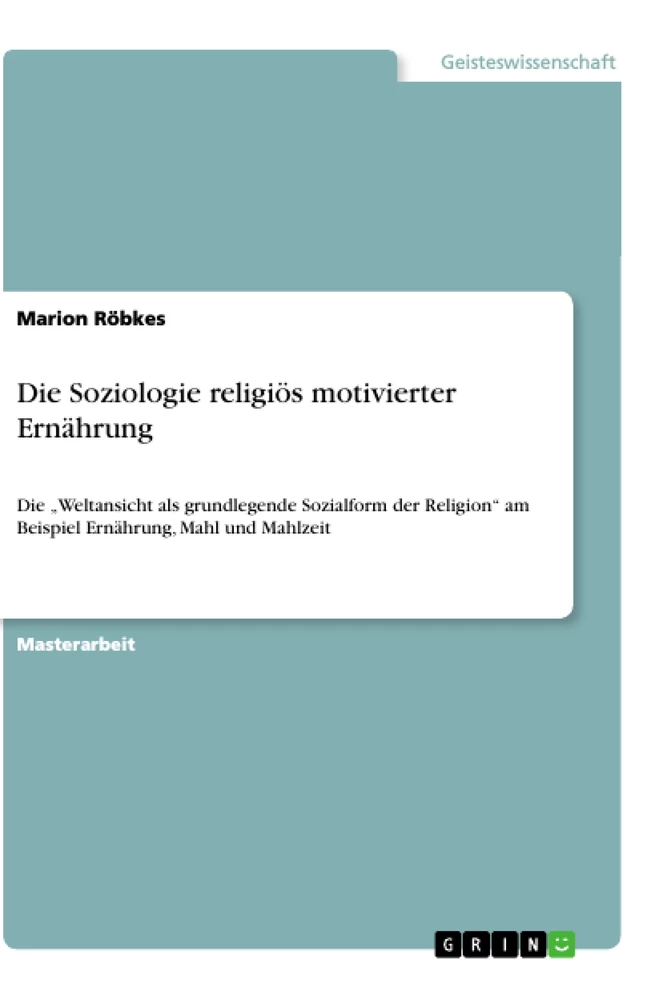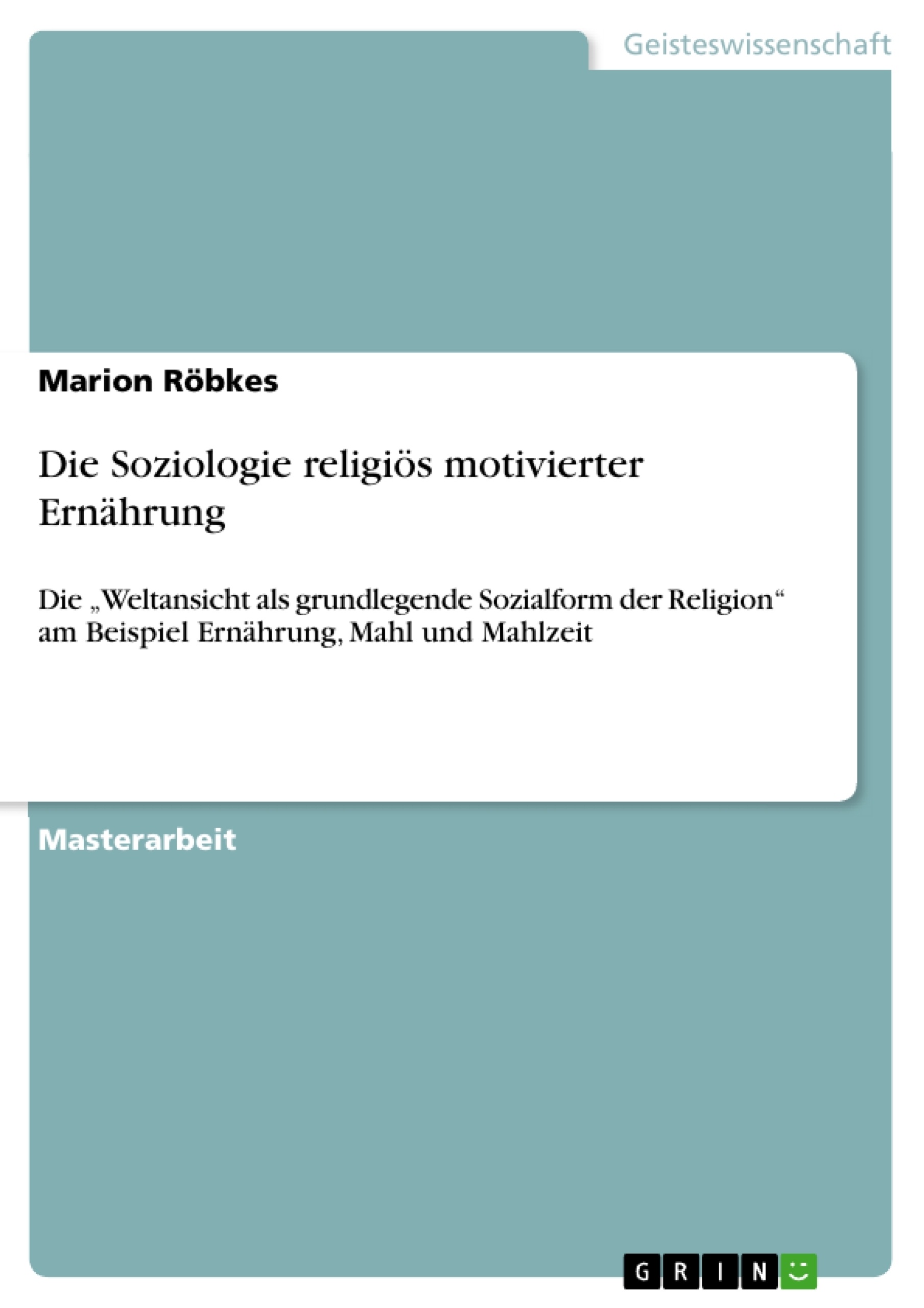Erste auslösende Momente der Auseinandersetzung mit dem Thema Soziologie der religiös motivierten Ernährung, die zu dieser Arbeit führten, waren die Berührungen mit Phänomenen wie Ramadan und Fastenzeiten, Schulfesten, Geburtstagsfeiern und Grillabenden mit konfessionell verschiedenen Teilnehmern. Insbesondere Kindergartengruppen und Schulklassen sind heute kleine multiethnische und multikonfessionelle Gemeinschaften, die im Jahresverlauf auch mit Eltern und Geschwistern zu Treffen und Feierlichkeiten zusammenkommen. Kollegen- und Freundeskreise weisen nicht mehr die konfessionellen Homogenitäten auf, die – in Deutschland - noch vor Jahrzehnten eher typisch waren. Arbeitsessen und Schulbuffets, gemeinsame Restaurantbesuche und Festlichkeiten, wie auch die Versorgung in Gemeinschaftsverpflegungen erfordern einen Blick auf die Ernährungsgewohnheiten der Gesellschaft und der Teilgesellschaften und dessen, was der Mensch für sich als gesund oder ungesund bzw. essbar und nicht-essbar akzeptiert oder ablehnt. Diese Ernährungsgewohnheiten können dabei zum einen dem Geschmack zugerechnet werden, aber auch der Gewöhnung. Die Lebensmittel, die wir verzehren, sind ebenfalls durch unsere gesellschaftlichen Bedingungen mitbestimmt. Nicht alles, was ernährungsphysiologisch essbar wäre, darf auch in einem sozialen Umfeld verzehrt werden. Nahrungsgebote und –verbote, wie auch die Regeln der Zubereitung und die Zeiten der Nahrungsaufnahme unterliegen gesellschaftlichen Rahmenvorgaben. Diese wiederum fußen, so die erhobene Behauptung, auch auf konfessionell beziehungsweise religiös begründeten Verhaltensvorschriften. Diesem nachzugehen und die Schnittstellen, wie auch die möglichen Herausforderungen für die Gegenwartsgesellschaft zu bestimmen, wird die Aufgabe dieser auf die theorie- und literaturbezogenen Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Religion-Definitionen und Formen
- Definitionen
- Welche Formen der Religion werden betrachtet?
- Religion und Soziologie
- Ausgewählte religionssoziologische Theorien und Modelle
- Privatisierung und Individualisierung der Ernährung als implizite Handlungsform einer unsichtbaren Religion
- Wie kommt die Religion zum Menschen?
- Eine Soziologie des religiös motivierten Essens
- Die gesellschaftlichen Ebenen
- Eine allgemeine Soziologie des Essens und der Ernährungssozialisation
- Die Soziologie des religiös motivierten Essens
- Die religiösen Vorstellungen vom richtigen Essen und richtigen Speisen
- Beispiele der Formen des religiös motivierten Essens und der Speisenbereitung
- Der Produktionsprozess
- Verbindendes und Trennendes
- Askese und Fasten
- Speisengebote
- Speiseverbote
- Die Folgen von Missachtung der religiös motivierten Ernährungsregeln
- Hin und wieder zurück – die Bedeutung der Ernährungs- und Speiseregeln in der postkonfessionellen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts
- Ein Kurzabriss der historischen und gegenwärtigen Entwicklung von Ernährungs- und Speiseregeln
- Grobe Linien der Veränderung der Ernährungsformen und Speisezubereitungen im 20. Jahrhundert
- Veränderung der konfessionellen Zusammensetzung von Gesellschaften durch Zuwanderungen und Abwanderungen am Beispiel von Deutschland im 20. Jahrhundert
- Religion ohne Bedeutung der Ernährung – oder Ernährung ohne Bedeutung der Religion?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Soziologie religiös motivierter Ernährung. Ziel ist es, die Schnittstellen zwischen religiösen Verhaltensvorschriften und gesellschaftlichen Ernährungsgewohnheiten aufzuzeigen und die Herausforderungen für die heutige Gesellschaft zu beleuchten. Die Arbeit erschließt dieses Feld für weitere Untersuchungen und sucht die Anschlussfähigkeit an verschiedene soziologische Theorien.
- Die Definition und Abgrenzung von Begriffen wie Spiritualität, Religion und Religiosität.
- Die Rolle religiöser Vorstellungen im gesellschaftlichen Kontext, insbesondere ihre Entstehung, Verhandlung und Weitergabe.
- Die soziologischen Ebenen (Makro-, Meso- und Mikroebene) des religiös motivierten Essens.
- Die Auswirkungen religiöser Ernährungsregeln auf Geschmack, Kapital, Verfügbarkeit und soziale Beziehungen.
- Der Wandel religiös motivierter Ernährung in der postkonfessionellen Gesellschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die Soziologie religiös motivierter Ernährung ausgehend von Beobachtungen in multikulturellen Kontexten wie Kindergärten, Schulen und Arbeitsumfeldern. Es wird die Notwendigkeit einer soziologischen Betrachtung von Ernährungsgewohnheiten hervorgehoben, die sowohl geschmackliche als auch gesellschaftliche und religiöse Aspekte berücksichtigt. Die Arbeit zielt darauf ab, dieses Forschungsfeld für zukünftige Studien zu erschließen und die Anschlussfähigkeit an bestehende soziologische Theorien zu gewährleisten. Die empirische Datenlage wird als gering eingeschätzt.
Religion-Definitionen und Formen: Dieses Kapitel klärt grundlegende Begriffe wie Spiritualität, Glauben, Rituale, Religion, Religiosität, Moral, Ethik und Konfession. Es werden die zu untersuchenden Religionsformen (Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus) definiert und die Grenzen der Aussagekraft der gewählten Auswahl erläutert. Die Kapitel legt die theoretische Grundlage für die Analyse religiöser Einflüsse auf Ernährungsgewohnheiten.
Religion und Soziologie: Dieses Kapitel präsentiert ausgewählte religionssoziologische Theorien und Modelle, die relevant für die Untersuchung sind. Es beleuchtet die Privatisierung und Individualisierung der Ernährung als implizite Handlungsform einer möglicherweise unsichtbaren Religion und diskutiert, wie religiöse Vorstellungen an den Menschen herangetragen werden und im gesellschaftlichen Kontext entstehen.
Eine Soziologie des religiös motivierten Essens: Dieses Kapitel entwickelt eine soziologische Perspektive auf religiös motiviertes Essen. Es analysiert die gesellschaftlichen Ebenen (Makro-, Meso- und Mikroebene) und betrachtet allgemeine soziologische Aspekte des Essens und der Ernährungssozialisation. Es untersucht den Einfluss von Geschmack, Kapital, Verfügbarkeit, Institutionalisierung, sozialen Beziehungen, Vorstellungen von Reinheit und Heiligkeit, Sinn und funktionale Systeme auf das religiös motivierte Essen. Die Grundlagen religiös motivierter Ernährung werden hier systematisch erarbeitet.
Die religiösen Vorstellungen vom richtigen Essen und richtigen Speisen: Dieses Kapitel untersucht konkrete Beispiele für religiös motiviertes Essen und die Zubereitung von Speisen. Es analysiert den Produktionsprozess, die verbindenden und trennenden Aspekte religiöser Ernährungsregeln, Askese und Fasten, Speisengebote und -verbote sowie die Folgen der Missachtung dieser Regeln. Es liefert detaillierte Einblicke in die Praxis religiös motivierter Ernährung.
Hin und wieder zurück – die Bedeutung der Ernährungs- und Speiseregeln in der postkonfessionellen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts: Dieses Kapitel beleuchtet die historische und gegenwärtige Entwicklung von Ernährungs- und Speiseregeln. Es betrachtet die Veränderung dieser Regeln im 20. Jahrhundert im Kontext von Fast Food, Rationalisierungsprozessen, Urbanisierung, Reiseverhalten und dem Einfluss des Internets. Der Einfluss von Migration und gesellschaftlichen Veränderungen auf die konfessionelle Zusammensetzung wird am Beispiel Deutschlands untersucht. Schließlich wird der Rückgang und Wandel religiöser Ernährungsregeln in der säkularisierten Gesellschaft analysiert.
Schlüsselwörter
Religiös motivierte Ernährung, Soziologie des Essens, Religionssoziologie, Ernährungssozialisation, Konfession, Religiosität, Speiseregeln, Fasten, Askese, Postkonfessionelle Gesellschaft, Säkularisierung, Multikulturalität, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Soziologie religiös motivierter Ernährung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Soziologie religiös motivierter Ernährung. Sie beleuchtet die Schnittstellen zwischen religiösen Verhaltensvorschriften und gesellschaftlichen Ernährungsgewohnheiten und analysiert die Herausforderungen für die heutige Gesellschaft.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Forschungsfeld der soziologischen Betrachtung religiös motivierter Ernährung zu erschließen und die Anschlussfähigkeit an verschiedene soziologische Theorien aufzuzeigen. Sie soll die Bedeutung von Ernährung im Kontext von Religion für weitere Untersuchungen zugänglich machen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung von Begriffen wie Spiritualität, Religion und Religiosität; die Rolle religiöser Vorstellungen im gesellschaftlichen Kontext; die soziologischen Ebenen (Makro-, Meso- und Mikroebene) des religiös motivierten Essens; die Auswirkungen religiöser Ernährungsregeln auf Geschmack, Kapital, Verfügbarkeit und soziale Beziehungen; und den Wandel religiös motivierter Ernährung in der postkonfessionellen Gesellschaft.
Welche Religionen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet hauptsächlich das Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus, wobei die Grenzen der Aussagekraft dieser Auswahl erläutert werden.
Welche soziologischen Theorien werden herangezogen?
Die Arbeit präsentiert und nutzt ausgewählte religionssoziologische Theorien und Modelle, die für die Untersuchung relevant sind. Genaueres wird im Kapitel "Religion und Soziologie" erläutert.
Wie werden die gesellschaftlichen Ebenen betrachtet?
Die Arbeit analysiert die gesellschaftlichen Ebenen (Makro-, Meso- und Mikroebene) des religiös motivierten Essens und untersucht den Einfluss verschiedener Faktoren auf das Essverhalten.
Welche Aspekte religiös motivierter Ernährung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht konkrete Beispiele für religiös motiviertes Essen und die Zubereitung von Speisen, den Produktionsprozess, verbindende und trennende Aspekte religiöser Ernährungsregeln, Askese und Fasten, Speisengebote und -verbote sowie die Folgen der Missachtung dieser Regeln.
Wie wird der Wandel in der postkonfessionellen Gesellschaft behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die historische und gegenwärtige Entwicklung von Ernährungs- und Speiseregeln und analysiert deren Veränderung im 20. und 21. Jahrhundert im Kontext von gesellschaftlichen Veränderungen wie Globalisierung, Migration und Säkularisierung. Der Einfluss von Migration und gesellschaftlichen Veränderungen auf die konfessionelle Zusammensetzung wird am Beispiel Deutschlands untersucht.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Religiös motivierte Ernährung, Soziologie des Essens, Religionssoziologie, Ernährungssozialisation, Konfession, Religiosität, Speiseregeln, Fasten, Askese, Postkonfessionelle Gesellschaft, Säkularisierung, Multikulturalität, Deutschland.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Religion-Definitionen und -Formen, Religion und Soziologie, Soziologie religiös motivierten Essens, Religiöse Vorstellungen vom richtigen Essen, und die Bedeutung der Ernährungsregeln in der postkonfessionellen Gesellschaft. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Zusammenfassung im Text.
Wo finde ich empirische Daten?
Die Arbeit schätzt die empirische Datenlage zu diesem Thema als gering ein.
- Quote paper
- M.A. Marion Röbkes (Author), 2012, Die Soziologie religiös motivierter Ernährung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204629