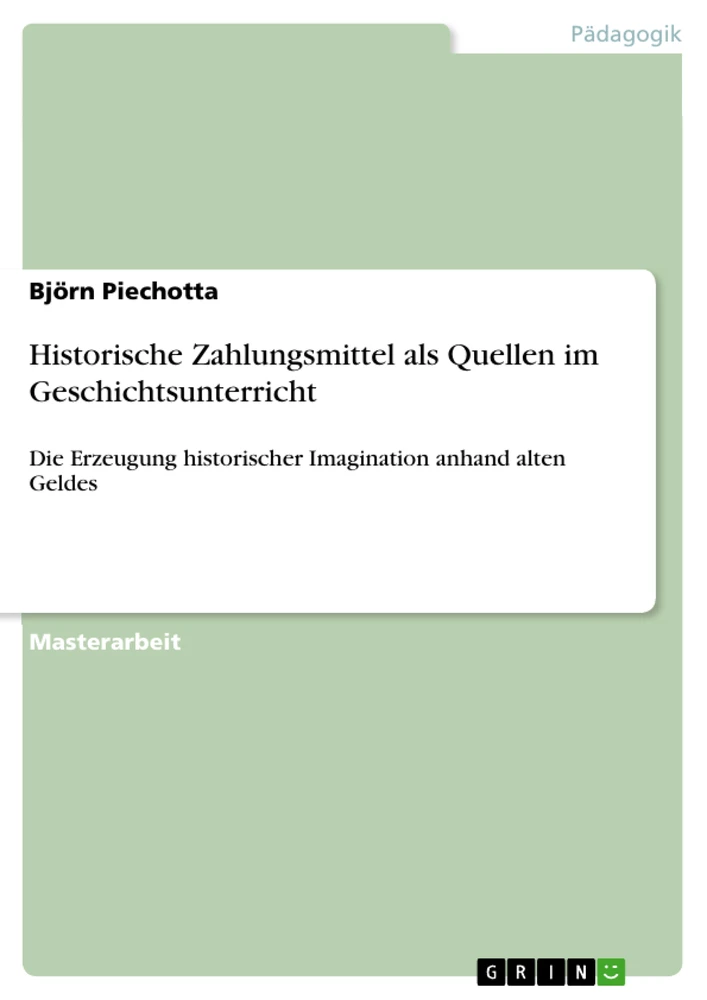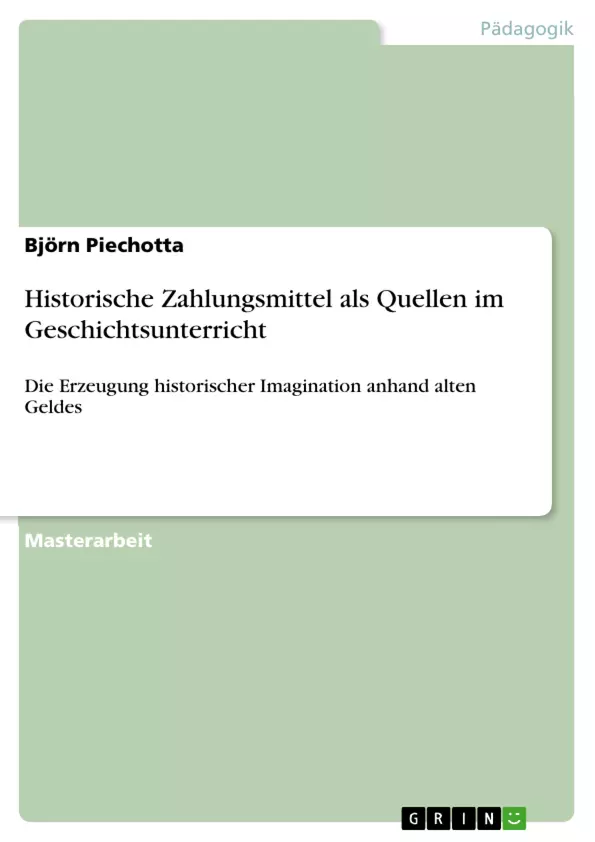Jeder von uns hat täglich Geld in der Hand. Wir kaufen Lebensmittel mit Banknoten und Münzen, zahlen es auf unsere Konten ein, um Miete, Strom- und Wasserrechnungen zu begleichen. Wir geben gerne Geld für unsere Freizeit aus, sei es im Kino, auf Reisen oder am Bockwurststand beim Open-Air-Konzert. Wir arbeiten hart, um an dieses Zahlungsmittel namens Geld zu gelangen und damit unser Leben auszugestalten. Geld bestimmt unseren Alltag entscheidend mit und zeigt uns Grenzen auf. So kann es darüber bestimmen, welche Kleidung wir tragen, wie weit eine Reise gehen kann oder wie oft im Monat ein Kinobesuch möglich ist. Zahlungsmittel begleiten uns durch die Geschichte hindurch. Sie sind, wie der Begriff bereits impliziert, Mittel und Gegenstand zum Erwerb von Waren, zur Bezahlung einer Dienstleistung oder zur Begleichung von Schulden. Als historische Quelle sind Zahlungsmittel Sachzeugnis vergangener Zeiten, alltägliche Gegenstände, die durch Jahrtausende hindurch nahezu denselben Zweck erfüllt haben.
Zwar war Geld nach unserem heutigen Verständnis vor der Prägung der ersten Münze noch nicht vorhanden, dennoch gab es Handel in Form von geregeltem Warentausch. Jedoch war der Tauschhandel schwierig, da nicht nur ein vielfältiges Angebot an Waren bestand, sondern auch die Qualität innerhalb eines Artikelsortiments stark variieren konnte. Bereits seit fast 3000 Jah- ren gibt es Zahlungsmittel in der uns heute geläufigen Form: die Münze. Waren frühe Münzen zunächst nur Elektronklumpen, in die ein lydischer Herrscher ein einfaches Symbol als Zeichen der Werthaltigkeit prägen ließ, so sind sie heute Kunst- und Designwerke wie auch Hightechprodukte. Seit die ersten Münzen ausgegeben wurden, zierten Herrschersymbole, Porträts, Alltagsszenen und Götterbildnisse auf vielfältigste Weise diese Zahlungsmittel. Weil jedermann sie wegen ihrer Werthaltigkeit begehrte, stellten sie ein Medium zur Kommunikation zwischen Herrschern und Untertanen dar, auf denen sich der Herrschaftsanspruch des Monarchen über seine Untertanen ausdrückte oder auch ein politisches Programm verkündet wurde.
In dieser Arbeit möchte ich anhand der Betrachtung von Zahlungsmitteln als Quelle im Geschichtsunterricht und den damit verbundenen Möglichkeiten zur Erzeugung historischer Imagination einen kleinen Einblick in ein offensichtlich sehr vielschichtiges Thema geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Didaktische Begründung
- Rahmenlehrplanbezug für die Sekundarstufe I, Land Berlin
- Die Imagination von Geschichte
- Die Kompetenz, den Hintergrund einer Quelle zu erfassen
- Das individuelle Verstricktsein durch historische Imagination
- Die Bedeutung von Imagination für die Geschichtsdidaktik
- Imaginationsimpulse und Historizität
- Die Imagination von Personen
- Historische Imagination anhand von Bildern
- Schwierigkeiten der Bildbetrachtung
- Grenzen der historischen Imagination
- Die Erzeugung von historischer Imagination anhand authentischen Materials
- Beispiele historischer Zahlungsmittel und ihre detaillierte Betrachtung
- Der Flottenhunderter: Betrachtung eines einzelnen Zahlungsmittels
- Reihenbetrachtung: Vom silbernem Dreimarkstück zur völligen Entwertung (1911-1923)
- Die Herangehensweise an historische Zahlungsmittel und ihr Einsatz im Unterricht
- Fragen an einen Geldschein
- Die Reihenbetrachtung in mehreren Schritten
- Die Bedeutung historischer Imagination in Bezug auf Zahlungsmittel
- Die Imagination als Moment der historischen Rekonstruktion
- Die Imagination als Moment (historischer) Rezeption
- Die Imagination als Moment narrativer Identität
- Die historische Imagination als Moment der Aneignung eines historischen Gegenstands
- Sind die vier Arten der historischen Imagination auf historische Zahlungsmittel anwendbar?
- Historische Imagination anhand alter Zahlungsmittel in der Praxis des Geschichtsunterrichts
- Woher nehmen, wenn nicht stehlen?
- Einsatz historischer Zahlungsmittel in der Unterrichtspraxis
- Antizipierte Schwierigkeiten bei der Betrachtung historischer Zahlungsmittel im Geschichtsunterricht
- Zahlungsmittel im fächerübergreifenden Unterricht
- Abschlussbetrachtungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit widmet sich der Bedeutung von historischer Imagination im Geschichtsunterricht, insbesondere anhand des Einsatzes historischer Zahlungsmittel als Quellen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis, wie die Betrachtung von altem Geld Schüler dazu anregen kann, die Vergangenheit zu imaginieren und so zu einem tieferen Verständnis historischer Ereignisse und Zusammenhänge zu gelangen. Die Arbeit analysiert, inwiefern historische Imagination einen Zugang zu vergangener Zeit ermöglicht und wie sie sich in den Geschichtsunterricht integrieren lässt.
- Historische Imagination als Schlüssel zur Rekonstruktion von Vergangenheit
- Die Rolle von Zahlungsmitteln als Träger historischer Narrationen
- Die Erzeugung historischer Imagination anhand textlicher und bildlicher Quellen
- Analyse von Zahlungsmitteln als multiperspektivische und kontroverse Aufgabe
- Didaktische Ansätze und praktische Beispiele für den Einsatz alter Zahlungsmittel im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die didaktische Begründung und den Rahmenlehrplanbezug für die Sekundarstufe I im Land Berlin darstellt. Das zweite Kapitel beleuchtet die Bedeutung von historischer Imagination im Allgemeinen, insbesondere mit Blick auf den Prozess des Sich-Vorstellens und Sich-Vergegenwärtigens. Es werden wichtige Aspekte wie die Kompetenz zur Kontextualisierung von Quellen, das individuelle Verstricktsein in Narrationen und die Notwendigkeit von Imaginationsimpulsen für eine gelingende Historizität erörtert. Die Schwierigkeiten und Grenzen der Imagination im Geschichtsunterricht werden ebenfalls beleuchtet.
Kapitel drei widmet sich der detaillierten Analyse von Beispielen historischer Zahlungsmittel, wobei der Fokus auf dem Flottenhunderter und der Reihenbetrachtung von Münzen aus der Zeit des Kaiserreichs und der Weimarer Republik liegt. Hier werden die bildlichen und textlichen Elemente der Quellen erläutert und ihre historische Bedeutung im Kontext ihrer Entstehung beleuchtet.
In Kapitel vier wird eine Methode vorgestellt, wie sich Schülerinnen und Schüler historischen Zahlungsmitteln nähern und Narrationen aus ihnen generieren können. Es werden konkrete Fragen und Analyseschritte für die Betrachtung von Banknoten präsentiert, die in der Unterrichtspraxis eingesetzt werden können.
Kapitel fünf beleuchtet die vier Arten der historischen Imagination, die Schörken definiert: als Moment der historischen Rekonstruktion, als Moment historischer Rezeption, als Moment narrativer Identität und als Moment der Aneignung eines historischen Gegenstands. Es wird untersucht, inwiefern diese vier Arten der Imagination auf den Umgang mit historischen Zahlungsmitteln anwendbar sind.
Kapitel sechs befasst sich mit dem praktischen Einsatz von alten Zahlungsmitteln im Geschichtsunterricht. Es werden Möglichkeiten und Herausforderungen des Themas beleuchtet und es werden konkrete Beispiele für die Integration historischer Imagination in den Unterricht gegeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Themen Historische Imagination, Geschichtsdidaktik, Zahlungsmittel, Quellenanalyse, Numismatik, Notaphilie, Hyperinflation, Narrative Identität, Rezeption, Rekonstruktion, Aneignung, Unterrichtseinheiten, Didaktische Ansätze.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "historischer Imagination" im Geschichtsunterricht?
Es ist die Fähigkeit von Schülern, sich vergangene Zeiten, Personen und Ereignisse anhand von Quellen lebendig vorzustellen und zu rekonstruieren.
Warum eignen sich alte Zahlungsmittel besonders gut als historische Quellen?
Sie sind alltagsnahe Sachzeugnisse, die Herrschaftsansprüche, politische Programme und wirtschaftliche Krisen (wie Inflation) direkt widerspiegeln.
Was ist der "Flottenhunderter"?
Ein spezifisches Beispiel für einen Geldschein, der in der Arbeit detailliert analysiert wird, um die Kommunikation zwischen Herrscher und Untertan zu zeigen.
Welche Rolle spielt die Hyperinflation (1923) in der Arbeit?
Anhand einer Reihenbetrachtung von Zahlungsmitteln wird die völlige Entwertung des Geldes und deren Auswirkung auf die historische Imagination untersucht.
Welche didaktischen Methoden werden für den Unterricht vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt konkrete Fragen an Geldscheine und Münzen sowie mehrstufige Reihenbetrachtungen vor, um historische Narrationen zu wecken.
Gibt es Grenzen für die historische Imagination?
Ja, die Arbeit reflektiert auch über die Schwierigkeiten der Bildbetrachtung und die Gefahr von Fehlinterpretationen bei mangelndem Kontextwissen.
- Quote paper
- Björn Piechotta (Author), 2012, Historische Zahlungsmittel als Quellen im Geschichtsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204653