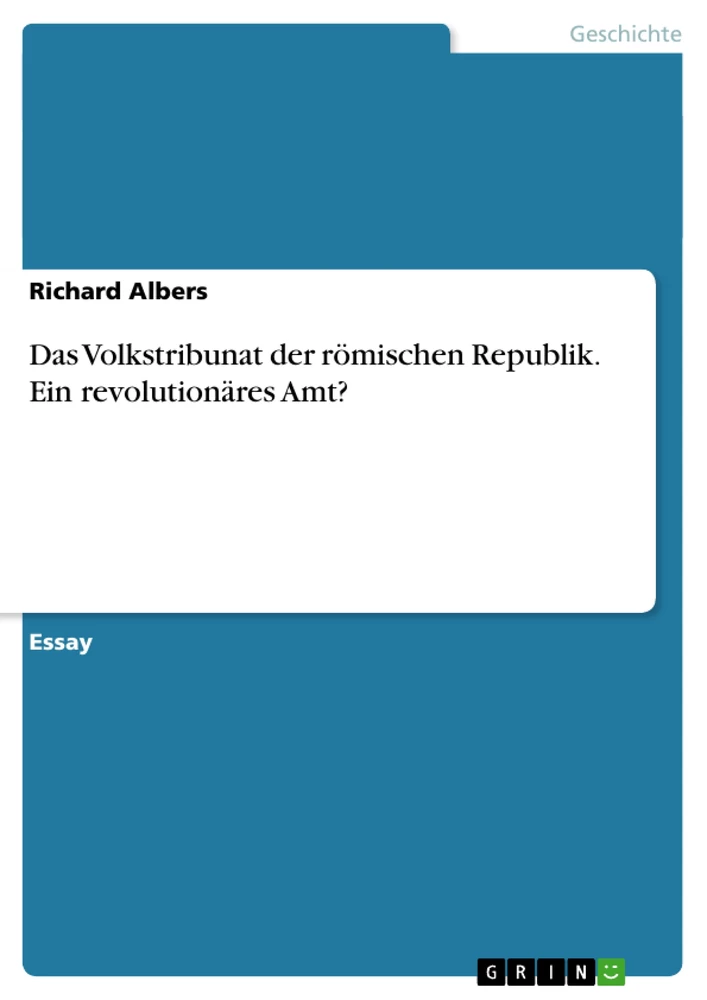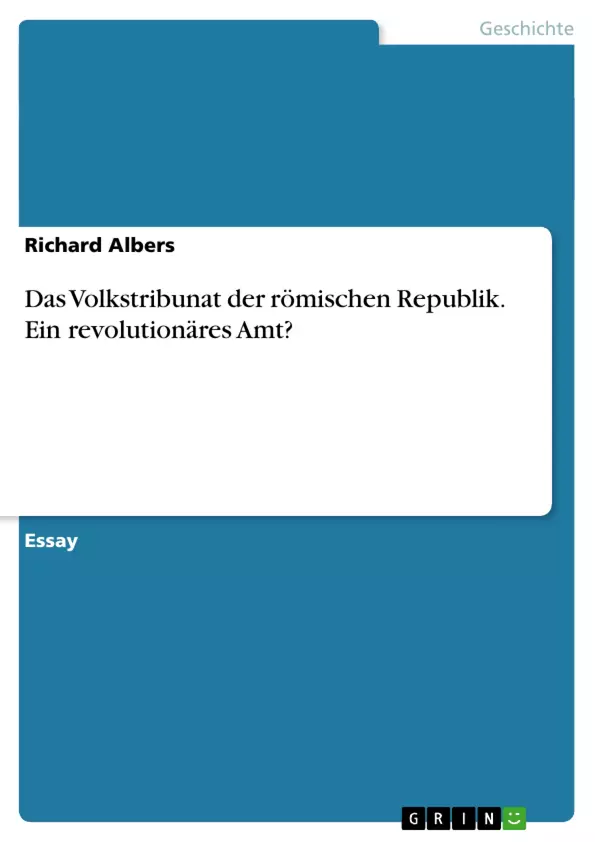Nach Beendigung der Tyrannei des Monarchen Tarquinius Superbus schufen sich die Römer
eine Verfassung die aus einer Mischung von Monarchie, Aristokratie und Demokratie
bestand. Im Wesentlichen beruhte die römische Republik auf drei Institutionen: dem Rat, der
Volksversammlung und den Ämtern. Die direkte Führung des Staates wurde von zwei
Konsuln übernommen, die die meisten Vollmachten des Königs übernahmen. Führende
Persönlichkeiten und ehemalige Amtsträger bildeten den Senat. Des Weiteren gab es noch
verschiedene Magistrate wie etwa die Praetores oder die Quaestores. Ihre Aufgaben waren
beispielsweise das Gerichtswesen und die Statthalterschaft der Provinzen außerhalb Roms
(Praetores) oder sie waren Finanzbeamte und verwalteten verschiedene Kassen (Quaestores).
Alle Ämter wurden allerdings vornehmlich von Patriziern bekleidet. So war das
demokratische Element zu Beginn der Republik noch recht gering.
Dies änderte sich um 494 v. Chr., in der Zeit der Ständekämpfe. Nun gründeten die Plebejer
eine eigene Versammlung, das Volkstribunat wurde eingerichtet und zum 10. Dezember eines
jeden Jahres wurden 10 neue Volkstribunen in dieses Kollegium gewählt. Dies geschah mit
der Intention sich eine wirksame Institution gegen die immense Übermacht der patrizischen
Bevölkerung in den hohen Ämtern des Staates zu schaffen. Diese gegen den Staat gerichtete
und wohl als revolutionär anzusehende Gewalt war allerdings nicht ein Bestandteil der
öffentlichen Rechtsordnung. Vielmehr waren die Volkstribune „Beamte für die Plebs“. Sie
waren Sprachführer und gleichzeitig oberste Behörde. Doch da sie wie gesagt ein quasi
„illegales Amt“ bekleideten und ihre Aktionen somit nicht rechtlich abgesichert waren,
mussten sie irgendwie vor Angriffen geschützt werden. Zur Lösung dieses Problems wurden
sie von den Plebejern für sacrosanctus (unverletzlich) erklärt und mit einem religiösen Tabu
belegt. Dies alles war unerlässlich für ihre eigentliche Aufgabe: den Schutz der Plebs bei
Übergriffen der ordentlichen Magistrate, das auxillium. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Das Volkstribunat der römischen Republik: Ein revolutionäres Amt?
- Die Entstehung des Volkstribunats
- Das Volkstribunat und die Ständekämpfe
- Das Hortensische Gesetz und die Legalisierung des Volkstribunats
- Das Volkstribunat und der Senat
- Tiberius Gracchus und die Reform des ager publicus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte und Entwicklung des römischen Volkstribunats, um dessen Rolle im politischen System der Republik zu analysieren und die Frage nach seinem revolutionären Charakter zu beantworten. Die Analyse konzentriert sich auf die Entstehung des Amtes, seine Rolle in den Ständekämpfen, seine Legalisierung und die Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Senat und Volkstribunat. Schließlich wird der Fall Tiberius Gracchus als Wendepunkt in der Geschichte des Amtes beleuchtet.
- Entstehung und ursprünglicher Zweck des Volkstribunats
- Das Volkstribunat in den Ständekämpfen und seine Rolle im politischen System
- Die Legalisierung des Volkstribunats durch das Hortensische Gesetz
- Das Verhältnis zwischen Senat und Volkstribunat
- Der Fall Tiberius Gracchus als Wendepunkt
Zusammenfassung der Kapitel
Das Volkstribunat der römischen Republik: Ein revolutionäres Amt?: Diese Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem revolutionären Charakter des römischen Volkstribunats. Sie führt in die historische und politische Situation Roms ein und skizziert die wichtigsten Themen der Arbeit.
Die Entstehung des Volkstribunats: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung des Volkstribunats im Kontext der frühen römischen Republik und der Ständekämpfe zwischen Patriziern und Plebejern. Es beleuchtet den Mangel an demokratischer Beteiligung der Plebejer und die Notwendigkeit einer Institution zum Schutz ihrer Interessen. Der Fokus liegt auf der ursprünglichen, quasi-illegalen Natur des Amtes und den Maßnahmen zum Schutz der Volkstribunen vor Übergriffen.
Das Volkstribunat und die Ständekämpfe: Das Kapitel detailliert die Rolle des Volkstribunats in den Ständekämpfen. Es untersucht die Strategien der Volkstribunen, wie z.B. Intercessio und die Beeinflussung des politischen Prozesses durch Streiks und Massenproteste. Die Grenzen der Macht des Volkstribunats werden ebenso herausgearbeitet, z.B. die Unmöglichkeit, Befehle zu erteilen.
Das Hortensische Gesetz und die Legalisierung des Volkstribunats: Dieses Kapitel analysiert das Hortensische Gesetz (lex Hortensia) von 287 v. Chr. und seine weitreichenden Folgen für das Volkstribunat. Es beschreibt die Eingliederung des Tribunats in die bestehenden Magistrate und die Anerkennung der Volksversammlungen der Plebs. Die neuen Rechte und Befugnisse der Volkstribunen werden detailliert erläutert, einschließlich ihrer erweiterten Interzessionsrechte und der Gesetzeskraft der Plebiscite.
Das Volkstribunat und der Senat: Das Kapitel untersucht das komplexe Verhältnis zwischen Volkstribunat und Senat nach der Legalisierung des Tribunats. Es wird die Entwicklung der Zusammenarbeit, aber auch der Spannungen zwischen beiden Institutionen analysiert. Der Fokus liegt auf den Mechanismen der politischen Einflussnahme und Konfliktlösung, wie z.B. Verhandlungen und Kompromisse. Die Eingliederung einflussreicher Plebejer in die Aristokratie wird als wichtiger Faktor für die Entspannung der Spannungen dargestellt.
Tiberius Gracchus und die Reform des ager publicus: Dieses Kapitel fokussiert sich auf die Reformen von Tiberius Gracchus und ihre Auswirkungen auf das Volkstribunat. Es analysiert seinen Gesetzesvorschlag zur Umverteilung des Staatslandes (ager publicus) und den Widerstand im Senat. Die Konfrontation zwischen Tiberius Gracchus und dem Senat, einschließlich der Entmachtung eines Tribunen durch Gracchus, wird ausführlich behandelt, und die Frage, ob dies ein Rückfall in den revolutionären Charakter des Amtes bedeutet, wird gestellt.
Schlüsselwörter
Römische Republik, Volkstribunat, Ständekämpfe, Patrizier, Plebejer, Hortensisches Gesetz, Senat, Intercessio, Plebiscit, Tiberius Gracchus, ager publicus, Revolution, politische Macht, Rechtsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum römischen Volkstribunat
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Geschichte und Entwicklung des römischen Volkstribunats in der Republik. Der Fokus liegt auf der Analyse seiner Rolle im politischen System und der Beantwortung der Frage nach seinem revolutionären Charakter.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung des Volkstribunats, seine Rolle in den Ständekämpfen zwischen Patriziern und Plebejern, seine Legalisierung durch das Hortensische Gesetz, das Verhältnis zwischen Volkstribunat und Senat, und schließlich den Fall Tiberius Gracchus als Wendepunkt in der Geschichte des Amtes. Die Arbeit beleuchtet auch die ursprünglichen Befugnisse der Volkstribunen, ihre Strategien (wie Intercessio), und die Auswirkungen ihrer Handlungen auf das römische politische System.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage. Es folgen Kapitel zur Entstehung des Volkstribunats, seiner Rolle in den Ständekämpfen, der Legalisierung durch das Hortensische Gesetz, dem Verhältnis zum Senat und schließlich der Analyse der Reformen von Tiberius Gracchus und deren Auswirkungen.
Was ist das Hortensische Gesetz und welche Bedeutung hat es?
Das Hortensische Gesetz (lex Hortensia) von 287 v. Chr. legalisierte das Volkstribunat und gab den Beschlüssen der Plebs (Plebisziten) Gesetzeskraft. Dies bedeutete eine grundlegende Änderung im römischen politischen System und stärkte die Position der Plebejer erheblich.
Welche Rolle spielte das Volkstribunat in den Ständekämpfen?
Das Volkstribunat spielte eine zentrale Rolle in den Ständekämpfen. Volkstribunen schützten die Interessen der Plebejer, setzten sich gegen die Patrizier ein und nutzten Strategien wie Intercessio und den Einfluss von Streiks und Massenprotesten, um politische Veränderungen zu erreichen. Die Arbeit untersucht sowohl die Erfolge als auch die Grenzen der Macht des Volkstribunats in diesem Kontext.
Wie war das Verhältnis zwischen Volkstribunat und Senat?
Das Verhältnis zwischen Volkstribunat und Senat war komplex und von Zusammenarbeit und Spannung geprägt. Die Arbeit analysiert die Entwicklung dieser Beziehung nach der Legalisierung des Tribunats und beleuchtet die Mechanismen der politischen Einflussnahme und Konfliktlösung, wie z.B. Verhandlungen und Kompromisse. Die Eingliederung einflussreicher Plebejer in die Aristokratie wird als wichtiger Faktor für die Entspannung der Spannungen dargestellt.
Welche Bedeutung hat der Fall Tiberius Gracchus?
Der Fall Tiberius Gracchus wird als Wendepunkt in der Geschichte des Volkstribunats betrachtet. Seine Reformen, insbesondere sein Gesetzesvorschlag zur Umverteilung des Staatslandes (ager publicus), führten zu einer Konfrontation mit dem Senat und werfen die Frage auf, ob dies einen Rückfall in den revolutionären Charakter des Amtes bedeutete.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Römische Republik, Volkstribunat, Ständekämpfe, Patrizier, Plebejer, Hortensisches Gesetz, Senat, Intercessio, Plebiszit, Tiberius Gracchus, ager publicus, Revolution, politische Macht, Rechtsentwicklung.
Welche Forschungsfrage steht im Zentrum der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob das römische Volkstribunat ein revolutionäres Amt war.
- Citar trabajo
- Richard Albers (Autor), 2003, Das Volkstribunat der römischen Republik. Ein revolutionäres Amt?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20469