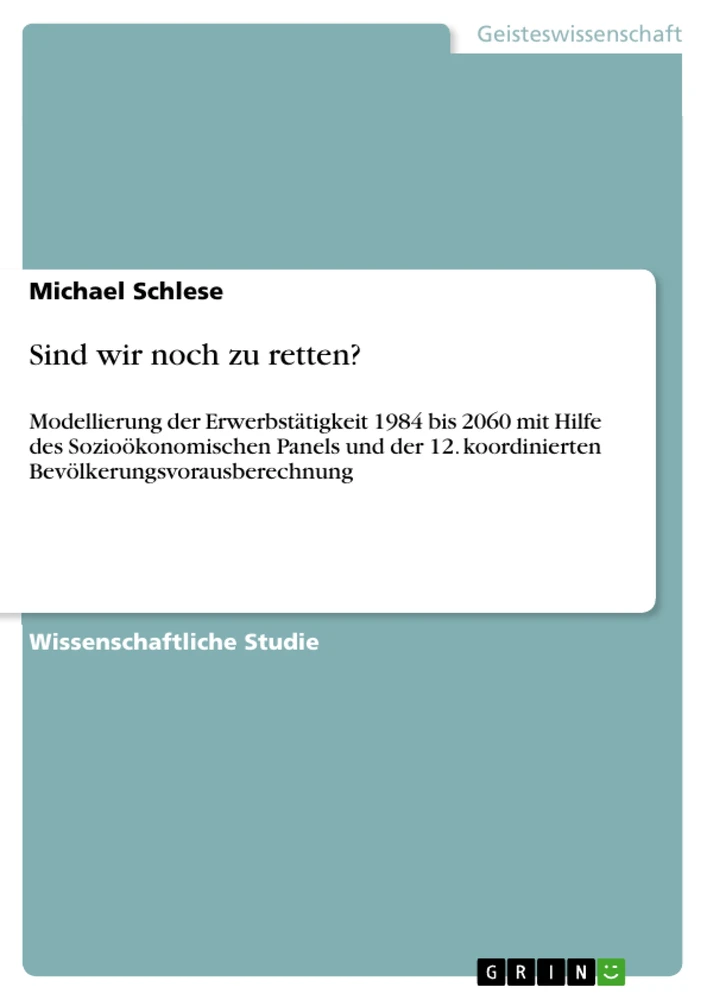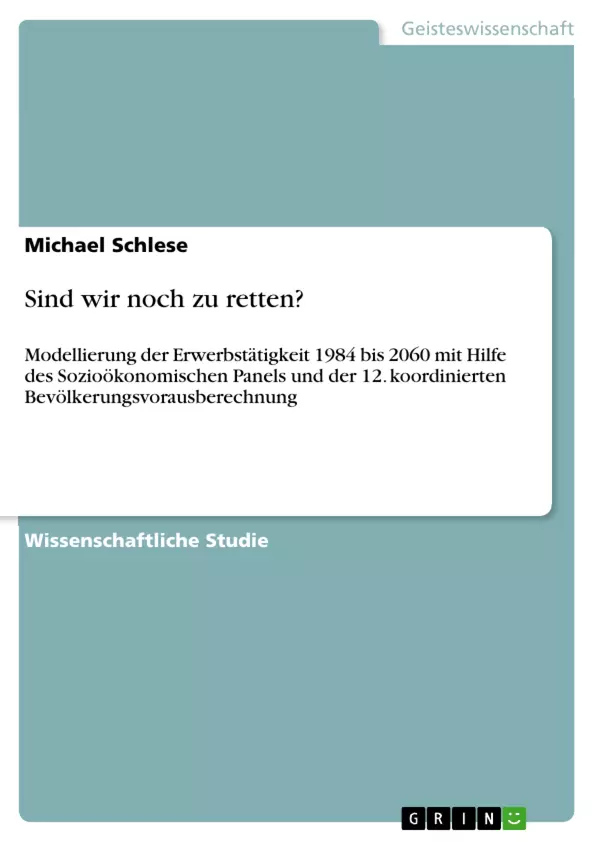Mit Hilfe des Sozioökonomischen Panels (1984 bis 2010) und der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (2011 bis 2060) wurde geprüft, ob die Herausforderungen des demografischen Wandels durch eine Anpassung der Arbeitszeiten bewältigt werden können. Im Ergebnis lassen sich Grundzüge einer „Neuen Erwerbsgesellschaft“ ausmachen: Wir werden älter, erwerbstätiger (also arbeitsarmer und wohlhabender) sowie multikultureller… Hierbei wurde unterstellt, dass das wöchentliche Arbeitszeitvolumen je Einwohner/in wie seit 1984 im Mittel 18 Stunden beträgt. Außerdem wurde eine maximale wöchentliche Arbeitszeit je Erwerbstätigen von 40 Stunden angenommen, was einem Wert aus der Mitte der 1980er Jahre entspricht. Im Ergebnis lässt sich zeigen, dass (im Jahr 2060) mit einer Erwerbsbeteiligung von 80% und einer Wochenarbeitszeit von 41 Stunden das im Verhältnis zur Bevölkerungsentwicklung notwendige Arbeitszeitvolumen aufzubringen ist.
Um die tatsächliche Erwerbsbeteiligung unter Berücksichtigung der Ausbildungszeiten zu realisieren, kann von einer Verschiebung des Renteneintrittsalters auf 69 Lebensjahre ausgegangen werden. Der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund wird nach den vorliegenden Berechnungen im Jahr 2060 mindestens 40% betragen (im Jahr 2010 waren es 19%). Die „Transferlast“, d.h. der Anteil von Transferempfängern (d.h. Nicht-Erwerbstätigen) an den Einwohner/innen wird sich von 50% (2010) auf 60% (2060) erhöhen. Angesichts höherer mittlerer Einkommen der Erwerbstätigen (durch längere Arbeitszeiten), einer stärkeren und längeren Erwerbsbeteiligung sowie möglicherweise höherer Arbeitsproduktivität sollte diese „Last“ tragbar sein. Insgesamt wird – gemäß den Modellannahmen - die Beschäftigung je Einwohner/in konstant bleiben, je Erwerbstätigen steigen und volkswirtschaftlich (gemessen als Arbeitszeitvolumen) sinken. Ob deshalb die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft sinkt, das hängt von der Arbeitsproduktivität ab.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Inhaltsverzeichnis
- Verzeichnis der Tabellen
- Verzeichnis der Abbildungen
- Verzeichnis der Abkürzungen
- Fragestellung
- Quellen und Methode
- Grundmodell
- Arbeitszeiten 1984 bis 2010
- Arbeitszeiten 2011 bis 2060
- Transferempfänger
- Migrationshintergrund
- Die „Neue Erwerbsgesellschaft”
- Quellenverzeichnis
- Tabellen
- Abbildungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Beitrag untersucht, ob die Herausforderungen des demografischen Wandels durch eine Anpassung der Arbeitszeiten bewältigt werden können. Hierzu werden Daten des Sozioökonomischen Panels (SOEP) von 1984 bis 2010 und der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (2011 bis 2060) herangezogen.
- Analyse der Auswirkungen des demografischen Wandels auf das Beschäftigungssystem
- Beurteilung des Einflusses von Arbeitszeiten auf die Bewältigung des demografischen Wandels
- Entwicklung eines Modells zur Prognose der zukünftigen Erwerbstätigkeit
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Erwerbsbeteiligung, Transferlast und der „Neuen Erwerbsgesellschaft”
- Bewertung der Rolle von Migration und Integration im Kontext des demografischen Wandels
Zusammenfassung der Kapitel
Der Beitrag beginnt mit einer Einleitung zur Fragestellung und zur Relevanz des Themas demografischer Wandel. Anschließend werden die Quellen und die Methode der Analyse vorgestellt. Das Grundmodell zur Modellierung der Erwerbstätigkeit wird erläutert, wobei die Beziehung zwischen Einwohnerzahl, Erwerbsfähigen, Erwerbstätigen, Arbeitszeitvolumen und Transferempfängern dargestellt wird. Die Arbeitszeiten von 1984 bis 2010 werden anhand von Daten des SOEP analysiert, wobei die Veränderungen der Altersstruktur, der Erwerbstätigkeit und der tatsächlichen Wochenarbeitszeiten beleuchtet werden. Der Beitrag untersucht die Entwicklung der Erwerbsbeteiligung und der Transferlast im Zeitverlauf und analysiert die Rolle von Personen mit Migrationshintergrund in der „Neuen Erwerbsgesellschaft”.
Schlüsselwörter
Demografischer Wandel, Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit, Sozioökonomisches Panel (SOEP), Bevölkerungsvorausberechnung, Transferempfänger, Transferlast, Migrationshintergrund, „Neue Erwerbsgesellschaft”, Lebensarbeitszeit, Integration
Häufig gestellte Fragen
Kann der demografische Wandel durch Arbeitszeitanpassung bewältigt werden?
Ja, die Modellrechnung zeigt, dass mit einer Erwerbsbeteiligung von 80 % und einer Wochenarbeitszeit von 41 Stunden das notwendige Volumen bis 2060 erbracht werden kann.
Auf welches Alter müsste das Renteneintrittsalter steigen?
Um die notwendige Erwerbsbeteiligung unter Berücksichtigung der Ausbildungszeiten zu realisieren, wird von einem Renteneintritt mit 69 Jahren ausgegangen.
Wie hoch wird der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund 2060 sein?
Nach den Berechnungen der Arbeit wird dieser Anteil im Jahr 2060 bei mindestens 40 % liegen (im Vergleich zu 19 % im Jahr 2010).
Was versteht man unter der sogenannten „Transferlast“?
Es ist der Anteil der Nicht-Erwerbstätigen (Transferempfänger) an der Gesamtbevölkerung, der laut Prognose von 50 % auf 60 % steigen wird.
Was sind die Merkmale der prognostizierten „Neuen Erwerbsgesellschaft“?
Die Gesellschaft wird älter, multikultureller und durch eine höhere individuelle Erwerbstätigkeit (längere Lebensarbeitszeit) gekennzeichnet sein.
- Citar trabajo
- Dr. Michael Schlese (Autor), 2012, Sind wir noch zu retten?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204707