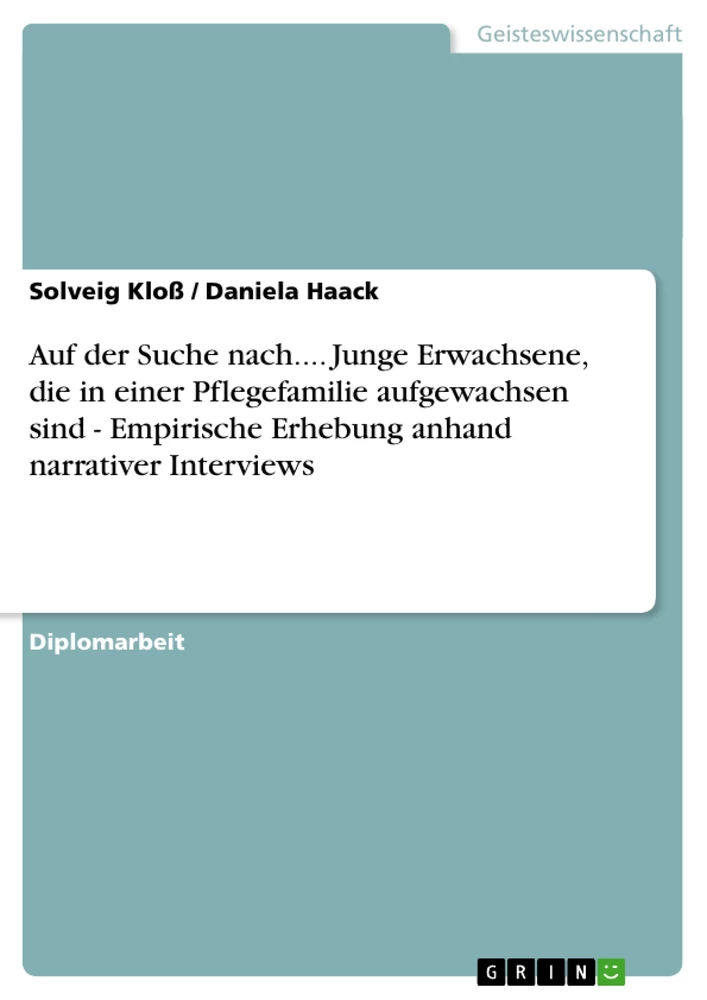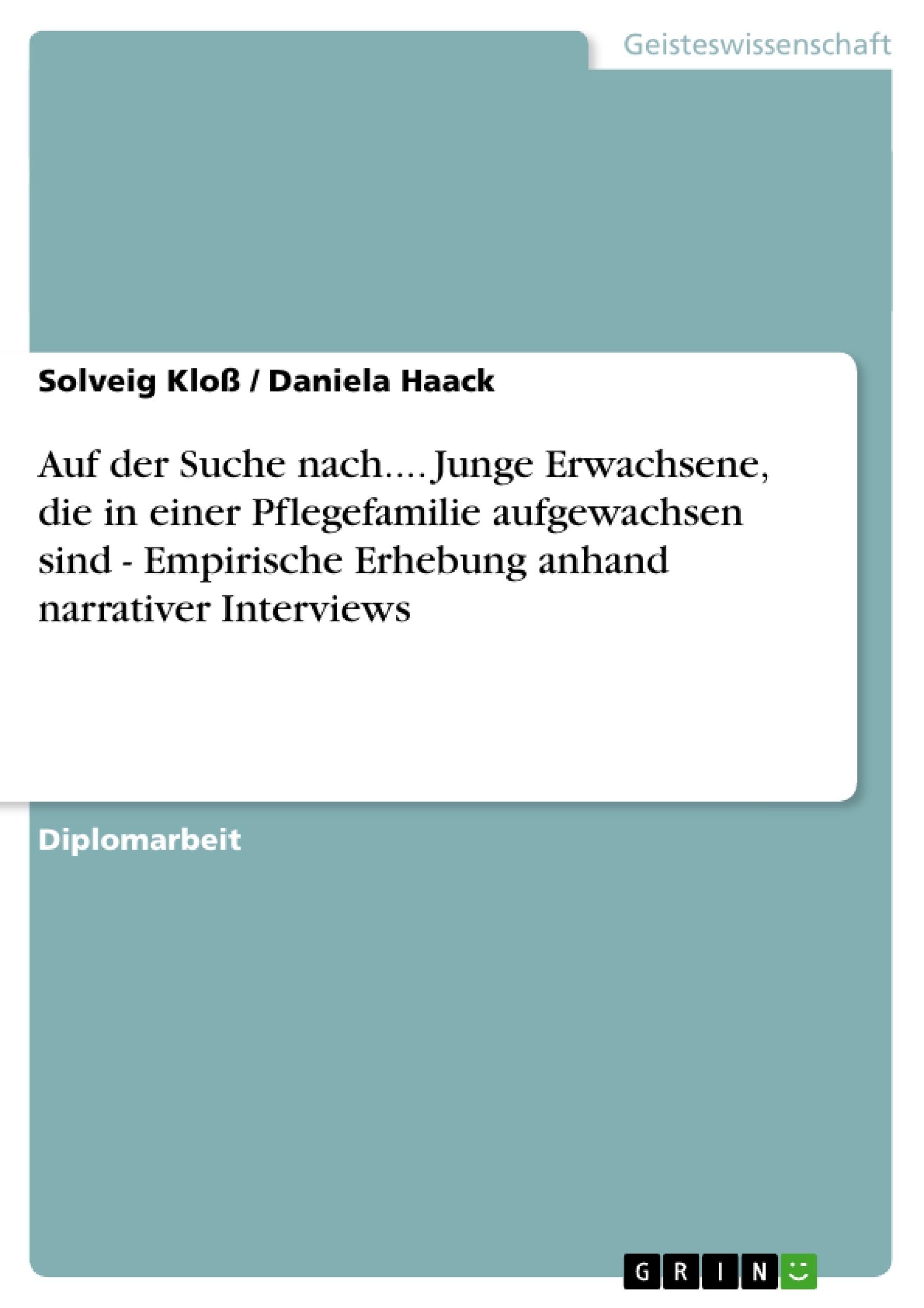Zur Einführung in den Bereich des Pflegekinderwesens werden wir, unsere Arbeit mit
einem kurzen Überblick über aktuelle Zahlen und Fakten zu Pflegekindern beginnen.
Anschließend beschreiben wir die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII. Wir beschränken
uns nur auf diesen einen Paragraphen, da er für unsere empirische Arbeit relevant ist.
In der heutigen Gesellschaft gibt es eine große Anzahl von Gründen für die Inpflegegabe
eines Kindes. Festzuhalten ist jedoch, dass ein Grossteil der betroffenen Kinder aus einem
unsicheren Lebensmilieu kommt und kaum Beziehungsstabilitäten und darum auch keine
ausreichende Zuwendung erfahren konnte. Oft gilt die kindlich Entwicklung als gefährdet,
da auch keine adäquate Förderung in der Herkunftsfamilie sichergestellt werden kann.1
Auf die Details gehen wir in Kapitel 3 ausführlicher ein.
Im weiteren Verlauf unserer Arbeit beschäftigen wir uns mit der Bindungstheorie nach
John Bowlby.2 Zu Beginn skizzieren wir die Entstehungsgeschichte der Bindungstheorie.
Sie geht davon aus, dass Kinder schon im frühen Säuglingsalter eine Bindung zu einer
ihnen nahestehenden Bezugperson aufbauen. Die Kinder verinnerlichen bei dem Aufbau
der Bindung innere Bindungsmuster, auf die wir in Kapitel 4.1 ausführlicher eingehen
werden.
Pflegekinder haben in ihrer Herkunftsfamilie Trennungen von ihrer Mutter oder anderen
ihnen nahestehenden Personen erlebt, Bowlby und Ainsworth sprechen hier von der
„Deprivation“, die wir im Kapitel 4.2 näher erläutern werden.
Jedes Kind ist ein Individuum/einzigartig und bringt andere Erlebnisse und Erfahrungen
aus der Vergangenheit mit, die auch in seiner Entwicklung sichtbar werden. Somit werden
besondere Anforderungen an die Pflegefamilie gestellt. Oftmals sind diese Kinder in ihrem
Verhalten auffällig und bringen traumatische Erfahrungen mit in die Ersatzfamilie. Damit
eine Integration des Pflegekindes in die Ersatzfamilie gelingt, bedarf es bestimmter
Bedingungen, auf die wir in Kapitel 5.1 eingehen werden.
Hat ein Kind in den ersten Lebensjahren feste Bindungsmuster zu einer Bindungsperson
aufgebaut, werden diese im weiteren Leben manifestiert. Einen wesentlichen Einfluss nehmen sie auch auf die Integration von Kindern in Ersatzfamilien. [...]
1 vgl. dazu ausführlich Jordan,1996
2 vgl. dazu ausführlich Spangler/Zimmermann, 1999
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Aktuelle Lage im Pflegekinderwesen
- Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII
- Warum ein Kind zum Pflegekind wird.
- Gefährdung des Kindeswohls nach § 1666 BGB
- Bindungstheorie
- Innere Arbeitsmodelle von Bindung
- Das sichere Modell
- Das unsicher- ambivalente Modell
- Das unsicher- vermeidende Modell
- Das unsicher- desorganisierte Modell.
- Deprivation
- Die Integration des Kindes in die Pflegefamilie.
- Bedingung für eine Förderung von Integration
- Die Pflegeeltern
- Die Geschwisterkonstellation
- Die Herkunftseltern
- Pflegekind
- Phasen der Integration
- Die Anpassungsphase
- Die Übertragungsphase
- Die Regressionsphase.
- Die Sozialpädagogische Arbeit im Pflegekinderwesen
- Die Arbeit mit dem Kind
- Die Arbeit mit der Herkunftsfamilie.
- Die Arbeit mit den Pflegeeltern
- Empirischer Teil
- Die Methode des narrativen Interviews.
- Die Erhebung des Datenmaterials.
- Die Analyse
- Forschungsfragen.
- Vollständige Fallrekonstruktion der Interviews mit Elke und Bastian
- Vorfeldanalyse: Kontaktaufnahme und Interviewsituation mit Elke
- Struktur der erzählte Lebensgeschichte.
- Struktur der erlebten Lebensgeschichte.
- Kontrastierung: „Auf der Suche nach einer Mutter“.
- Vorfeldanalyse: Kontaktaufnahme und Interviewsituation mit Bastian
- Struktur der erzählten Lebensgeschichte.
- Struktur der erlebten Lebensgeschichte.
- Kontrastierung: „Auf der Suche nach einer Familie“.
- Globalanalyse der Interviews mit Melda und Janina
- Vorfeldanalyse: Kontaktaufnahme und Interviewsituation mit Melda
- Struktur der erzählten Lebensgeschichte
- Struktur der erlebten Lebensgeschichte.
- Vorfeldanalyse: Kontaktaufnahme und Interviewsituation mit Janina.
- Struktur der erzählten Lebensgeschichte.
- Struktur der erlebten Lebensgeschichte.
- Die Ergebnisse unserer Biographieforschung in einer Gegenüberstellung.
- Schlussbetrachtung.
- Die Bedeutung unserer Biographieforschung für die Soziale Arbeit
- Die Bedeutung der allgemeinen Biographieforschung für die Soziale Arbeit
- Integration von Pflegekindern in Pflegefamilien
- Bindungstheorie und ihre Relevanz für das Pflegekinderwesen
- Biographieforschung als Methode zur Erforschung von Lebensgeschichten
- Die Rolle der Sozialpädagogischen Arbeit im Pflegekinderwesen
- Die Bedeutung der Biographieforschung für die Soziale Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, das Pflegekinderwesen aus einer biographischen Perspektive zu beleuchten und die Integration von Kindern in Pflegefamilien zu untersuchen. Dabei steht die Analyse der Lebensgeschichten von Pflegekindern und ihrer Erfahrungen im Mittelpunkt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Pflegekinderwesen ein und gibt einen Überblick über aktuelle Zahlen und Fakten zu Pflegekindern. Das erste Kapitel beleuchtet die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII und beschreibt die Gründe, warum Kinder in Pflegefamilien gegeben werden. Kapitel 2 untersucht die Bindungstheorie nach John Bowlby und ihre Bedeutung für die Integration von Pflegekindern. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Integration von Kindern in Pflegefamilien und den Bedingungen, die eine erfolgreiche Integration fördern. Das vierte Kapitel behandelt die Sozialpädagogische Arbeit im Pflegekinderwesen und beschreibt die Arbeit mit Kindern, Herkunftsfamilien und Pflegeeltern. Der empirische Teil der Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Methode des narrativen Interviews. Die folgenden Kapitel präsentieren die vollständigen Fallrekonstruktionen der Interviews mit Elke und Bastian sowie die Globalanalyse der Interviews mit Melda und Janina. Abschließend werden die Ergebnisse der Biographieforschung in einer Gegenüberstellung präsentiert.
Schlüsselwörter
Pflegekinderwesen, Integration, Bindungstheorie, Biographieforschung, narratives Interview, Sozialpädagogische Arbeit, Lebensgeschichten.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt der § 33 SGB VIII im Pflegekinderwesen?
Der § 33 SGB VIII regelt die Vollzeitpflege, bei der Kinder für eine befristete Zeit oder auf Dauer in einer anderen Familie als ihrer Herkunftsfamilie untergebracht werden.
Warum ist die Bindungstheorie nach John Bowlby für Pflegekinder wichtig?
Die Bindungstheorie erklärt, wie frühe Erfahrungen mit Bezugspersonen innere Arbeitsmodelle prägen. Da Pflegekinder oft Trennungen oder Deprivation erlebt haben, beeinflussen diese Muster maßgeblich ihre Integration in die neue Familie.
Was versteht man unter „Deprivation“?
Deprivation bezeichnet den Mangel an emotionaler Zuwendung und stabilen Bindungen, den viele Pflegekinder in ihrer Herkunftsfamilie erfahren haben.
Welche Phasen durchläuft ein Kind bei der Integration in eine Pflegefamilie?
In der Arbeit werden die Anpassungsphase, die Übertragungsphase und die Regressionsphase als zentrale Schritte der Integration beschrieben.
Welche empirische Methode wurde in der Arbeit angewandt?
Es wurden narrative Interviews mit jungen Erwachsenen geführt, die in Pflegefamilien aufgewachsen sind, um deren Lebensgeschichten biographisch zu rekonstruieren.
- Citation du texte
- Solveig Kloß (Auteur), Daniela Haack (Auteur), 2003, Auf der Suche nach.... Junge Erwachsene, die in einer Pflegefamilie aufgewachsen sind - Empirische Erhebung anhand narrativer Interviews, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20470