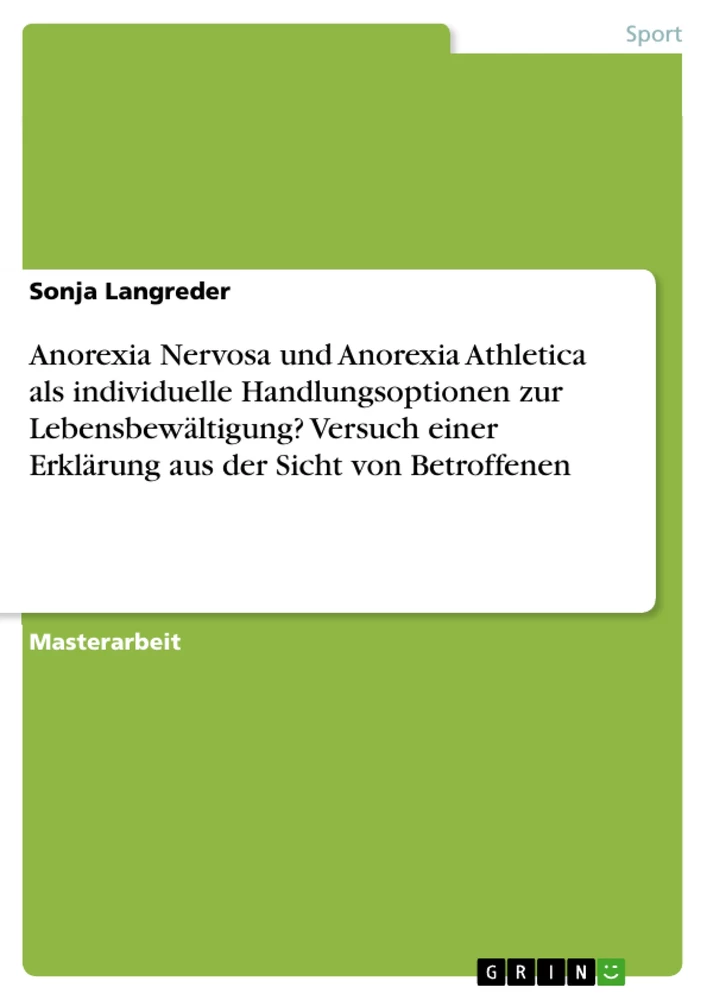In den Medien sowie wissenschaftlicher Literatur werden „Anorexia nervosa-Patientinnen“ oftmals stereotypisiert. Die zahlreichen Gemeinsamkeiten, die anscheinend im Leben jeder Magersüchtigen existieren, führen leicht zu der Auffassung, dass eine Generalisierung der Krankheit ausreicht, um diese zu verstehen. Dennoch sind die Krankheitsgründe, -funktionen und -verläufe von Anorexia nervosa bei (Nicht-) Athletinnen individuell sehr verschieden und folglich gibt es nicht „die“ typische Anorexia nervosa-Patientin.
Um sich als Außenstehender, nicht Betroffener, intensiv und mehrperspektivisch mit der Krankheit bzw. dem Thema „Magersucht“ auseinandersetzen zu können, sollte man Verallgemeinerungen aufgeben, da diese allein nicht ausreichen. Stattdessen bieten sich vielmehr differenzierte und umfangreiche Erklärungsansätze an, um nachvollziehen zu können, warum genau „diese“ Frau zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt die Krankheit als individuelle Handlungsoption zur Lebensbewältigung unter vielen anderen „ausgewählt“ hat. Die Krankheit hat immer einen persönlichen Sinn und Zweck, welcher niemals derselbe ist und oftmals in den Hintergrund rückt.
Aus diesem Grund habe ich mich dafür entschieden, das Individuum und deren persönliche Biographie in den Vordergrund des praktischen Forschungsteils zu stellen.
Bevor ich jedoch in dem praktischen Forschungsteil eine empirische Auswertung dreier narrativer-biographisch orientierter Interviews präsentiere, informiere ich den Leser in einem theoretischen Abschnitt über die aktuellen, wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Teil I – Theorie zum Krankheitsbild
- Begriffserläuterung zur Eingrenzung des Untersuchungsthemas Essstörungen und (Leistungs-)Sport
- Anorexia nervosa (Magersucht)
- Anorexia athletica
- Magersucht und Sport: Warum erkranken so viele Sportlerinnen an der Anorexia nervosa?
- Hungern und Sport - Magersucht und Sportsucht
- Erkenntnisse aus Teil I
- Teil II - Biographienforschung
- Eingrenzung der forschungsrelevanten Begriffe
- Das narrative Interview als Möglichkeit zur biographischen Fallrekonstruktion
- Die Interviews
- Präsentation der empirischen Erhebung - Die drei Biographien
- Auswertung der Interviews - Gegenüberstellung der Interviews
- Einbettung der Hypothese in Erkenntnisse der wissenschaftlichen Literatur
- Abschlussdiskussion: Fazit und Ergebnissicherung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Anorexia nervosa und Anorexia athletica, insbesondere im Kontext von Leistungssport. Ziel ist es, anhand von biographischen Interviews individuelle Handlungsoptionen zur Lebensbewältigung von Betroffenen zu analysieren und ein besseres Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zwischen Essstörungen und Sport zu entwickeln.
- Differenzierung von Anorexia nervosa und Anorexia athletica
- Zusammenhang zwischen Leistungssport und Essstörungen
- Analyse individueller Bewältigungsstrategien von Betroffenen
- Rollen von soziokulturellen und psychosozialen Faktoren
- Biographische Identitätsfindung im Kontext von Sport und Essstörung
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Dieses Vorwort führt in die Thematik ein und beleuchtet das Verhältnis zwischen Körperbild, Körperkultur und (Schönheits-)Idealen, was für das Verständnis der Essstörungen zentral ist.
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Forschungsgegenstand und die Forschungsfrage. Sie liefert einen Überblick über die Struktur der Arbeit und skizziert die methodischen Ansätze.
Teil I – Theorie zum Krankheitsbild: Dieser Teil bietet eine umfassende theoretische Grundlage. Es werden die Begriffe Essstörungen, Anorexia nervosa und Anorexia athletica definiert, die jeweiligen Symptombilder erläutert, und die Epidemiologie, Diagnostik und Ätiologie beleuchtet. Die Kapitel diskutieren soziokulturelle, psychosoziale, genetische und biologische Faktoren, die zur Entstehung dieser Erkrankungen beitragen können. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Risikofaktoren im Leistungssport gerichtet, mit detaillierten Analysen von Risikosportarten und den spezifischen Herausforderungen für Sportlerinnen. Die komplexe Beziehung zwischen Magersucht und Sportsucht wird ausführlich behandelt, inklusive einer Diskussion der Komorbidität psychischer Erkrankungen und der Debatte um die Einordnung von Magersucht und Sportsucht als verhaltensspezifische Suchterkrankungen.
Teil II - Biographienforschung: Dieser Teil präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Die Auswahl des narrativen Interviews als Forschungsmethode wird begründet. Die Durchführung und Auswertung der Interviews mit drei Probandinnen werden detailliert beschrieben. Es werden die individuellen Lebensgeschichten und Bewältigungsstrategien der Teilnehmerinnen dargestellt und analysiert. Die Auswertung der Interviews fokussiert die Lebensperspektive und Selbstverwirklichung, den Übergang von Anorexia athletica zu Anorexia nervosa und die Komorbidität zwischen Hungern und Sport. Eine Typenbildung wird vorgenommen, um gemeinsame Muster in den Biographien zu identifizieren. Diese Typen werden in einen philosophischen und anthropologischen Kontext eingeordnet, um die zugrundeliegenden Mechanismen besser zu verstehen. Die Untersuchung beleuchtet die Rolle von Identitätssuche und Selbstfindung, den Einfluss von Körperbild und Bedürfnissen nach Maslow sowie die Bedeutung von Selbstachtung im Zusammenhang mit den beschriebenen Essstörungen.
Schlüsselwörter
Anorexia nervosa, Anorexia athletica, Essstörungen, Leistungssport, Biographienforschung, narratives Interview, Identität, Körperbild, Selbstwirksamkeit, Verhaltenssucht, Komorbidität, Risikofaktoren, soziokulturelle Faktoren, psychosoziale Faktoren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Essstörungen und Leistungssport
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Anorexia nervosa und Anorexia athletica im Kontext von Leistungssport. Sie analysiert anhand biographischer Interviews individuelle Handlungsoptionen zur Lebensbewältigung Betroffener und zielt auf ein besseres Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen Essstörungen und Sport ab.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Differenzierung von Anorexia nervosa und Anorexia athletica, den Zusammenhang zwischen Leistungssport und Essstörungen, die Analyse individueller Bewältigungsstrategien, die Rolle soziokultureller und psychosozialer Faktoren sowie die biographische Identitätsfindung im Kontext von Sport und Essstörung.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet die Methode der Biographienforschung. Narrative Interviews mit drei Probandinnen bilden die Grundlage der empirischen Untersuchung. Die Auswertung fokussiert die Lebensperspektive, Selbstverwirklichung, den Übergang zwischen Anorexia athletica und Anorexia nervosa sowie die Komorbidität zwischen Hungern und Sport.
Welche theoretische Grundlage wird verwendet?
Teil I der Arbeit bietet eine umfassende theoretische Grundlage. Es werden Essstörungen, Anorexia nervosa und Anorexia athletica definiert, die Symptombilder erläutert und Epidemiologie, Diagnostik und Ätiologie beleuchtet. Soziokulturelle, psychosoziale, genetische und biologische Faktoren werden diskutiert, mit besonderem Fokus auf Risikofaktoren im Leistungssport und der Beziehung zwischen Magersucht und Sportsucht.
Wie werden die Ergebnisse der Biographienforschung präsentiert?
Teil II präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung detailliert. Die Durchführung und Auswertung der Interviews werden beschrieben, individuelle Lebensgeschichten und Bewältigungsstrategien dargestellt und analysiert. Eine Typenbildung wird vorgenommen, um gemeinsame Muster zu identifizieren und in einen philosophischen und anthropologischen Kontext einzuordnen. Die Rolle von Identitätssuche, Körperbild, Bedürfnissen nach Maslow und Selbstachtung werden beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Anorexia nervosa, Anorexia athletica, Essstörungen, Leistungssport, Biographienforschung, narratives Interview, Identität, Körperbild, Selbstwirksamkeit, Verhaltenssucht, Komorbidität, Risikofaktoren, soziokulturelle Faktoren, psychosoziale Faktoren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst ein Vorwort, eine Einleitung, einen theoretischen Teil (Teil I) zum Krankheitsbild, einen empirischen Teil (Teil II) mit Biographienforschung und eine Abschlussdiskussion mit Fazit und Ergebnissicherung. Der theoretische Teil beinhaltet Kapitel zu Begriffserläuterungen, Anorexia nervosa, Anorexia athletica, den Zusammenhängen zwischen Magersucht und Sport sowie Erkenntnisse aus Teil I. Der empirische Teil umfasst Kapitel zur Eingrenzung forschungsrelevanter Begriffe, zum narrativen Interview, zur Präsentation der empirischen Erhebung, zur Auswertung der Interviews und zur Einbettung der Hypothese in wissenschaftliche Literatur.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, anhand biographischer Interviews individuelle Handlungsoptionen zur Lebensbewältigung von Betroffenen zu analysieren und ein besseres Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zwischen Essstörungen und Sport zu entwickeln.
- Quote paper
- Sonja Langreder (Author), 2011, Anorexia Nervosa und Anorexia Athletica als individuelle Handlungsoptionen zur Lebensbewältigung? Versuch einer Erklärung aus der Sicht von Betroffenen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204732