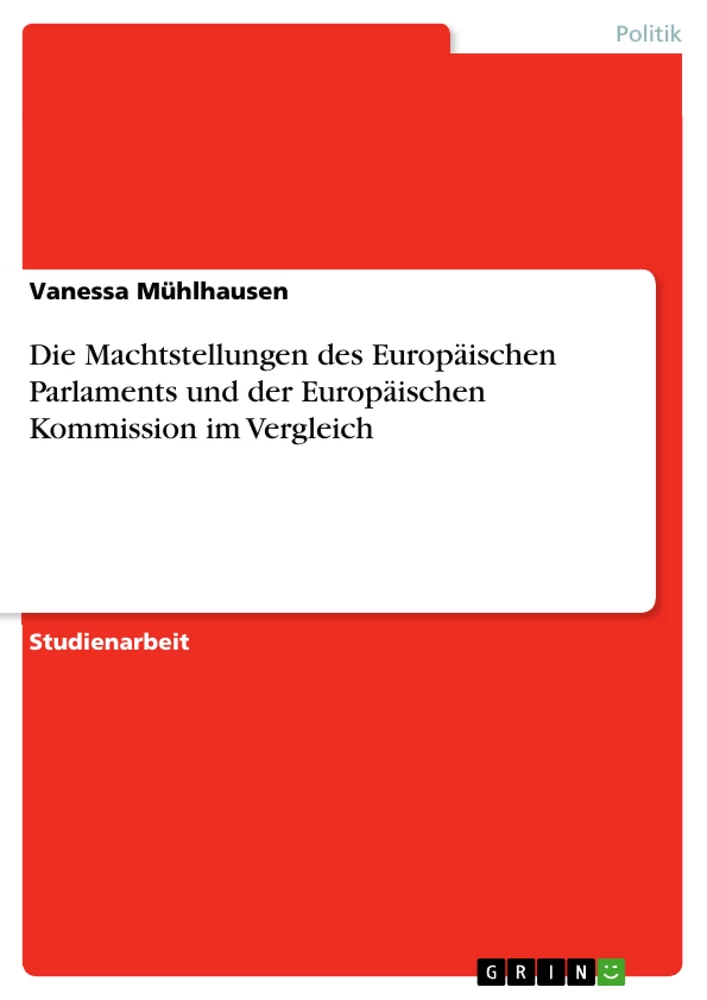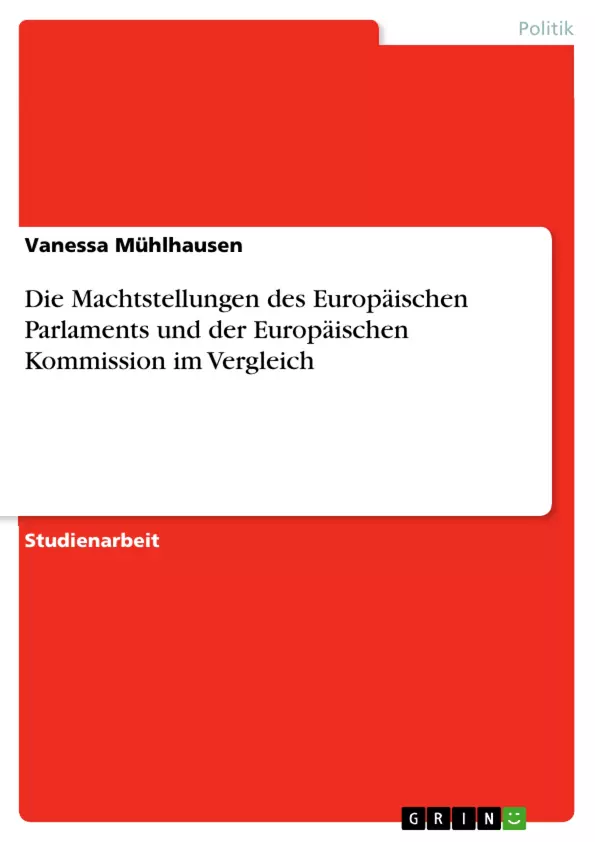Die Organe der EU verfügen alle über ihre eigenen Aufgaben. Dabei sind jedoch auch kontrollierende und übergreifende Tätigkeiten in Sachen der Unionsarbeit zu erkennen. Im gegenseitige Mitwirken und Kontrollieren unter den Institutionen besteht das System, was die EU funktionieren lässt. Doch neben Entscheidungen und Einigungen kommen ebenso Konflikte auf. Es geht um die Macht abzulehnen und erteilen, also im Großen und Ganzen „bestimmen“ zu können. Besonders zwischen Kommission und Parlament fallen diese Machtkonflikte auf. Insbesondere seit dem die Rechte und Pflichten des Parlaments stetig gewachsen sind. Dazu werde ich einige Beispiele der Vergangenheit präsentieren, die diese Machtkämpfe zwischen den beiden Organen deutlich machen. Deutlich dabei werden die Schwachstellen und auch Beeinflussungschancen der Kommission und ob die einzige Macht des Parlaments wirklich nur in ihrer Anhörung besteht.
Das Europäische Parlament ist inzwischen mehr als ein beratendes Organ, was es in den 50er Jahren war. Damals war es machtlos. Es konnte nichts „erzwingen“ und war wenig vergleichbar mit einem nationalen Parlament. Ein Parlament was nichts zu melden hat? Nutzlos und uninteressant! Vor allem in den Augen der EU- Bürger. Seit dem ersten gewählten Europäischen Parlament 1979 hatten die Parlamentarier mehr Spielraum gewonnen und eine bedeutende Entwicklung begann. Dennoch bleibt die Frage: Haben diese Schritte tatsächlich zu einem mächtigen Europäischen Parlament geführt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- EGKS- Vertrag und das Misstrauensvotum
- Vertrag zur Schaffung eines Systems von EG Eigenmittel und das Haushaltsverfahren
- Politische Kontrolle
- Untersuchungsausschüsse
- Bekämpftng von Korruption und die Skandale
- OLAF
- Rücktritt der Santer Kommission
- Die Eurostat- Affäre
- Die Einheitliche Europäische Akte
- Der Vertrag von Maastricht
- Das Mitentscheidungsverfahren
- Die Ernennung der Kommission
- Das Investiturverfahren
- Der Vertrag von Nizza
- Der Vertrag von Lissabon
- Probleme der Personalpolitik des Lissabon Vertrags
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Vergleich der Machtstellungen des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Kompetenzen des Europäischen Parlaments und zeigt auf, inwiefern diese zur Ausübung von Macht gegenüber der Kommission führen. Dabei werden wichtige EU- Verträge, insbesondere die Erweiterung und Veränderung der Kompetenzen des Europäischen Parlaments, untersucht. Die Arbeit beleuchtet die Rolle des Europäischen Parlaments bei der Kontrolle der Kommission und zeigt verschiedene Beispiele für Machtkämpfe zwischen den beiden Organen auf.
- Entwicklung der Kompetenzen des Europäischen Parlaments
- Machtverhältnis zwischen Europäischem Parlament und Europäischer Kommission
- Kontrolle des Europäischen Parlaments über die Europäische Kommission
- Beispiele für Machtkämpfe zwischen den beiden Organen
- Bedeutung von EU- Verträgen für die Machtbefugnisse des Europäischen Parlaments
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die zentrale Frage nach dem Machtverhältnis zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission. Es wird deutlich, dass das Europäische Parlament in den 50er Jahren ein machtloses Beratungsorgan war und erst seit 1979 durch die erste Wahl eines Europäischen Parlaments mehr Einfluss erlangte.
Das Kapitel über den EGKS- Vertrag zeigt auf, dass dem Europäischen Parlament bereits in den Anfängen der Europäischen Gemeinschaft eine Kontrollfunktion über die Kommission zugeschrieben wurde. Diese Kontrolle erfolgte durch das Misstrauensvotum, das eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erfordert. Dieses Verfahren stellt eine bedeutende Macht des Parlaments gegenüber der Kommission dar, da es diese zum Rücktritt zwingen kann oder zumindest zu einer engeren Zusammenarbeit mit dem Parlament drängt.
Das Kapitel über den Vertrag zur Schaffung eines Systems von EG Eigenmitteln beschreibt die Entwicklung des Europäischen Parlaments zur „Teil der Haushaltsbehörde". Das Parlament hat seit 1970 einen erheblichen Einfluss auf die Aufteilung der Mittel und kann den Haushalt der Kommission sogar komplett ablehnen. Dieses Verfahren stellt ein wichtiges Instrument der Macht des Parlaments dar, um die effiziente Verwendung der EU- Gelder zu gewährleisten.
Das Kapitel über die politische Kontrolle des Europäischen Parlaments über die Europäische Union zeigt auf, dass das Parlament nicht nur die Haushaltskontrolle, sondern auch eine allgemeine politische Kontrolle über die Tätigkeiten der EU ausüben kann. Diese Befugnis umfasst auch die Einrichtung von Untersuchungsausschüssen, die in der Vergangenheit bereits zur Aufklärung von Missständen und zur Durchsetzung von Veränderungen führten, wie zum Beispiel die Einrichtung einer Europäischen Veterinärbehörde in Dublin.
Das Kapitel über die Bekämpfung von Korruption und die Skandale beleuchtet die Rolle des Europäischen Parlaments bei der Bekämpfung von Korruption. Die Arbeit zeigt auf, dass die Korruptionsskandale der letzten Jahre das Vertrauen in die EU- Institutionen und die Mitgliedstaaten geschwächt haben. Der Rücktritt der Santer- Kommission im Jahr 1999 und die Eurostat- Affäre im Jahr 2003 sind zwei prominente Beispiele für Korruptionsskandale, die das Parlament zum Handeln zwangen. Die Arbeit zeigt auch die Rolle des Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) bei der Bekämpfung von Korruption auf.
Das Kapitel über die Einheitliche Europäische Akte beschreibt die Erweiterung der Kompetenzen des Europäischen Parlaments im Jahr 1986. Durch die Einführung des Verfahrens der Zusammenarbeit erhielt das Parlament ein aufschiebendes Veto und wurde stärker in die Gesetzgebungsprozesse eingebunden. Das Zustimmungsverfahren, das ebenfalls eingeführt wurde, stärkte die Rolle des Parlaments bei wichtigen Entscheidungen.
Das Kapitel über den Vertrag von Maastricht beschreibt die Einführung des Mitentscheidungsverfahrens, das dem Europäischen Parlament in einigen Bereichen der Gesetzgebung eine gleichwertige Stellung zum Ministerrat einräumt. Dieses Verfahren stärkte die Rolle des Parlaments bei der Gesetzgebung und führte zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Rat und Parlament.
Das Kapitel über die Ernennung der Kommission beschreibt die Entwicklung des Investiturverfahrens, das das Europäische Parlament in den Prozess der Ernennung der Kommission einbezieht. Das Parlament hat seit dem Vertrag von Maastricht das Recht, den designierten Kommissionspräsidenten und das gesamte Kommissionskollegium zu bestätigen oder abzulehnen. Diese Befugnis stellt ein wichtiges Instrument der Macht des Parlaments gegenüber der Kommission dar.
Das Kapitel über den Vertrag von Nizza beschreibt die neuen Regeln, die nach der Erweiterung der EU auf 25 Mitgliedstaaten im Jahr 2004 eingeführt wurden. Diese Regeln stärkten die Rolle des Parlaments bei der Ernennung des Kommissionspräsidenten und gaben ihm ein größeres Mitspracherecht bei der Aufgabenverteilung innerhalb der Kommission.
Das Kapitel über den Vertrag von Lissabon beschreibt die Stärkung des Europäischen Parlaments durch die Ausdehnung des Mitentscheidungsverfahrens und die Verleihung von mehr Kompetenzen in puncto Haushalt, Gesetzgebung und internationale Übereinkommen. Der Vertrag stärkte auch die Rechenschaftspflicht der Kommission gegenüber dem Parlament.
Das Kapitel über die Probleme der Personalpolitik des Lissabon- Vertrags zeigt auf, dass die Kompetenzen des Kommissionspräsidenten bei der Zusammenstellung der Kommission durch den Vertrag von Lissabon deutlich eingeschränkt wurden. Der Vertrag forderte auch eine stärkere Einbeziehung des Parlaments in die politischen Vorhaben der Kommission.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Europäische Parlament, die Europäische Kommission, die Machtverhältnisse zwischen den beiden Organen, die Kompetenzen des Europäischen Parlaments, die Kontrolle des Parlaments über die Kommission, die EU- Verträge, das Misstrauensvotum, das Haushaltsverfahren, die politische Kontrolle, die Korruption, das OLAF, die Eurostat- Affäre, das Mitentscheidungsverfahren, das Investiturverfahren, der Vertrag von Lissabon und die Personalpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Macht des Europäischen Parlaments entwickelt?
Von einem rein beratenden Organ in den 50er Jahren hat es sich durch EU-Verträge zu einem mächtigen Mitgesetzgeber mit Kontrollrechten entwickelt.
Was ist das Misstrauensvotum gegenüber der Kommission?
Das Parlament kann die gesamte Europäische Kommission mit einer Zweidrittelmehrheit zum Rücktritt zwingen, was ein starkes Kontrollinstrument darstellt.
Welchen Einfluss hat das Parlament auf den EU-Haushalt?
Das Parlament fungiert als Teil der Haushaltsbehörde und kann den gesamten Haushalt der Kommission ablehnen, wenn keine Einigung erzielt wird.
Was änderte der Vertrag von Lissabon für das Parlament?
Er dehnte das Mitentscheidungsverfahren auf fast alle Bereiche aus und stärkte die Rolle des Parlaments bei der Wahl des Kommissionspräsidenten.
Was war die Santer-Affäre 1999?
Aufgrund von Korruptionsvorwürfen und dem Druck des Parlaments trat die gesamte Santer-Kommission geschlossen zurück.
- Quote paper
- Vanessa Mühlhausen (Author), 2010, Die Machtstellungen des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204868