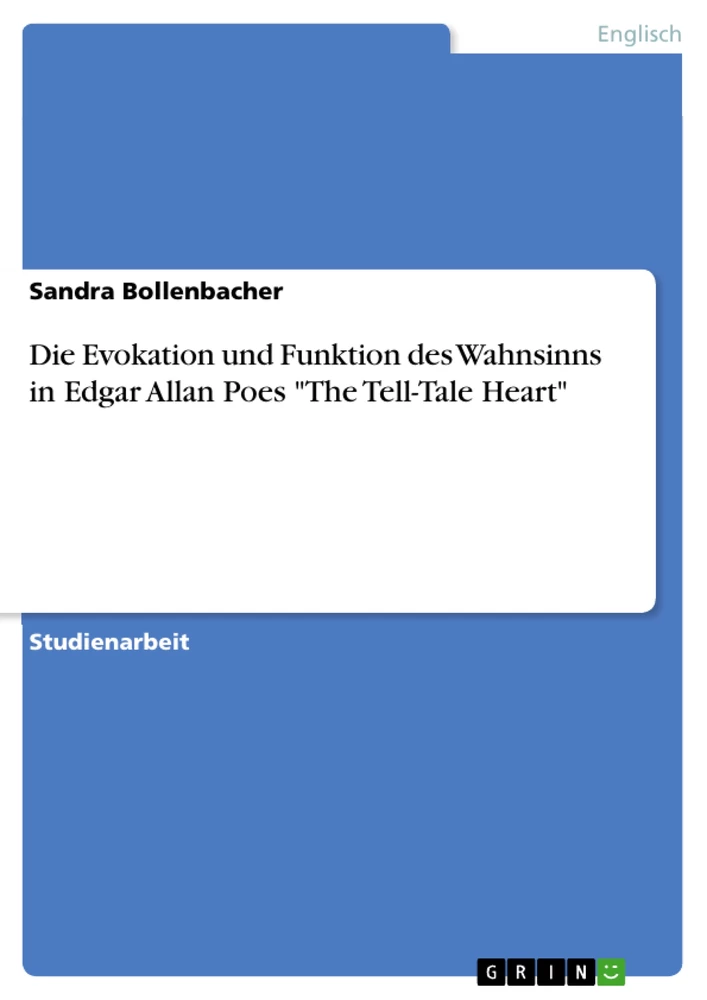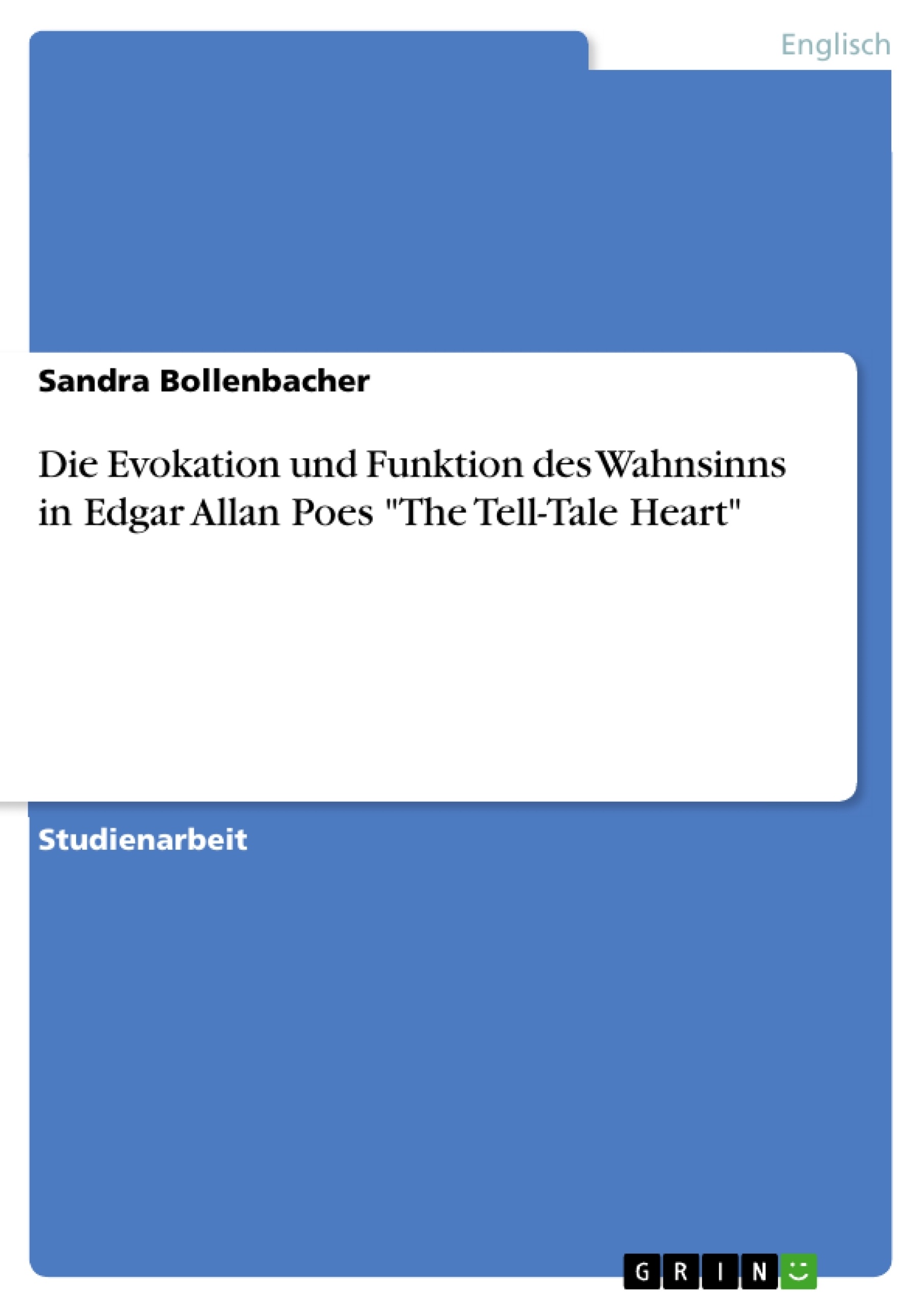“True! – nervous – very, very dreadfully nervous I had been and am; but why will you say that I am mad?” Mit diesen Worten lässt Edgar Allan Poe den Erzähler seiner berühmten short story „The Tell-Tale Heart” beginnen und fokussiert den Leser dadurch von Anfang an auf das Hauptthema dieser Geschichte: den Geisteszustand des Erzählers – oder besser gesagt: seine Geistesgestörtheit. Obwohl der Erzähler bis zum Ende durchweg versucht, den Leser davon zu überzeugen, dass er nicht verrückt ist, indem er aufzeigt, wie ruhig, wohl bedacht und logisch er vorgeht („You should have seen how wisely I proceeded – with what caution – with what foresight – with what dissimulation I went to work!“ „And have I not told you that what you mistake for madness is but over-acuteness of the senses?“ „If still you think me mad, you will think so no longer when I describe the wise precautions I took fort he concealment of the body.“ ), erreicht er damit nur das Gegenteil. Aber nicht nur durch seine Äußerungen, auch durch die Art, wie er erzählt, agiert und auf bestimme Dinge reagiert, überzeugt der Erzähler den Leser ungewollt nach und nach davon, dass er doch wahnsinnig, verrückt ist. Die zwei Hauptindizien hierfür sind der Konflikt zwischen der realen Welt und der Fantasiewelt des Erzählers und sein Verhalten bezüglich des für ihn so bedeutsamen blaublassen Auges des alten Mannes.
Nachdem festgestellt wurde, dass der Erzähler wahnsinnig ist, stellt sich die Frage, welche Funktionen seine Verrücktheit bezüglich der Geschichte erfüllt. Die Differenzierung zwischen der Fantasie des Erzählers und der Realität ist hier besonders wichtig, sowie der Aufbau von Spannung und letztendlich die Erzeugung von Horror – aufgrund dessen „The Tell-Tale Heart“ heute zu den Klassikern der Horrorliteratur zählt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Evokation des Wahnsinns – Ist der Erzähler verrückt?
2.1. Der Konflikt zwischen der Realität des Erzählers und der Wirklichkeit
2.2. Die Rhetorik des Erzählers
2.3. Das blassblaue Auge
2.3.1. Das Auge als Trigger
2.3.2. Die Identifikation des Erzählers mit dem Auge
3. Die Funktion des Wahnsinns
3.1. Die Unterscheidung von Fantasie und Realität
3.2. Der Aufbau von Spannung
3.2.1. Die Rhetorik
3.2.2. Die Zeit
3.3. Der Horroreffekt
4. Schluss
5. Bibliografie
Häufig gestellte Fragen
Ist der Erzähler in "The Tell-Tale Heart" wirklich wahnsinnig?
Obwohl der Erzähler versucht, den Leser von seiner Vernunft zu überzeugen, belegen seine Handlungen und seine extreme Sinnesschärfe (Over-acuteness) seine Geistesgestörtheit.
Welche Rolle spielt das "blaublasse Auge" in der Geschichte?
Das Auge des alten Mannes fungiert als Trigger für den Wahnsinn des Erzählers und führt letztlich zu seinem mörderischen Entschluss.
Wie erzeugt Poe Spannung in dieser Kurzgeschichte?
Spannung wird durch die Rhetorik des Erzählers, die Verzögerung der Handlung und die detaillierte Beschreibung der nächtlichen Vorbereitungen aufgebaut.
Was ist die Funktion des Wahnsinns für die literarische Wirkung?
Der Wahnsinn dient dazu, die Grenze zwischen Realität und Fantasie zu verwischen und den für Poe typischen Horroreffekt zu erzielen.
Wie versucht der Erzähler seine "Vernunft" zu beweisen?
Er verweist auf seine vorsichtige Planung, seine logische Vorgehensweise bei der Beseitigung der Leiche und seine Ruhe während des Polizeiverhörs.
Welchen Konflikt thematisiert Poe zwischen Fantasie und Wirklichkeit?
Der Text zeigt, wie die subjektive Wahrnehmung des Wahnsinnigen (z.B. das schlagende Herz) die objektive Realität überlagert und ihn zum Geständnis zwingt.
- Quote paper
- Sandra Bollenbacher (Author), 2007, Die Evokation und Funktion des Wahnsinns in Edgar Allan Poes "The Tell-Tale Heart", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204948