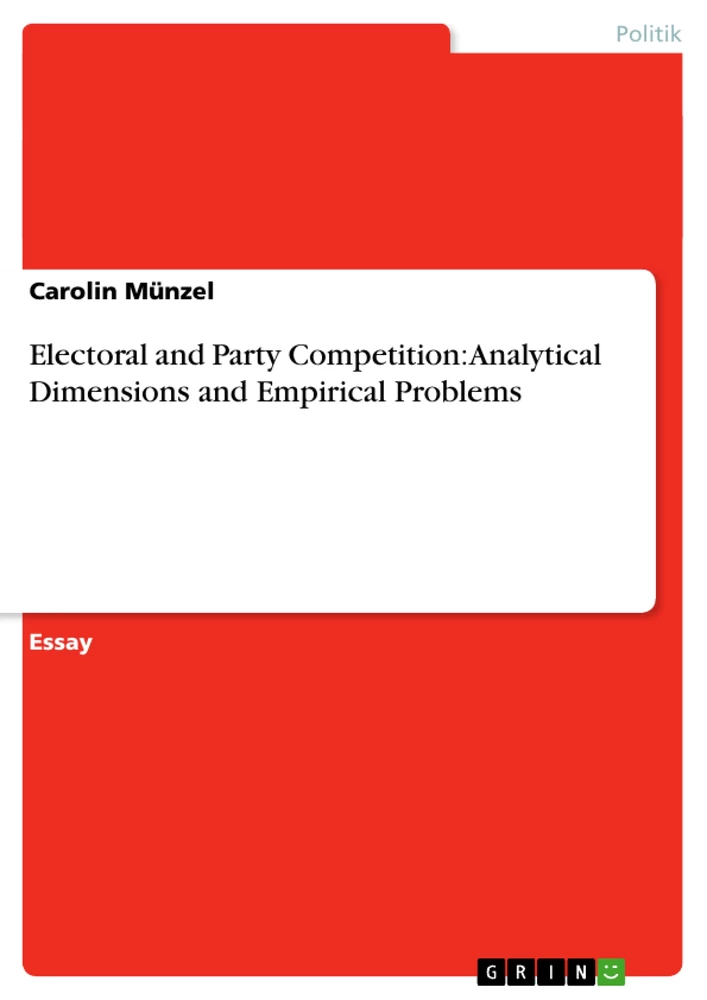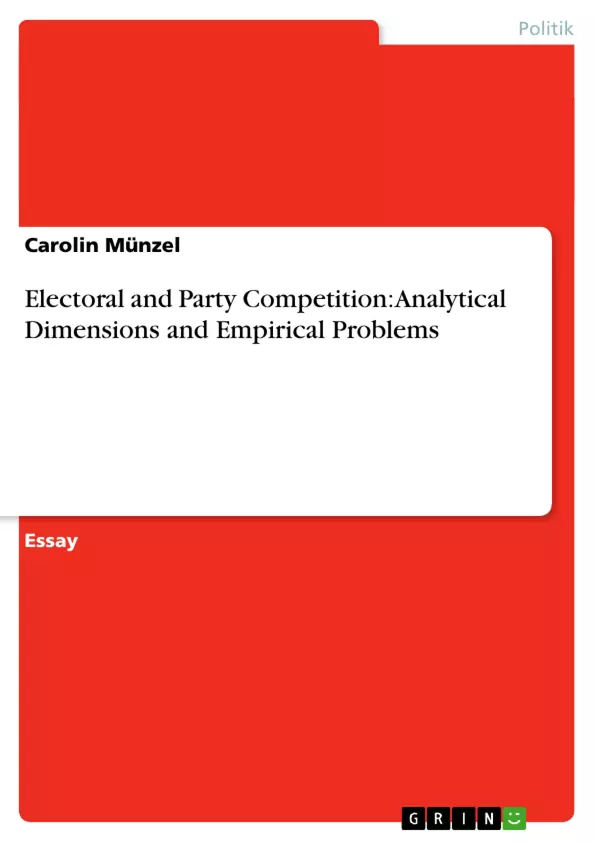Stefano Bartolinis Aufsatz „Electoral and Party Competition: Analytical Dimensions and Empirical Problems“ wurde in dem Buch „Political Parties – Old Concepts and New Challenges“ veröffentlicht, das 2002 erschien. Die Herausgeber des Buches, Richard Gunther, José Ramón und Juan J. Linz, wollen einen kritischen Überblick über die Vielzahl an Literatur geben, die inzwischen zum Thema politische Parteien publiziert wurde. Es werden sowohl die Konzepte der Parteien und des Parteienwettbewerbes, die Parteienorganisation und Parteien-Modelle als auch die Bürgereinstellung gegenüber Parteien neu untersucht. In seinem Beitrag analysiert Stefano Bartolini den Begriff „Wettbewerb”. Bereits in der Einleitung weist er darauf hin, dass der Ausdruck so vielfältig und in so unterschiedlichen Zusammenhängen gebraucht wird, dass seine genaue Bedeutung nicht klar abgegrenzt ist und somit sehr wage erscheint. Das fundamentale Problem sieht der Autor darin, dass für die politische, zu viel aus der ökonomischen Wettbewerbstheorie entlehnt wird: „For several reasons, this borrowing is excessive if not unwaranted.“1 Dabei neigen die Politikwissenschaftler dazu, Wettbewerb als eindimensionales Phänomen zu sehen, das – je nach politischen System – mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt sein kann. Die stärkst mögliche Ausprägung wird dabei mit perfektem Wettbewerb assoziiert. Bartolini widerspricht dieser Vorgehensweise vehement. Er argumentiert, dass die Bedingungen für Wettbewerb in der Politik sehr vielfältig sind. Im Laufe seines Textes arbeitet er vier Dimensionen heraus, die für das Entstehen des Wettbewerbes unabdingbar sind und belegt somit schließlich die Multidimensionalität des Phänomens. [...]
Einleitung
Stefano Bartolinis Aufsatz „Electoral and Party Competition: Analytical Dimensions and Empirical Problems“ wurde in dem Buch „Political Parties – Old Concepts and New Challenges“ veröffentlicht, das 2002 erschien. Die Herausgeber des Buches, Richard Gunther, José Ramón und Juan J. Linz, wollen einen kritischen Überblick über die Vielzahl an Literatur geben, die inzwischen zum Thema politische Parteien publiziert wurde. Es werden sowohl die Konzepte der Parteien und des Parteienwettbewerbes, die Parteienorganisation und Parteien-Modelle als auch die Bürgereinstellung gegenüber Parteien neu untersucht. In seinem Beitrag analysiert Stefano Bartolini den Begriff „Wettbewerb”. Bereits in der Einleitung weist er darauf hin, dass der Ausdruck so vielfältig und in so unterschiedlichen Zusammenhängen gebraucht wird, dass seine genaue Bedeutung nicht klar abgegrenzt ist und somit sehr wage erscheint. Das fundamentale Problem sieht der Autor darin, dass für die politische, zu viel aus der ökonomischen Wettbewerbstheorie entlehnt wird: „For several reasons, this borrowing is excessive if not unwaranted.“[1] Dabei neigen die Politikwissenschaftler dazu, Wettbewerb als eindimensionales Phänomen zu sehen, das – je nach politischen System – mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt sein kann. Die stärkst mögliche Ausprägung wird dabei mit perfektem Wettbewerb assoziiert. Bartolini widerspricht dieser Vorgehensweise vehement. Er argumentiert, dass die Bedingungen für Wettbewerb in der Politik sehr vielfältig sind. Im Laufe seines Textes arbeitet er vier Dimensionen heraus, die für das Entstehen des Wettbewerbes unabdingbar sind und belegt somit schließlich die Multidimensionalität des Phänomens.
Simmel, Schumpeter, Downs
Zunächst aber stellt er die theoretischen Ansätze von George Simmel, Joseph A. Schumpeter und Anthony Downs kurz dar und verweist auf ihre unterschiedlichen Sichtweisen. George Simmel hat den soziologischen Mechanismus analysiert, der zur Umwandlung des individuellen Impulses in sozial wertvolle Resultate führt. Im reinen Wettbewerb weis keiner der Akteure, was am Ende „herauskommen“ wird. Nach Simmel konzentriert sich jeder nur auf seine eigenen Belange und Ziele und verhält sich so, als ob es keine Gegenspieler gebe. Demnach setzt Wettbewerb voraus, dass es ein gemeinsames Ziel gibt, nach dem alle Parteien, die am Wettbewerb teilnehmen, streben. Wettbewerb legitimiert sich also dadurch, dass bei den Wettkämpfen zwischen den Teilnehmern, von diesen unbeabsichtigt – quasi als Beiprodukt – soziale Werte entstehen, die anderen dienlich sind. Unter diesem Blickwinkel betrachtet, ist der individuelle Wettbewerb also nichts anderes, als eine von vielen „Techniken“, die versuchen kollektive Ziele oder soziale Werte zu erreichen. Manche gehen sogar so weit zu behaupten, dass Wettbewerb als Beiprodukt Demokratie erzeugt. Bartolini widerspricht diesem Argument – wie ich finde zu recht – vehement. Er erklärt seine Ausführungen damit, dass Wettbewerb überhaupt erst entstehen kann, wenn bereits Normen und Regeln existieren, die zumindest einen minimal regulierenden Rahmen bilden. Ohne diesen, so Bartolini, könnte Wettbewerb schnell umschlagen in einen unregulierten Konflikt. Ich halte diese Argumentation für sehr schlüssig. Nicht zuletzt deshalb, weil in allen Bereich, in denen Wettbewerb statt findet, zu beobachten ist, dass die Teilnehmer zur Erreichung ihrer Ziele alle möglichen Mittel ausschöpfen, um sich gegenüber den Konkurrenten Vorteile zu verschaffen. Das führt so weit, dass sie sich zum Teil am Rande der Legalität bewegen. Würde es keine Regeln und Normen geben, wäre meiner Meinung nach ein geregelter, fairer Wettbewerb nicht möglich.
[...]
[1] Siehe Stefano Bartolini, 2002: Electoral and Party Competition: Analytical Dimensions and Empirical Problems, in: Gunther, Richard / Ramón-Montero, José / Linz, Juan J. (Hrsg.): Political Parties – Old Concepts and New Challenges. Oxford.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptargument von Stefano Bartolini zum Parteienwettbewerb?
Bartolini argumentiert, dass politischer Wettbewerb kein eindimensionales Phänomen ist, das man einfach aus der Ökonomie übernehmen kann, sondern ein komplexes, multidimensionales Konstrukt.
Warum kritisiert Bartolini die Übernahme ökonomischer Wettbewerbstheorien?
Er hält die Übernahme für exzessiv, da die Bedingungen im politischen Raum (z.B. fehlender Preismechanismus, andere Motivationsstrukturen) sich grundlegend vom Markt unterscheiden.
Welche Rolle spielt Georg Simmel in der Arbeit?
Simmel wird herangezogen, um den soziologischen Mechanismus des Wettbewerbs zu erklären, bei dem individuelle Impulse in sozial wertvolle Resultate umgewandelt werden.
Erzeugt Wettbewerb automatisch Demokratie?
Bartolini widerspricht der Ansicht, dass Wettbewerb Demokratie erzeugt; vielmehr benötigt Wettbewerb bereits existierende Regeln und Normen, um nicht in einen unregulierten Konflikt umzuschlagen.
Welche Theoretiker werden neben Bartolini diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet die Ansätze von George Simmel, Joseph A. Schumpeter und Anthony Downs im Vergleich zu Bartolinis Thesen.
Was sind die „vier Dimensionen“ des Wettbewerbs nach Bartolini?
Bartolini arbeitet vier Dimensionen heraus, die für das Entstehen und Funktionieren von politischem Wettbewerb unabdingbar sind und dessen Multidimensionalität belegen.
- Quote paper
- Carolin Münzel (Author), 2008, Electoral and Party Competition: Analytical Dimensions and Empirical Problems, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205069