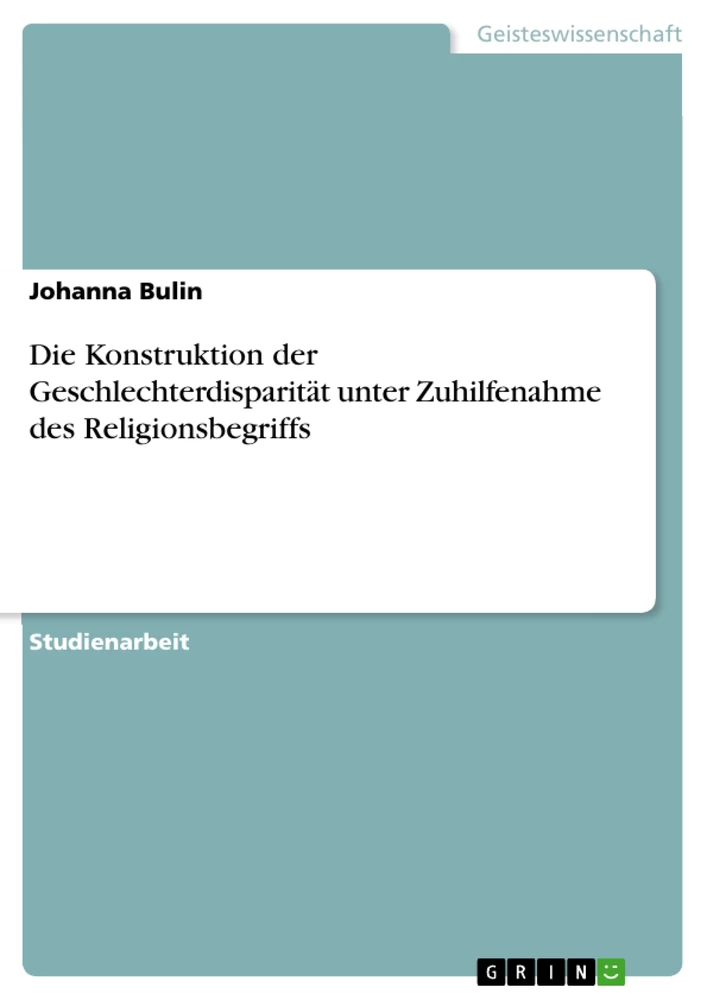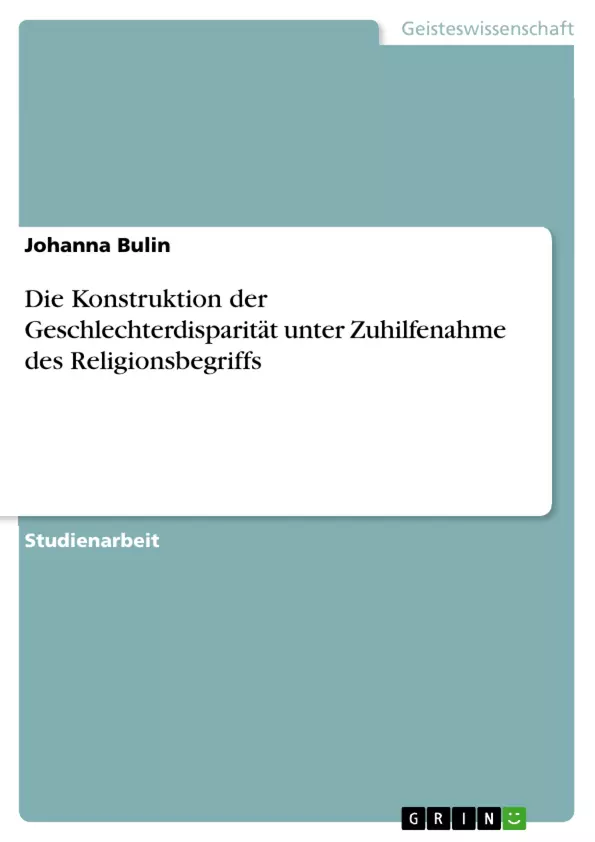Naturwissenschaften haben den Ruf, objektiv und neutral zu sein. Dass ihnen dieses Image nicht ganz zu Recht gebührt, möchte ich anhand dieser Arbeit nachweisen. Gesellschaftliche und soziale Verflechtungen sind beim Naturwissenschaftsbetreiben genauso anzutreffen, wie man es beispielsweise auch in den Kulturwissenschaften erwartet. Aufgrund dessen möchte ich den Text „Sexuelle Selektion und Religion“ des Evolutionspsychologen Harald Euler, den wir im Seminar gelesen haben, behandeln.
Inhalt
1. Einleitung
2. Methodische Einordnung Eulers
3. Euler: Auf der Suche nach dem Nutzen von Religion
3.1. Sexuelle Selektion vs. Natürliche Selektion
3.2. Eulers Religionsbegriff
3.3. Geschlechterrollen in Bezug auf Religion
4. Konsequenzen von und Kritik an Eulers Ansatz
5. Diskursebene – wer hat das Wort?
Literatur
Häufig gestellte Fragen
Sind Naturwissenschaften laut der Arbeit wirklich objektiv?
Die Arbeit stellt den Ruf der Naturwissenschaften als rein objektiv und neutral infrage und weist darauf hin, dass gesellschaftliche und soziale Verflechtungen auch hier eine wesentliche Rolle spielen.
Wer ist Harald Euler und welches Werk wird analysiert?
Harald Euler ist ein Evolutionspsychologe. Die Arbeit befasst sich kritisch mit seinem Text „Sexuelle Selektion und Religion“.
Was ist der Unterschied zwischen sexueller und natürlicher Selektion bei Euler?
Das Werk untersucht, wie diese beiden Selektionsmechanismen zur Entstehung und zum Nutzen von Religion beitragen und welche evolutionären Vorteile daraus entstehen.
Wie hängen Geschlechterrollen und Religion in diesem Kontext zusammen?
Euler untersucht die Konstruktion von Geschlechterdisparitäten und wie der Religionsbegriff genutzt wird, um unterschiedliche Rollen von Mann und Frau zu begründen.
Welche methodische Einordnung wird für Eulers Ansatz vorgenommen?
Die Arbeit ordnet Euler methodisch ein und analysiert die Konsequenzen sowie die Kritik an seinem evolutionspsychologischen Erklärungsmodell für Religion.
- Citar trabajo
- Johanna Bulin (Autor), 2010, Die Konstruktion der Geschlechterdisparität unter Zuhilfenahme des Religionsbegriffs, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205070