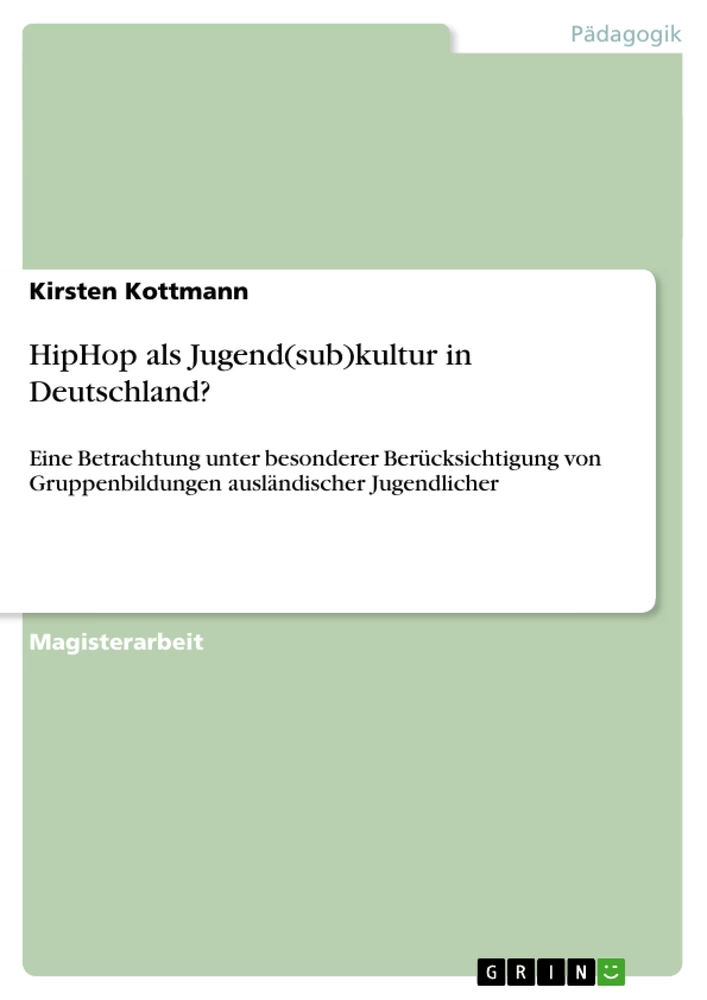Auf deutschen Straßen und anderen jugendkulturellen Schauplätzen urbaner Ballungsräume von Großstädten wie Berlin entdeckt man mit einer sozialphänomenologisch- alltagsweltlichen Neugierde einen sich anscheinend durchsetzenden jugendkulturellen Stil. XXL- Hosen, offene Turnschuhe, Baseballhemden und Goldketten tragend treffen sich vorwiegend männliche Jugendliche an Straßenecken, deren z.T. bedrohlich wirkendes Auftreten Assoziationen mit medialen Berichten über amerikanische Großstadtghettos erweckt. Ebenso gehört mittlerweile Graffiti zum normalen Stadtbild in Deutschland.
HipHop wird als die große „Asphaltkultur“ Jugendlicher tituliert (Henkel, 1996), die im letzten Jahrzehnt ihren kommerziellen Durchbruch in Deutschland hatte. Seitdem gibt es, wie selbstverständlich, HipHop- Sendungen auf den großen Musiksendern (z.B. „Mixery Raw Deluxe“, VIVA), die über diese Kultur berichten und ihre Spielregeln Interessierten erklären. Ebenso groß scheint in Jugendzentren die Nachfrage und das Angebot an Rap- oder Breakdance- Kursen zu sein. Hört man einigen der Texten von Rappern aufmerksam zu, so scheint es, als sei hier ein gesellschaftserneuerndes Potential und ein Moment von Widerstand vorhanden. Auffallend ist, dass sich insbesondere Jugendliche für HipHop interessieren, die der sogenannten zweiten oder dritten Migrantengeneration in Deutschland zugehören. Doch trotz seiner uns alltäglich begegnenden Präsenz, scheint hinsichtlich dieser jugendkulturellen Erscheinung ein großer Erklärungsbedarf zu bestehen. HipHop ist eine Kultur, um die sich zahlreiche Legenden ranken und deren Stil oftmals parodiert wird. Für Außenstehende ist HipHop sehr schwer nachvollziehbar. Ich habe mir die Aufgabe gestellt, das Mysterium der HipHop-Jugendkultur zu lüften und es seiner Stigmatisierung zumindest im Rahmen meiner Arbeit zu entledigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Jugend und Kultur- Erklärungsansätze
- 2.1 Der Begriff der Subkultur
- 2.2 Jugendsoziologische Betrachtungen
- 2.3 Die Subkulturforschung des „,Centre for Contemporary Cultural Studies“
- 2.4 Die Subkulturdiskussion
- 2.5 Die Verabschiedung des Subkulturbegriffs: Jugendkulturen und Lebensstile
- 2.6 Fazit
- 3 Was ist HipHop?
- 3.1 Die sozioökonomischen Entstehungsbedingungen von HipHop
- 3.2 Die Entwicklungsgeschichte von HipHop
- 3.2.1 Die Anfangsphase des HipHop- Die Old School bis 1983
- 3.2.2 Die Phase der Politisierung des HipHop- Die New School von 1983 bis 1985
- 3.2.2.1 Schwarzer Nationalismus und HipHop
- 3.2.2.2 Gangster- Rap
- 3.3 Kulturtechniken im HipHop
- 3.3.1 Rap
- 3.3.2 Breakdance
- 3.3.3 Graffiti
- 3.4 Fazit
- 4 Der Zusammenhang von HipHop- Kultur und Jugendgangs
- 4.1 Vorüberlegungen: Parallelen in der Entwicklungsgeschichte von Crews und Gangs
- 4.2 Begriffsbestimmung und Spezifika: Jugendgangs
- 4.3 Ein Erklärungsansatz: Das sozialökologisches Modell der „Chicago School“
- 4.4 Entstehungshintergründe von Gangbildungen in Deutschland
- 4.5 Ethnische Gangs in Deutschland
- 4.6 Exkurs: Mädchen und Gangs
- 4.7 Ein Vergleich: Gang und Jugendkultur
- 4.8 Die Gruppenstruktur im HipHop
- 4.9 Fazit
- 5 Der subkulturelle Stil im HipHop am Beispiel von Kleidung und Sprache
- 5.1 HipHop- Kleidung
- 5.1.1 Der Stilbildungsprozess am Beispiel der HipHop- Kleidung
- 5.1.2 Zur internen Bedeutung von Stil
- 5.2 Versteckte Widerständigkeit- Signifying Rapper
- 5.2.1 Das Signifyin(g)- Konzept
- 5.2.2 Subversive Botschaften im Rap
- 5.2.3 Kritik
- 5.3 Fazit
- 5.1 HipHop- Kleidung
- 6 Exkurs: Geschlecht und HipHop
- 6.1 Frauen und Jugendkultur
- 6.2 Zur Problemstellung: die Geschlechterbeziehung in den Black Communities
- 6.3 Rap als Dialog: Frauenrap- Männerrap
- 6.4 Das Frauenbild im HipHop
- 6.5 Das Männerbild im HipHop
- 6.5.1 Der Sexismusvorwurf
- 6.5.2 Homophobie und HipHop
- 6.5.3 Ein Beispiel für inszenierte Männlichkeit in einer Jungengang
- 6.5.3.1 Gruppenkonstitution und Männlichkeit
- 6.5.3.2 „Männliche“ Beleidigungsrituale
- 6.6 Fazit
- 7 Strukturelle Benachteiligungen „ausländischer“ Jugendlicher in Deutschland
- 7.1 Lebensentwürfe von Jugendlichen in Deutschland
- 7.1.1 Forschungstendenzen: Identitätskrise und Kulturkonflikt
- 7.1.2 Rechtsstatus
- 7.1.3 Schulausbildung und berufliche Zukunftspläne
- 7.1.4 Freizeitaktivitäten
- 7.1.5 Häusliche Lebenswelt und Elternbeziehung
- 7.1.6 Private Lebensplanung- Eheschließung und Familiengründung
- 7.1.7 Ausländerfeindlichkeit
- 7.1.8 Fazit
- 7.2 Gruppenbildungen „ausländischer“ Jugendlicher in Deutschland
- 7.2.1 HipHop als Forum
- 7.2.2 Die Bedeutung nationaler Symbolik
- 7.2.3 Der eigene Sprechstil: “Kanak Sprak”
- 7.2.4 Fazit
- 7.1 Lebensentwürfe von Jugendlichen in Deutschland
- 8 HipHop-Jugend in Deutschland
- 8.1 Die ersten jugendlichen HipHop- Aktivisten in Deutschland
- 8.2 Ausverkauf einer Jugendkultur
- 8.3 Die ethnische Segmentierung des HipHop
- 8.4 Faszination „Ghetto“- Die Gefahr der Ästhetisierung
- 8.5 Fazit
- 9 Empirische Untersuchungen
- 9.1 Identitätskonstruktion im HipHop
- 9.1.1 Untersuchung
- 9.1.2 Theoretische Vorüberlegungen
- 9.1.3 Der Kulturbegriff im HipHop
- 9.1.4 Individuelle Identitätskonstruktion- Das Konzept „style“
- 9.1.5 Gruppenidentität
- 9.1.5.1 Das Konzept „realness“
- 9.1.5.2 Kommerzialisierung- HipHop und „Sell Out“
- 9.1.6 Repräsentationsstrategien im HipHop- „represent“
- 9.1.7 Zusammenfassung
- 9.2 Deutsch- türkische HipHop- Jugend
- 9.2.1 Untersuchung
- 9.2.2 Theoretische Vorüberlegungen
- 9.2.3 Die Elterngeneration- Migranten- und Minderheitenstrategie
- 9.2.4 Lebenswelten der deutsch- türkischen HipHop- Jugend
- 9.2.5 Kreuzberg- „diasporic space“
- 9.2.6 Kultureller Nationalismus
- 9.2.7 Freizeitkultur- partikulare und universale Konstituenten
- 9.2.8 Deutsch- türkische Jugendliche der Mittelklasse
- 9.2.9 Beispiele deutsch- türkischer Rapformationen
- 9.2.9.1 Kultureller Nationalismus- Rap
- 9.2.9.2 Universalistischer politischer Rap
- 9.2.9.3 „Türkischer“ Gangster- Rap
- 9.2.9.4 „Türkischer“ Frauenrap
- 9.2.10 Zusammenfassung
- 9.3 Abschließende Betrachtung
- 9.1 Identitätskonstruktion im HipHop
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht HipHop als Jugend(sub)kultur in Deutschland, insbesondere unter Berücksichtigung von Gruppenbildungen ausländischer Jugendlicher. Ziel ist es, die soziokulturellen Bedingungen und Auswirkungen von HipHop auf die Identitätsbildung junger Menschen zu analysieren.
- HipHop als Subkultur und seine Entwicklung
- Der Zusammenhang zwischen HipHop und Jugendgangs
- Der Einfluss von Geschlecht und Ethnizität auf HipHop
- Identitätskonstruktion und Repräsentation im HipHop
- Strukturelle Benachteiligungen ausländischer Jugendlicher und HipHop als Reaktionsraum
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Magisterarbeit ein und umreißt die Forschungsfrage nach der Bedeutung von HipHop als Jugend(sub)kultur in Deutschland, insbesondere für ausländische Jugendliche. Sie benennt die methodischen Ansätze und die Struktur der Arbeit.
2 Jugend und Kultur- Erklärungsansätze: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene soziologische Ansätze zum Verständnis von Jugendkultur und dem Begriff der Subkultur. Es diskutiert die Entwicklung des Subkulturbegriffs, die Subkulturforschung des Centre for Contemporary Cultural Studies und die Verschiebung hin zum Konzept von Jugendkulturen und Lebensstilen. Es legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse von HipHop als Jugendkultur dar.
3 Was ist HipHop?: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über die Entstehung, Entwicklung und die kulturellen Elemente des HipHop. Es analysiert die sozioökonomischen Entstehungsbedingungen in den USA, die Phasen der Old School und New School mit ihren jeweiligen politischen und sozialen Kontexten (z.B. Schwarzer Nationalismus, Gangster-Rap), und die drei Kern-Kulturtechniken: Rap, Breakdance und Graffiti. Das Kapitel etabliert ein tiefes Verständnis der HipHop-Kultur an sich.
4 Der Zusammenhang von HipHop- Kultur und Jugendgangs: Dieses Kapitel untersucht die Parallelen zwischen der Entwicklungsgeschichte von HipHop-Crews und Jugendgangs. Es definiert Jugendgangs, analysiert Entstehungshintergründe von Gangbildungen in Deutschland, den Einfluss ethnischer Zugehörigkeit und den Unterschied zwischen Gangs und Jugendkulturen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Gruppenstruktur innerhalb des HipHop-Kontextes und ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu Gangstrukturen.
5 Der subkulturelle Stil im HipHop am Beispiel von Kleidung und Sprache: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den subkulturellen Stil von HipHop, insbesondere Kleidung und Sprache. Es untersucht den Stilbildungsprozess der HipHop-Kleidung, deren interne Bedeutung und den Einsatz von „Signifyin(g)“ im Rap als eine Form des verdeckten Widerstands gegen gesellschaftliche Normen. Die kritische Auseinandersetzung mit der Interpretation dieser Botschaften bildet einen zentralen Aspekt.
6 Exkurs: Geschlecht und HipHop: Dieses Kapitel analysiert die Rolle von Geschlecht im HipHop. Es befasst sich mit den unterschiedlichen Repräsentationen von Frauen und Männern im Rap, den damit verbundenen Debatten um Sexismus und Homophobie und untersucht ein Beispiel für inszenierte Männlichkeit in einer Jungengang, um die Konstruktion von Geschlecht und Gruppenidentität zu veranschaulichen.
7 Strukturelle Benachteiligungen „ausländischer“ Jugendlicher in Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet die strukturellen Benachteiligungen ausländischer Jugendlicher in Deutschland. Es analysiert verschiedene Aspekte ihrer Lebensentwürfe (z.B. Rechtsstatus, Bildung, Freizeit, Familie), Ausländerfeindlichkeit und die Rolle von HipHop als Reaktions- und Identitätsraum. Ein Schwerpunkt liegt auf Gruppenbildungen ausländischer Jugendlicher und dem Gebrauch nationaler Symbolik und spezifischer Sprechweisen.
8 HipHop-Jugend in Deutschland: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Entwicklung der HipHop-Jugend in Deutschland, den „Ausverkauf“ der Jugendkultur und die ethnische Segmentierung des HipHop. Es thematisiert die Faszination des „Ghettos“ und die Gefahr seiner Ästhetisierung.
Schlüsselwörter
HipHop, Jugendkultur, Subkultur, Jugendgangs, Identitätsbildung, Ethnizität, Geschlecht, Deutschland, sozioökonomische Bedingungen, Repräsentation, Kommerzialisierung, Ausländische Jugendliche, strukturelle Benachteiligung, „Kanak Sprak“, Schwarzer Nationalismus, Gangster-Rap.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: HipHop als Jugend(sub)kultur in Deutschland
Was ist der Gegenstand der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht HipHop als Jugend(sub)kultur in Deutschland, mit besonderem Fokus auf Gruppenbildungen ausländischer Jugendlicher. Analysiert werden die soziokulturellen Bedingungen und Auswirkungen von HipHop auf die Identitätsbildung junger Menschen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: HipHop als Subkultur und seine Entwicklung, den Zusammenhang zwischen HipHop und Jugendgangs, den Einfluss von Geschlecht und Ethnizität auf HipHop, Identitätskonstruktion und Repräsentation im HipHop sowie strukturelle Benachteiligungen ausländischer Jugendlicher und HipHop als Reaktionsraum.
Welche soziologischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene soziologische Ansätze zum Verständnis von Jugendkultur und dem Begriff der Subkultur, darunter die Subkulturforschung des Centre for Contemporary Cultural Studies und die Entwicklung des Subkulturbegriffs hin zu Jugendkulturen und Lebensstilen. Das sozialökologische Modell der „Chicago School“ wird im Kontext von Jugendgangs angewendet.
Wie wird HipHop in der Arbeit beschrieben?
Die Arbeit beschreibt HipHop umfassend, von seinen sozioökonomischen Entstehungsbedingungen in den USA über seine Entwicklungsgeschichte (Old School und New School, inklusive des Einflusses von Schwarzem Nationalismus und Gangster-Rap) bis hin zu seinen Kern-Kulturtechniken (Rap, Breakdance, Graffiti).
Welchen Zusammenhang stellt die Arbeit zwischen HipHop und Jugendgangs her?
Die Arbeit untersucht Parallelen in der Entwicklungsgeschichte von HipHop-Crews und Jugendgangs, definiert Jugendgangs, analysiert Entstehungshintergründe von Gangbildungen in Deutschland und den Einfluss ethnischer Zugehörigkeit. Verglichen werden die Gruppenstrukturen im HipHop-Kontext mit Gangstrukturen.
Wie wird der subkulturelle Stil im HipHop dargestellt?
Der subkulturelle Stil wird anhand von Kleidung und Sprache analysiert. Der Stilbildungsprozess der HipHop-Kleidung und deren interne Bedeutung werden untersucht, ebenso der Einsatz von „Signifyin(g)“ im Rap als verdeckter Widerstand.
Welche Rolle spielen Geschlecht und Ethnizität in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Rolle von Geschlecht im HipHop, die unterschiedlichen Repräsentationen von Frauen und Männern im Rap, Debatten um Sexismus und Homophobie und untersucht ein Beispiel für inszenierte Männlichkeit in einer Jungengang. Der Einfluss der Ethnizität wird im Kontext von Gruppenbildungen ausländischer Jugendlicher, nationaler Symbolik und spezifischen Sprechweisen wie „Kanak Sprak“ betrachtet.
Wie werden strukturelle Benachteiligungen ausländischer Jugendlicher behandelt?
Die Arbeit beleuchtet strukturelle Benachteiligungen ausländischer Jugendlicher in Deutschland, analysiert verschiedene Aspekte ihrer Lebensentwürfe (Rechtsstatus, Bildung, Freizeit, Familie) und Ausländerfeindlichkeit. HipHop wird als Reaktions- und Identitätsraum betrachtet.
Welche empirischen Untersuchungen werden durchgeführt?
Die Arbeit beinhaltet empirische Untersuchungen zur Identitätskonstruktion im HipHop (Konzepte wie „style“, „realness“, „represent“) und zur deutsch-türkischen HipHop-Jugend (Lebenswelten, kultureller Nationalismus, verschiedene Rap-Stile).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: HipHop, Jugendkultur, Subkultur, Jugendgangs, Identitätsbildung, Ethnizität, Geschlecht, Deutschland, sozioökonomische Bedingungen, Repräsentation, Kommerzialisierung, Ausländische Jugendliche, strukturelle Benachteiligung, „Kanak Sprak“, Schwarzer Nationalismus, Gangster-Rap.
- Arbeit zitieren
- Kirsten Kottmann (Autor:in), 2002, HipHop als Jugend(sub)kultur in Deutschland?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20515