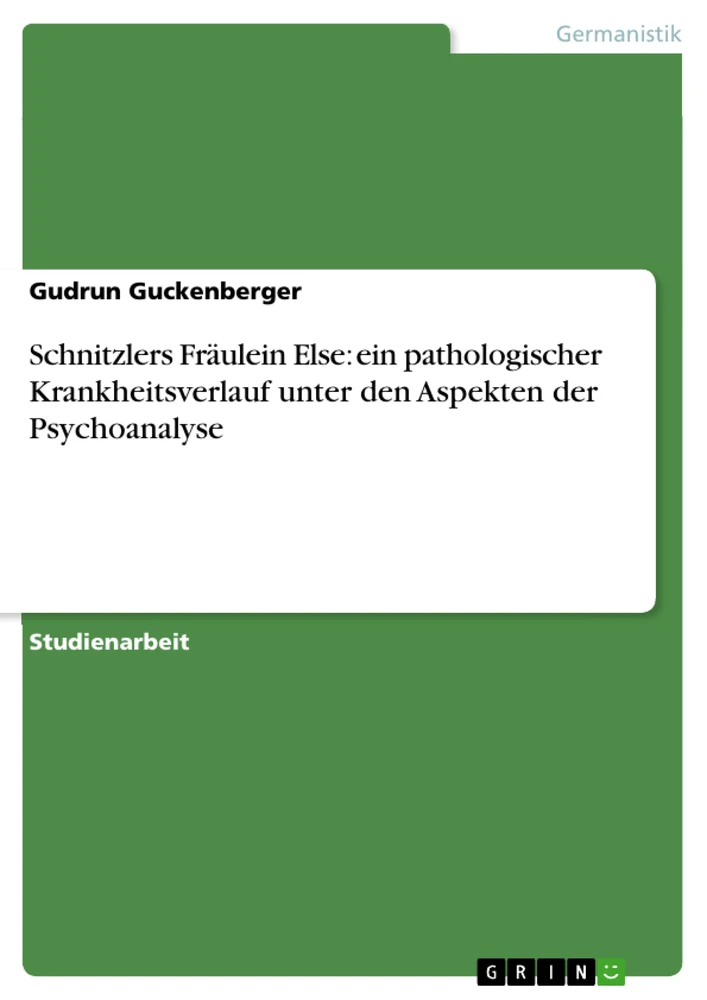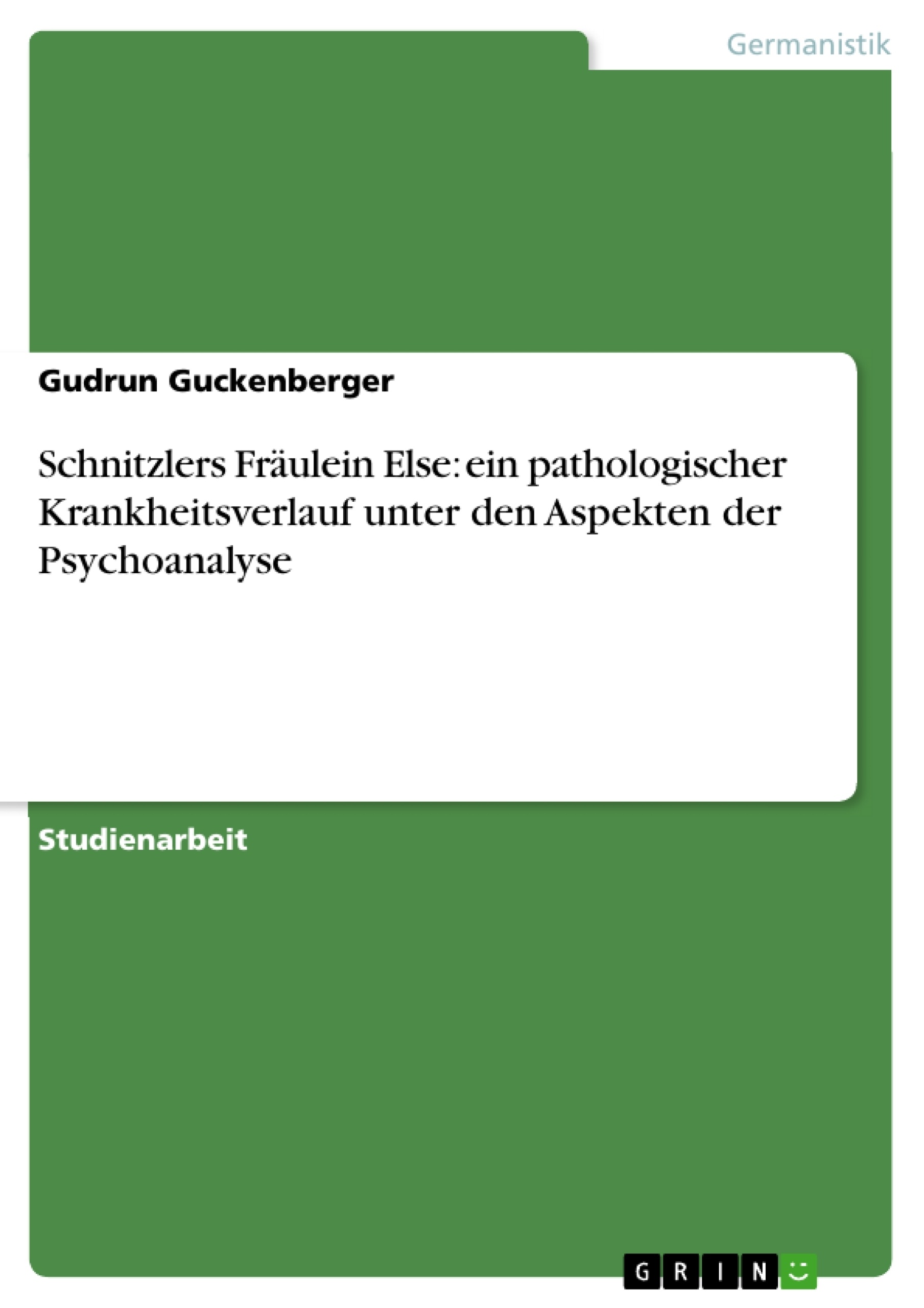Das Werk Schnitzlers ist von Dualismen geprägt: Tod und Leben, Spiel und Ernst, Traum und Wirklichkeit, Illusion und Desillusion, Verdacht und Enttarnung, Ich und Außenwelt, Wahrheit und Lüge, Maskierung und Demaskierung. Hinter dem Alltäglichen scheint sich etwas Geheimnisvolles, Anderes zu verbergen - die Illusionen, in die sich die Menschen flüchten. Welche Gründe gibt es dafür? In der Psychoanalyse gibt es Erklärungen der anmutenden Störungen. Diese möchte ich anhand der Fräulein Else als Hysterikerin aufzeigen. Die hysterisch anmutenden Symptombilder sind in der literarischen Darstellung primär auf innerpsychische Vorgänge beschränkt. So auch die der Fräulein Else. Für die Darstellung dieser Erzählung nutzte Schnitzler die konsequent durchgehaltene Figurenperspektive des inneren Monologs. Die psychische Verfassung der Protagonistin wird von äußeren Ereignissen beeinflusst, aber vor allem durch ihre Assoziationen vermittelt. Diese speisen sich aus äußerlich vermittelten und aus innerpsychischen Elementen, wie ihren Erinnerungen, Wünschen und Sehnsüchten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Psychologisierung nach Sigmund Freud
- Elses Ich-Konflikt
- Else vs. Gesellschaft
- Fräulein Else als Hysterikerin
- Der Innere Monolog: Einblick in die Selbstinszenierung
- Symptome des Krankheitsverlaufs
- Ursachen von Elses Hysterie
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert Arthur Schnitzlers „Fräulein Else“ unter dem Aspekt der Hysterie und beleuchtet die psychische Verfassung der Protagonistin. Die Arbeit untersucht, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse und die strukturellen Ungleichgewichte der Wiener Großbürgerwelt zur Entwicklung der Hysterie bei Fräulein Else beitragen.
- Die psychologische Dimension der Novelle und die Darstellung von Hysterie
- Der innere Monolog als Methode zur Erforschung der Psyche der Protagonistin
- Der Einfluss der gesellschaftlichen Verhältnisse auf Elses psychischen Zustand
- Die Ambivalenz zwischen Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Konvention
- Elses Ich-Konflikt und das Streben nach Emanzipation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Werk von Schnitzler in seinen Kontext und hebt die prägenden Dualismen hervor.
Der zweite Abschnitt erörtert die Psychologisierung nach Sigmund Freud und betrachtet Fräulein Else als psychologische Studie. Der Ich-Konflikt der Protagonistin wird analysiert, sowie ihr Streben nach Selbstbestimmung innerhalb der gesellschaftlichen Normen und Rollenbilder der Zeit.
Schlüsselwörter
Schnitzlers „Fräulein Else“, Hysterie, Innerer Monolog, Psychologisierung nach Freud, Ich-Konflikt, Emanzipation, Wiener Großbürgertum, Selbstmord, gesellschaftliche Normen.
Häufig gestellte Fragen
Welche psychologische Störung steht im Zentrum von Schnitzlers „Fräulein Else“?
Die Novelle wird als pathologische Studie der Hysterie analysiert, wobei die Protagonistin Else unter den Aspekten der Freudschen Psychoanalyse betrachtet wird.
Warum nutzt Arthur Schnitzler den inneren Monolog in diesem Werk?
Der innere Monolog ermöglicht einen direkten Einblick in die Selbstinszenierung und die innerpsychischen Vorgänge Elses, einschließlich ihrer Wünsche, Sehnsüchte und Assoziationen.
Welche Rolle spielt die Gesellschaft in Fräulein Elses Krankheitsverlauf?
Die gesellschaftlichen Verhältnisse und die strukturellen Ungleichgewichte des Wiener Großbürgertums erzeugen einen Ich-Konflikt bei Else, der maßgeblich zu ihrer psychischen Instabilität beiträgt.
Was sind die zentralen Dualismen in Schnitzlers Werk?
Typische Dualismen sind Tod und Leben, Spiel und Ernst, Traum und Wirklichkeit sowie Wahrheit und Lüge.
Wie hängen Emanzipation und Hysterie in der Novelle zusammen?
Die Arbeit untersucht die Ambivalenz zwischen Elses Streben nach Selbstbestimmung (Emanzipation) und den einengenden gesellschaftlichen Konventionen ihrer Zeit.
- Quote paper
- Gudrun Guckenberger (Author), 2012, Schnitzlers Fräulein Else: ein pathologischer Krankheitsverlauf unter den Aspekten der Psychoanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205221