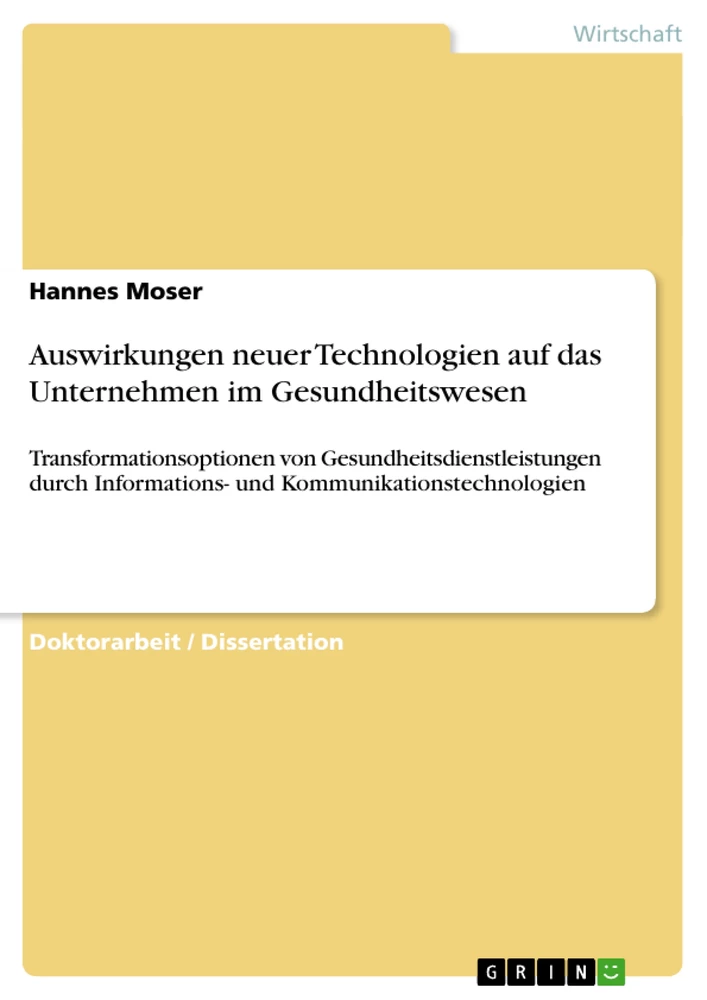Rasanter Fortschritt im medizinisch technischen Bereich, der Ruf nach mehr Prävention, nach besserer Koordination zwischen niedergelassenen Ärzten und Spitälern, nach verstärkter Einbindung anderer sozialer Einrichtungen oder nach Eindämpfung der Kostenexplosion: das Gesundheitswesen ist international im Umbruch. Nicht nur in Österreich wird nach einem zukunftsträchtigen und finanzierbaren System gesucht, um auf die Herausforderungen reagieren zu können. Es besteht ein starker Bedarf darin, Prozesse im Gesundheitsbereich standardisiert darzustellen und diese durch den Einsatz neuer Technologien effizient(er) zu gestalten. Ebenso bietet sich eine Reihe neuer Entwicklungen an, die die Dienstleistungen in diesem Bereich transformiert und dadurch beispielsweise die Arzt – Patientenbeziehung grundlegend ändern, sowie eine starke Einbindung des Kunden in den Dienstleistungserstellungsprozess forcieren wird.
Die zentrale Forschungsfrage der vorliegenden Dissertation beschäftigt sich daher mit Transformationsoptionen von Gesundheitsdienstleistungen in Produktion und Vermarktung, die durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien entstehen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
1.1. Forschungsfragen
1.2. Aufbau der Arbeit
2. Überblick über das Gesundheitswesen Österreichs
2.1. Einführung und historischer Hintergrund
2.1.1. Einführende Übersicht
2.1.2. Historischer Hintergrund
2.2. Struktur und Management des Gesundheitssystems
2.2.1. Struktur des Gesundheitssystems
2.2.2. Planung, Regulierung und Management
2.2.3. Dezentralisierung des Gesundheitssystems
2.3. Finanzierung und Ausgaben des Gesundheitssystems
2.3.1. Finanzierung der sozialen Krankenversicherung
2.3.2. Zusätzliche Finanzierungsquellen
2.3.3. Gesundheitsleistungen und Rationierung
2.3.4. Gesundheitsausgaben
2.4. Leistungserbringung im Gesundheitssystem
2.4.1. Primäre Gesundheitsversorgung
2.4.2. Stationäre Gesundheitsversorgung
2.4.3. Personelle Ressourcen
2.5. Verwendung der Finanzmittel im Gesundheitssystem
2.5.1. Budgetsetzung und Ressourcenallokation
2.5.2. Finanzierung von Krankenhäusern
2.5.3. Politische Zielvorgaben der Gesundheitsreformen
3. Innovationstheorien
3.1. Einführung
3.2. Begriffsbestimmungen
3.3. Definitionsversuche und Kriterien für „Innovation”
3.3.1. Inhaltliche Dimension
3.3.1.1. Produkt- und Prozessinnovationen
3.3.1.2. Innovationen der Systemeigenschaften
3.3.1.3. Innovationen jenseits der Technik
3.3.1.4. Postindustrielle Systeminnovationen
3.3.2. Intensitätsdimension
3.3.3. Subjektive Dimension
3.3.4. Prozessuale Dimension
3.3.5. Fazit
3.4. Funktionales Referenzschema der Innovation
3.5. Schema der Entstehung innovativer Märkte
3.6. Stand der Innovationstheorie
3.6.1. Überblick und klassische Ansätze
3.6.2. Neoklassische mikroökonomische Ansätze und neue Wachstumstheorie
3.6.3. Institutionen- und evolutionsökonomische Ansätze
3.6.4. Nachfragetheoretische Ansätze
3.7. Fazit und Einordnung des funktionalen Referenzschemas von Grupp
3.8. Dimensionen der Innovation im Gesundheitswesen
3.8.1. Innovationsprozess
3.8.2. Ansatz: Innovationssystem
3.8.3. Innovationssystem Gesundheit
3.8.4. Der Patient im Mittelpunkt des Gesundheitssystems
3.8.5. Anforderungen an Innovationen aus Sicht der unterschiedlichen Interessensgruppen
3.8.6. Charakteristika von Innovationen im Gesundheitswesen
3.8.7. Schlussfolgerungen
4. Grundlagen Medizinischer Informationssysteme
4.1. IT-Unterstützung zur Steigerung der Effizienz und Effektivität im Gesundheitswesen
4.2. Aspekte der Betriebs- und Managementunterstützung
4.3. Aspekte der Unterstützung medizinischen Handelns
4.3.1. Informationstransparenz
4.3.2. Das problemorientierte Krankenblatt
4.3.3. Klinische Pfade und Behandlungsmanagement
4.3.4. Benachrichtigungs- und Erinnerungsfunktionen
4.3.5. Integration von Literatur-/Wissensbasen
4.3.6. Entscheidungsunterstützende Funktionen
5. Grundlagen Elektronischer Krankenakten
5.1. Einleitung
5.2. Definitionen
5.3. Ziele und Nutzen der Elektronischen Krankenakte
5.4. Allgemeine Anforderungen und Anforderungen an die Bedienung Elektronischer Krankenakten
5.5. Zusammenfassung
6. Innovationspotentiale und Trends im Gesundheitswesen
6.1. eHealth – Grundlagen, Anwendungen, Konsequenzen
6.1.1. Einführung
6.1.2. Definitionen und Ziele von eHealth
6.1.3. Taxonomie der Anwendungen
6.1.4. Anwendungsbeispiele
6.1.4.1. eHealth-Anwendungen in der Patientenversorgung
6.1.4.2. eHealth-Anwendungen zur Information und Ausbildung
6.1.4.3. eHealth-Anwendungen in der Forschung
6.1.5. Technische, soziale und ethische Aspekte
6.1.6. Zusammenfassung
6.2. Vernetzungsfähigkeit im Gesundheitswesen
6.2.1. Einleitung
6.2.2. Transformationen des Gesundheitswesens mit Informations- und Kommunikationstechnologien
6.2.3. Konzept für die ganzheitliche Gestaltung vernetzter Strukturen
6.2.4. Bewertung der Vernetzungsfähigkeit
6.2.5. Übertragung des Business-Engineering-Frameworks auf das Gesundheitswesen
6.2.6. Psychologische und organisatorische Aspekte der Vernetzung
6.2.7. Zusammenfassung und Ausblick
6.3. Integrierte Versorgung
6.3.1. Einleitung
6.3.2. Ziele der integrierten Versorgung
6.3.3. Einsatz neuer Technologien
6.3.4. Aktueller Stand
6.3.5. Beispiele aus der Praxis
6.3.6. Zusammenfassung und Ausblick
6.4. Entscheidungsunterstützende Systeme
6.4.1. Einleitung
6.4.2. Entwicklung
6.4.3. Bedarf in der Medizin
6.4.4. Systematik
6.4.5. Transparenz und Qualitätspotentiale
6.4.6. Herausforderungen
6.4.7. Zusammenfassung und Ausblick
6.5. Evidenzbasierte Medizin
6.5.1. Einleitung
6.5.2. Anwendung von Evidenzbasierter Medizin (EbM)
6.5.3. Bewertung und Synthese der EbM
6.5.4. Systematische Übersichtsarbeiten und Leitlinien
6.5.5. Qualitätssicherung von EbM
6.5.6. Zusammenfassung und Ausblick
6.6. Disease Management
6.6.1. Einleitung
6.6.2. Patientenintegration
6.6.3. „level of care“
6.6.4. Beispiel „Risikoreport Diamart”
6.6.5. Zusammenfassung und Ausblick
6.7. Internet – Communities und Dienstleistungsszenarien
6.7.1. Einleitung
6.7.2. Internet-Nutzung durch Patienten
6.7.3. Im Internet verfügbare Gesundheitsdienstleistungen
6.7.4. Managed Care
6.7.5. Internet- und Call-Center-gestützte Programme - Beispiel Asthma
6.7.6. Prävention
6.7.7. Veränderungen durch das Internet
6.7.7.1. Mehr Kontakte - mehr Wissen
6.7.7.2. Zusätzliche Bewältigungsressourcen durch online-vermittelten Rückhalt
6.7.7.3. Veränderte Arzt-Patient-Beziehung
6.7.8. Zusammenfassung und Ausblick
6.8. Sektorenübergreifende Clinical Pathways
6.8.1. Einleitung
6.8.2. Rechtliche Grundlagen
6.8.3. Clinical Pathways als Steuerungsinstrument
6.8.4. Zentrale Rolle der Krankenhäuser für die integrierte Versorgung
6.8.5. Zusammenfassung und Ausblick
6.9. Prozessoptimierung durch Krankenhaus-Workflow-Systeme
6.10. Datenübertragung, „Mobile Health” und Hardwareeinsatz im Krankenhaus
6.10.1. Einleitung
6.10.2. Wireless LAN (WLAN) und Bluetooth
6.10.3. Mobile Healthcare
6.10.4. Home Monitoring
6.10.5. Televisite
6.10.6. Zusammenfassung und Ausblick
6.11. Zukünftige Nutzung von Informationstechnologie im Gesundheitsbereich
6.11.1. Technische Herausforderungen der Informationstechnologie im Gesundheitswesen
6.11.2. Klassifizierung nach Wichtigkeit und Hemmnissen und Einordnung der Innovationspotentiale in das Referenzschema
7. Darstellung ausgewählter Prozesse des Gesundheitswesens
7.1. Einleitung
7.1.1. Klinische Pfade
7.1.2. Soll-Prozesse
7.2. Totalendoprothese wegen Coxarthrose
7.2.1. Einleitung
7.2.2. Prozessdarstellung
7.3. OP-Organisation
7.3.1. Einleitung
7.3.2. Prozessdarstellung
7.4. Neurologie Ambulanz – Prozessübersicht
7.4.1. Einleitung
7.4.2. Prozessdarstellung
7.5. Kernprozess Entlassung – Prozessübersicht
7.5.1. Einleitung
7.5.2. Prozessdarstellung
8. Transformationsoptionen der dargestellten Prozesse
8.1. Einleitung
8.2. Implikationen
8.3. Totalendoprothese wegen Coxarthrose
8.4. OP-Organisation
8.5. Neurologie Ambulanz – Prozessübersicht
8.6. Kernprozess Entlassung - Prozessübersicht
8.7. Offene Fragen und weitere Forschungsfelder
9. Zusammenfassung / Summary
9.1. Deutsch
9.2. English
10. Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Organisationsstruktur und Entscheidungsflüsse im Gesundheitswesen
Abbildung 2: Gesundheitsausgaben als Prozentsatz des BIP 2002, WHO Schätzungen
Abbildung 3: Finanzierungsströme im Gesundheitswesen
Abbildung 4: Referenzschema gekoppelter Fortschrittsfunktionen nach Grupp
Abbildung 5:Standardisiertes Schema zur Einordnung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts
bei der Marktentstehung nach Grupp
Abbildung 6: Überblick über formale Theorien und andere Ansätze der Innovationsforschung und Innovationsökonomik
Abbildung 7: Einordnung des funktionalen Referenzschemas in die ökonomischen Grundstrukturen
Abbildung 8: Innovationsprozess im Gesundheitswesen
Abbildung 9: Innovationssystem
Abbildung 10: Gesundheits-Innovationssystem - Nachfrage/Rahmenbedingungen
Abbildung 11: Gesundheits-Innovationssystem - Finanzierung
Abbildung 12: Gesundheits-Innovationssystem - Angebot/private Wirtschaft
Abbildung 13: Gesundheits-Innovationssystem - Wissenschaft und Bildung
Abbildung 14: Patient im Mittelpunkt des Gesundheitssystems
Abbildung 15: Klinische und administrative Relevanz der Medizinischen Dokumentation nach NHS
Abbildung 16: Systemtypen und Informationssystempyramide
Abbildung 17: Klinische Pfade und Behandlungsprozess
Abbildung 18: Beispiel Medline
Abbildung 19: Begriffdefinitionen zur elektronischen Krankenakte
Abbildung 20: Prinzipielle Komponenten einer Elektronischen Patientenakte
Abbildung 21: Ordnungskriterien und Standardisierungsgrad
Abbildung 22: Taxonomie telematischer Anwendungen im Gesundheitswesen
Abbildung 23: Behandlungsprozess und einrichtungsübergreifende Kooperationsszenarien
Abbildung 24: Befundübermittlung und Integration in ein Arztpraxisinformationssystem
Abbildung 25: Institutionelle Systeme und einrichtungsübergreifende elektronische Patientenakte
Abbildung 26: Infrastrukturaspekte von Telematikplattformen
Abbildung 27: Das Business-Engineering-Framework
Abbildung 28: Gestaltungsobjekte der Vernetzungsfähigkeit und deren Entwicklungsstufen
Abbildung 29: Definition von Reifegraden
Abbildung 30: Erweiterung des Business-Engineering-Frameworks für das Gesundheitswesen
Abbildung 31: Versorgungskontinuum nach Ramming
Abbildung 32: Screenshot Innovacare / 4sigma als Beispiel für Integrierte Versorgung
Abbildung 33: Hierarchie der Evidenz nach dem Oxford Centre for EbM
Abbildung 34: Screenshot ACP Journal Club
Abbildung 35: Screenshot Medizinische Übersichtsarbeiten in der Cochrane Library
Abbildung 36: Screenshot Internationales Netzwerk Cochrane Collaboration
Abbildung 37: Die „level of care“ – Pyramide
Abbildung 38: Screenshot Krankheitslotse auf http://www.netdoktor.de
Abbildung 39: Entwicklung des Internet
Abbildung 40: Antwortverhalten bei chronisch erkrankten Nutzern von NetDoktor.de gegenüber der Frage: „Wo suchen Sie Informationen zu Gesundheitsthemen?“
Abbildung 41: Screenshot NetDoktor.de zum Thema Depression
Abbildung 42: Disease Management Netzwerk
Abbildung 43: Zunehmende Bedeutung der Prävention anhand der früheren und heutigen Behandlung von Tuberkulose, Magenulkus und Zahnbehandlung
Abbildung 44: Vertragsbeziehungen für Disease Management Programme
Abbildung 45: Prozessorientierung statt Sektorentrennung
Abbildung 46: Drahtlose Kommunikation im „digitalen Krankenhaus“
Abbildung 47: Schematische Darstellung Home Monitoring
Abbildung 48: Fazit-Forschung - Grundlegende Struktur und Beispielzweig zur Thesengenerierung
Abbildung 49: Einordnung der Trends in das Referenzschema
Abbildung 50: Wichtigkeit der Themen für
Abbildung 51: Hemmnisse bei der Realisierung
Abbildung 52: Patientenpfad als Krankenhaus-Kernprozess
Hinweis: Abbildungen in den Kapiteln 7 und 8 sind nicht nummeriert beschriftet.
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Bevölkerung und Gesundheitszustand (1990 und 2004)
Tabelle 2: Entwicklung der Gesundheitsausgaben 1970-
Tabelle 3: Ausgewählte Berufsgruppen im österreichischen Gesundheitswesen, 1970-
Tabelle 4: Schwerpunktsetzung in den Gesundheitsreformen 1977-
Tabelle 5: Anforderungen an Innovationen aus Sicht der unterschiedlichen Interessensgruppen
Tabelle 6: Vergleich Konventionelle und Elektronische Krankenakte
Tabelle 7: Gestaltungsobjekte der Vernetzungsfähigkeit aus Sicht der verschiedenen Akteure
Tabelle 8: Nutzen-Dimensionen und Zielparameter für Prävention und Gesundheitsförderung
Tabelle 9: Die nützlichsten Quellen für 12 Dimensionen der medizinischen Versorgung
Tabelle 10: Klassifizierung der Innovationspotentiale nach Wichtigkeit
Tabelle 11: Klassifizierung der Innovationspotentiale nach Hemmnissen
1. Einführung
Rasanter Fortschritt im medizinisch technischen Bereich, der Ruf nach mehr Prävention, nach besserer Koordination zwischen niedergelassenen Ärzten und Spitälern, nach verstärkter Einbindung anderer sozialer Einrichtungen oder nach Eindämpfung der Kostenexplosion: das Gesundheitswesen ist international im Umbruch. Nicht nur in Österreich wird nach einem zukunftsträchtigen und finanzierbaren System gesucht, um auf die Herausforderungen reagieren zu können.
Die Suche nach tragfähigen Konzepten ist dabei mit jeder Menge Streit und Verunsicherung verbunden. Es entsteht das Gefühl, dass hinter all den wirtschaftlichen Gesichtspunkten der Mensch und seine Gesundheit in den Hintergrund rücken.
Die Herausforderungen an die Reformen im Gesundheitswesen sind vielfältig. Österreichs Bevölkerung wird immer älter, die Lebenserwartung steigt weiter. Gleichzeitig bedeutet dies aber nicht, dass wir gesünder älter werden. Laut dem Gesundheitsbericht 2003 hat sich auch der Zeitraum vergrößert, von dem zu erwarten ist, dass er mit krankheitsbedingten Einbußen verbracht wird.
Diese und andere Fakten werfen die Frage auf, wie Herausforderungen zur Änderung des Gesundheitswesens bewältigt werden können.
Es besteht ein starker Bedarf darin, Prozesse im Gesundheitsbereich standardisiert darzustellen und diese durch den Einsatz neuer Technologien effizient(er) zu gestalten. Ebenso bietet sich eine Reihe neuer Entwicklungen an, die die Dienstleistungen in diesem Bereich transformieren und dadurch beispielsweise die Arzt – Patientenbeziehung grundlegend ändern, sowie eine starke Einbindung des Kunden in den Dienstleistungserstellungsprozess forcieren wird.
1.1. Forschungsfragen
Die zentrale Forschungsfrage meiner Dissertation beschäftigt sich daher mit den Transformationen von Gesundheitsdienstleistungen in Produktion und Vermarktung, die durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien entstehen (Angebotsseite).
Weiters soll die Bedeutung von neuen Technologien für Gesundheitsdienstleistungen im Erstellungsprozess beleuchtet werden und ob dadurch Produkt- und/oder Prozessinnovationen entstehen bzw. welche Determinierungsprozesse vorliegen.
Untersuchungen auf Nachfrageseite sollen aufgrund des dafür notwendigen Umfangs nicht tiefergehend im Rahmen dieser Arbeit analysiert werden.
Welche unternehmerischen Konsequenzen ergeben sich aufgrund der obigen Fragen und den entstandenen Antworten?
Und welche Implikationen über die Frage der Art und Weise der staatlichen Beteiligungen im Gesundheitsbereich entstehen dadurch?
1.2. Aufbau der Arbeit
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit theoretischen Konzepten und notwendigem Hintergrundwissen:
Zunächst erscheint es sinnvoll, einen historischen Überblick über das Gesundheitswesen sowie eine Einführung im Bereich der Strukturen, des Managements, sowie der Finanzierung und Leistungserbringung zu geben, um aktuelle Probleme aber beispielsweise auch rechtliche Rahmenbedingungen für die weiteren Ausführungen in der Dissertation zu verstehen (Kapitel 2).
Da sich der Inhalt dieser Arbeit um den zentralen Begriff „Innovation“ dreht, wird in Kapitel 3 anhand einer terminologischen und konzeptionellen Erfassung auf den Begriff eingegangen, sowie dessen Dimensionen (inhaltlich, subjektiv, prozessual) beleuchtet, um in weiterer Folge u.a. zwischen Produkt- und Prozessinnovation unterscheiden zu können. Ebenso wird der Versuch unternommen, ein Referenzschema der Innovation darzustellen, das als Grundlage für die spätere Einordnung der vorgestellten informations- und kommunikationstechnologischen Trends im Gesundheitswesen dienen soll.
Im zweiten Teil der Arbeit werden allgemeine Voraussetzungen für funktionsfähige Softwarelösungen im Gesundheitswesen dargestellt:
In Kapitel 4 geht es primär um Grundlagen in medizinischen Informationssystemen und deren Aspekte für die Betriebs- und Managementunterstützung sowie der möglichen Unterstützung medizinischen Handelns.
Um eine IT-unterstützte und prozessorientierte Patientenbehandlung im Gesundheitswesen zu erreichen, steht vor allem die elektronische Krankenakte im Zentrum des Interesses; die Grundlagen dazu werden in Kapitel 5 dargestellt.
Der dritte Teil der Arbeit befasst sich mit Innovationspotentialen im Gesundheitswesen; das Kapitel 6 beinhaltet neben allgemeinen Grundlagen wie den Begriff eHealth oder Konzepten zur Vernetzungsfähigkeit im Gesundheitswesen, v.a. auch eine Reihe von Trends, die das Gesundheitswesen in den nächsten Jahren umfassend verändern werden: neben einer umfassenden integrierten Versorgung und der Einbindung von entscheidungsunterstützenden Funktionen in medizinischer Software, neben evidenzbasierter Medizin und Patientenintegration in den Behandlungsprozess (beispielsweise durch Disease Management) wird vor allem das Internet als Übertragungs- und Kommunikationsmedium in Zukunft auch in der Medizin eine große Rolle spielen. Im Bereich des Prozessmanagements wird vor allem durch den Einsatz von Krankenhaus-Workflow-Systemen die Installierung von klinischen Pfaden (auch sektorenübergreifend) ermöglicht werden.
Im vierten Teil werden zunächst vier ausgewählte Beispielprozesse des klinischen Umfelds vorgestellt und modelliert (Kapitel 7). Darauf aufbauend sollen in Kapitel 8 mit Hilfe der vorgestellten Trends und Innovationen beispielhaft Transformationsoptionen erarbeitet und dargestellt werden, um etwaige praktische Innovationspotentiale aufzeigen zu können. Ebenso soll der Grad der Zielerreichung der aufgeworfenen Forschungsfragen und gesetzten Ziele der Dissertation überprüft, sowie gegebenenfalls offene Fragen und potentielle weitere Forschungsfelder dargestellt werden.
Im abschließenden Kapitel (Kapitel 9) werden die Inhalte der Dissertation nochmals in Kurzform in Deutsch und Englisch zusammengefasst.
2. Überblick über das Gesundheitswesen Österreichs
Im Rahmen dieser Arbeit sollen Innovationen im Dienstleistungsbereich des Gesundheitswesens, die mit Hilfe neuer Technologien realisiert werden können, dargestellt werden. Daher erscheint es sinnvoll, sich im allgemeinen Teil einen Überblick über das Gesundheitswesen in Österreich zu verschaffen. Auf den folgenden Seiten soll neben der historischen Entwicklung auch auf die Struktur und das Management, die Finanzierung und Ausgaben, die Leistungserbringung und die Verwendung der Finanzmittel überblicksmässig eingegangen werden.
Das erscheint für eine weitere Betrachtung in Bezug auf die Umsetzung von Trends insofern wichtig, als dass eine erfolgreiche Implementierung die Kenntnis der Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems voraussetzt.
2.1. Einführung und historischer Hintergrund
2.1.1. Einführende Übersicht
Bevölkerung und Gesundheitszustand im Überblick
Die Bevölkerung Österreichs betrug 2003 8,11 Millionen (1998 8,08), wobei 2002 65,8% in Städten lebten (1995 56%). Mit einem Bevölkerungswachstum von 5,0% seit 1990 rangiert Österreich über dem Durchschnitt der EU (3,1%). Herzkrankheiten, Krebs und Gehirngefäßerkrankungen erweisen sich seit drei Jahrzehnten als die führenden Todesursachen. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass sich die altersstandardisierte Mortalitätsziffer dieser Krankheitsgruppen in diesem Zeitraum um mehr als die Hälfte verringert hat. Der stärkste Anstieg in der Sterbehäufigkeit ist bei psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems und Krankheiten des Auges zu beobachten (primär seit Beginn der 1990er Jahre). Einzige weitere Diagnosegruppe, die von einer steigenden Mortalitätsrate betroffen ist, ist jene der endokrinen Erkrankungen bzw. Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, dessen Sterbehäufigkeit sich seit 1970 verdoppelt hat. Von 1980 bis 2004 verringerte sich die Mortalität insgesamt um 39%; (EU-Durchschnitt: 28%). Die Todesfälle infolge von Krebserkrankungen sanken zwischen 1980 und 2004 um 20%, von 213 pro 100000 Einwohner auf 170 (EU-Durchschnitt: 8%) [European Observatory 2001] [Hofmarcher und Rack 2006].
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten findet sich in der nachfolgenden Tabelle 1.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Bevölkerung und Gesundheitszustand (1990 und 2004)
2.1.2. Historischer Hintergrund
Die Entwicklung des Gesundheitssystems in Österreich steht in engem Zusammenhang mit der Errichtung eines Wohlfahrtsstaates auf dem Gebiet der österreichisch-ungarischen Monarchie ab 1867. Erste regulierende Bestimmungen finden sich bereits in der Dienstbotenordnung von 1810, in der die Arbeitgeber zur Begleichung von Krankenhausverpflegungsgebühren sowie zur Fürsorge für kranke Dienstpersonen verpflichtet wurden. Die Gewerbeordnung von 1859 sah die Einrichtung von Unterstützungskassen bzw. genossenschaftlichen Krankenkassen vor. Das Vereinsgesetz von 1867 ermöglichte die Bildung von Vereinskassen, auf dessen Basis entstand 1868 die Allgemeine Arbeiter-, Kranken- und Invalidenunterstützungskasse.
Aufgrund des starken Bevölkerungswachstums in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und einer damit einhergehenden Verschlechterung der sozialen Zustände, wurden neben Arbeitnehmerschutzbestimmungen weitere sozialpolitische Akzente gesetzt.
1887 wurde mit der Einführung der Unfall- und Krankenversicherung der Arbeiter nach dem Vorbild der Bismarck’schen Sozialpolitik der Grundstein für das heutige Sozialversicherungssystem gelegt. Die Krankenversicherung sah freie ärztliche Behandlung, Heilmittel und ein angemessenes Krankengeld vor, die Unfallversicherung eine Verletzten- sowie Hinterbliebenenrente. Die Finanzierung erfolgte zu zwei Drittel durch die Arbeiterschaft (Pflichtversicherung), zu einem Drittel durch die Unternehmer. Die Organe der Sozial- bzw. Krankenversicherung waren auf dem Prinzip der Selbstverwaltung aufgebaut. Ein staatlicher Zuschuss war nicht vorgesehen.
Der Zusammenbruch der Donaumonarchie und das Aufblühen der Sozialdemokratie führten mit der Einführung der Arbeitslosenversicherung, der Ausweitung der Krankenversicherung auf alle in einem Arbeits-, Dienst- oder Lohnverhältnis stehenden Personen, sowie der Einbeziehung der Familienmitglieder zu einem Ausbau der Sozialversicherung.
1938 trat das deutsche Sozialversicherungsrecht in Kraft, das im Bereich der Krankenversicherung aber keine Verbesserungen mit sich brachte. Die Periode nach dem Zweiten Weltkrieg führte in allen westlichen Demokratien zu einem massiven Ausbau des Sozialstaates. 1948 wurde in Österreich der Hauptverband der Sozialversicherung gegründet, der neben der Krankenversicherung auch die Unfallversicherung und die Pensionsversicherung unter einem Dach vereinte.
Im Gesundheitsbereich wurden unbegrenzte Anstaltspflege, Gesundenuntersuchungen, Jugenduntersuchungen und Rehabilitation als neue Leistungen eingeführt [BM f. Arbeit und Soziales 1989] [European Observatory 2001].
Ab 1980 treten, bedingt durch einen Konjunktureinbruch, große Finanzierungsprobleme für das österreichische Sozialversicherungsmodell auf. Das Gesundheitssystem ist durch stark steigende Kosten gekennzeichnet, wobei vor allem die Aufwendungen für Krankenhäuser überproportional zu denen für ärztliche Hilfe im niedergelassenen Bereich bzw. für Medikamente gestiegen sind. Die Gründe dafür liegen in einem laufenden Ausbau von Leistungen, aber auch in der Kombination von Bundes- und Länderkompetenz in Gesundheitsfragen, die bis heute gesundheitspolitische Entscheidungsfindungen schwierig gestalten; dem Bund obliegt im Bereich der Krankenhausversorgung die Grundsatzgesetzgebung, den Ländern die Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung.
Zur Bewältigung der Finanzierungsprobleme im stationären Sektor wurde bereits 1978 der Krankenanstaltenzusammenarbeitsfonds (KRAZAF) gegründet, die Errichtung dieses Fonds erfolgte gleichzeitig mit der Zielsetzung die österreichische Krankenanstaltenfinanzierung zu reformieren.
Mit der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Reform des Gesundheitswesens und der Krankenanstaltenfinanzierung wurde mit Anfang 1997 die Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung (LKF) eingeführt. Der KRAZAF wurde durch neun Landesfonds abgelöst, das führte zu starken institutionellen Veränderungen im Gesundheitswesen in Österreich [European Observatory 2001]
2.2. Struktur und Management des Gesundheitssystems
Auf der Grundlage von Vereinbarungen („Staatsverträgen“) verpflichten sich Bund und Länder wechselseitig zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung im Rahmen ihrer Zuständigkeiten. In der Bundesverfassung ist geregelt, dass fast alle Bereiche des Gesundheitswesens in die Kompetenz des Bundes fallen. Die wichtigste Ausnahme betrifft das Krankenanstaltenwesen. Hier besitzt der Bund nur die Grundsatzgesetzgebungskompetenz; Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung obliegt den neun Bundesländern. Die sanitäre Aufsicht über die Krankenanstalten liegt jedoch in der Kompetenz des Bundes.
Die Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen und die Steuerung des Gesundheitswesens werden in Österreich als eine überwiegend öffentliche Aufgabe betrachtet. Das Gesundheitswesen wird daher zu mehr als zwei Dritteln aus Beiträgen und aus dem Steueraufkommen finanziert. Etwa ein Drittel wird direkt von den privaten Haushalten aufgebracht [European Observatory 2001]. Die Gesundheitsleistungen selbst werden von staatlichen, privat-gemeinnützigen und privaten Organisationen bzw. von Einzelpersonen erbracht.
2.2.1. Struktur des Gesundheitssystems
Die Organisationsstruktur des österreichischen Gesundheitswesens ist durch die Interaktion öffentlicher, privat - gemeinnütziger und privater Akteure bestimmt. In der unten stehenden Abbildung werden die Organisationsstruktur bzw. die Entscheidungsflüsse im Gesundheitswesen schematisch dargestellt [Hofmarcher und Rack 2006].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Organisationsstruktur und Entscheidungsflüsse im Gesundheitswesen
Im Nationalrat und im Bundesrat werden Gesetzesvorschläge zum Ausbau, zur Entwicklung und zu Reformen des Gesundheits- und Sozialwesens parlamentarisch behandelt. Die Gesetzesvorschläge werden zumeist vom Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen (BMSG) initiiert. Als Aufsichtsbehörde überwacht das BMSG die Einhaltung der Gesetze, die von den Trägern der sozialen Krankenversicherung und der Standesvertretung der Ärzte (Österreichische Ärztekammer) zur Sicherstellung der ambulanten Versorgung umgesetzt werden.
Gegen Bezahlung eines monatlichen, obligatorischen Krankenversicherungsbeitrages erwerben Patienten Rechtstitel zu Behandlungen, die sich aus dem aktuellen Stand der Allgemeinen Sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen ergeben. Frei praktizierende Ärzte können von Patienten frei gewählt werden. Zwischen den gesetzlichen Standesvertretungen der Ärzte und der sozialen Krankenversicherung werden periodisch, zumeist einmal jährlich, Verhandlungen geführt, in der die Anzahl der Vertragspartner, die Menge verfügbarer Leistungen und das Honorierungsschema im Rahmen des Gesamtvertrages festgelegt werden.
Die Beziehungen zwischen den Krankenversicherungsträgern und den Krankenanstalten sind im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG), im Bundes - Krankenanstaltengesetz (B-KAG), und in den Landes – Krankenanstaltengesetzen (L-KAG) geregelt. Im Bereich des Krankenanstaltenwesens haben die Länder aufgrund der Kompetenzregelungen in der Bundesverfassung einen Versorgungsauftrag, der von den Eigentümern (Spitalserhalter) umgesetzt wird. Investitions- und Erhaltungskosten sowie ein Anteil der Betriebskosten werden von den Ländern, vom Bund und den Eigentümern bezahlt. 1997 wurden neun Landesfonds zur Finanzierung der Spitäler eingerichtet. Die Fonds werden mit budgetierten Mitteln der sozialen Krankenversicherung und mit Steuermitteln beschickt; sie erhalten in einigen Ländern auch die Landesmitteln. Die Landesfonds sind eigene Rechtspersönlichkeiten und ihre Aufgabe ist die Abrechnung der Versorgungsleistung pro krankenversicherter Person nach Diagnosenfallgruppen.
In den Landtagen wird über die Gesetzesvorschläge bezüglich des Krankenanstaltenwesens, die von den zuständigen Landesräten initiiert werden, diskutiert und abgestimmt.
Die auf Bundesebene angesiedelte Strukturkommission ist neben anderen Aufgaben für die Beschlussfassung bzw. für die Überwachung der Umsetzung des Krankenanstalten- und Großgeräteplans zuständig. Von ihr gehen außerdem Initiativen zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens aus. Die Landeskommissionen überwachen unter anderem die Implementierung der Leistungsorientierten Krankenanstalten Finanzierung (LKF) und die Einhaltung der Vorgaben des Krankenanstalten- und Großgeräteplans [European Observatory 2001].
2.2.2. Planung, Regulierung und Management
Im österreichischen Gesundheitswesen gibt es drei Formen von Beziehungen zwischen den Krankenversicherungen und den Anbietern der Leistungen:
- Integriert: Eine vollständige Integration von Angebot und Bezahlung ist im Bereich der Ambulatorien vorzufinden. Von den Trägern der Krankenversicherung werden österreichweit 134 kasseneigene Ambulatorien geführt, deren Leistungsspektrum sich je nach Träger von Diagnostik und Therapie bis zur zahnmedizinischen Versorgung erstreckt. Außerdem betreiben Sozialversicherungen Unfallkrankenhäuser, Kur- und Rehabilitationseinrichtungen.
- Semi-Integriert: Die Krankenkassen finanzieren im Wesentlichen den laufenden Betrieb der Krankenanstalten und demnach zu einem erheblichen Teil auf die dort anfallenden Lohnkosten der Beschäftigten.
- Verträge: In der primären Versorgung werden zwischen den sozialen Krankenversicherungen und den Standes- bzw. Berufsvertretern der Ärzte Gesamtverträge abgeschlossen. Leistungen und Honorare werden auf dem Verhandlungsweg „ermittelt“. Die Krankenversicherungen bzw. der Hauptverband der Sozialversicherungsträger agieren als kollektives Nachfragemonopol, dem die Standes- bzw. Berufsvertretungen als kollektive Angebotsmonopole gegenüberstehen.
Im Bereich der Finanzierung gehört das Gesundheitssystem in Österreich zum Staatssektor, in dem die Ausgaben für Gesundheit und Invalidität etwa ein Drittel der gesamten Staatsausgaben betragen [European Observatory 2001]. Wie in fast allen Staaten mit Sozialversicherungssystem besteht die öffentliche und die private Leistungserbringung auf der Produktionsseite nebeneinander. Koordinierte Kapazitäts- und Leistungsplanung auf Bundes- und Landesebene und die ausgabenseitige Konsolidierung sind die wichtigsten Parameter für die Entwicklung des Gesundheitswesens seit 1990.
In jeder Krankenanstalt wird das Management von einem Gremium durchgeführt (Kollegiale Führung). Es besteht aus je einem Vertreter der Ärzteschaft, der Pflege und der Verwaltung. Je nach Versorgungsstufe ist zumeist auch ein Vertreter des technischen Personals in dieses Leitungsgremium eingebunden. Gemäß Bundes - Krankenanstaltengesetz müssen die kollegialen Führungen auch die Durchführung der Qualitätssicherungsmaßnahmen sicherstellen. Alle Entscheidungen, die den laufenden Betrieb betreffen, sind kooperativ zu treffen. Die Besetzung der Leitungspositionen wird entweder von den zuständigen Behörden bzw. von den Krankenhausbetriebsgesellschaften (Eigentümer) nach einem Ausschreibungsverfahren vorgenommen [European Observatory 2001].
2.2.3. Dezentralisierung des Gesundheitssystems
Im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung überträgt der Bund die Aufgaben der Gesundheitsverwaltung den Ländern. Innerhalb der mittelbaren Bundesverwaltung nimmt der öffentliche Gesundheitsdienst öffentlich - rechtliche Aufgaben inklusive der damit zusammenhängenden Untersuchungstätigkeiten, wie sanitäre und hygienische Kontrollen, wahr. Der Vollzug der Sozialversicherungsgesetze ist den Trägern der Sozialversicherung übertragen und stellt eine eigene Kompetenzmaterie dar. Im Bereich der Krankenanstalten wird vom Bund ein Grundsatzgesetz vorgegeben, die Vollziehung erfolgt durch die Länder. Eine Delegation der Aufgaben erfolgt im Bereich der Notfallversorgung und sozialen Dienste.
Die Schaffung der Landesfonds zur Abwicklung der Krankenanstaltenfinanzierung ist ein weiterer Dezentralisierungsschritt.
Im stationären Sektor sind die Gebietskörperschaften sowohl in der Wahrnehmung der Planung als auch der Regulierung sehr stark, wobei die Landeskompetenzen durch die Bundesverfassung festgelegt sind. Seit die Verhandlungen der Tagsätze zwischen den Versicherungsträgern und Eigentümern zur Finanzierung der operativen Ausgaben für die Krankenhausversorgung entfallen und die Mittel der Krankenversicherungen budgetiert sind, ist die ohnedies relativ geringe Planungs- und Regulierungskompetenz der Sozialversicherungen im Krankenanstaltenbereich marginal geworden. Die Sozialversicherungsträger wirken jedoch an der Gesundheitsplanung bedeutend mit [European Observatory 2001].
2.3. Finanzierung und Ausgaben des Gesundheitssystems
2.3.1. Finanzierung der sozialen Krankenversicherung
Etwa die Hälfte der Gesundheitsausgaben in Österreich wird über Krankenversicherungsbeiträge finanziert. Ein Fünftel wird durch Steuereinnahmen aufgebracht. Mehr als ein Viertel finanzieren die privaten Haushalte [OECD Berichte 1999].
Die Gesundheitsausgaben für 1998 wurden nach der verbindlich vorgeschriebenen EU - Systematik ESVG95 im Jahr 2000 neu berechnet. Die Umstellung in der Systematik betraf die gesamte volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und somit auch die Berechnung des Bruttoinlandsproduktes, das ebenso wie die Gesundheitsausgaben einen Bruch 1995 aufweist. Die Ausgabenentwicklung über die Zeit ist durch die Umstellung jedoch nur in sehr eingeschränktem Maß vergleichbar. Deshalb werden die Perioden 1985-1994 und 1995-1998 gesondert betrachtet [Verband der Versicherungsunternehmungen Österreichs 1999].
Entwicklung der Ausgaben 1985 - 1994
Der Bruttoinlandsprodukt (BIP) - Anteil der Gesundheitsausgaben betrug 1994 8,1%, jener der öffentlichen Gesundheitsausgaben 6,0%. Der BIP - Anteil öffentlicher Gesundheitsausgaben stieg um 0,9% von 5,1% 1985 auf 6,0% 1994, jener der Ausgaben der privaten Haushalte stieg um 0,5% von 1,6% 1985 auf 2,1% des BIP 1994. Innerhalb der Gesundheitsausgaben gab es eine deutliche Verschiebung der Ausgabenlasten zu den privaten Haushalten. 1994 betrug der Anteil des privaten Konsums an den gesamten Gesundheitsausgaben 26,2%, 1985 war er 2,3% geringer und betrug 23,9%. Die öffentlichen Haushalte wendeten 1994 74,4% auf; gegenüber 1985 entsprach dies einer Verringerung von 1,7%.
Innerhalb des öffentlichen Konsums werden 70% von den Sozialversicherungsträgern aufgewendet; Länder, Gemeinden und der Bund wendeten etwa 20% auf. Gegenüber 1985 ist der öffentliche Konsum anteilig an den gesamten öffentlichen Gesundheitsausgaben um 7% gestiegen. Öffentliche Investitionen und Transfers sind um 6,4% bzw. um 0,5% zurückgegangen [Hofmarcher 2000].
Entwicklung der Ausgaben 1995 - 1998
Der BIP - Anteil der Gesundheitsausgabenbetrug 1998 8,3%, jener der öffentlichen Gesundheitsausgaben 5,8%. Der BIP - Anteil öffentlicher Gesundheitsausgaben verringerte sich um 0,5% von 6,3% 1995 auf 5,8% 1998, jener der privaten Ausgaben blieb in etwa konstant und betrug 2,2% des BIP. Wie bereits in der Periode 1985 bis 1994 setzte sich die Verschiebung der Ausgabenlasten zu den privaten Haushalten fort: 1998 betrug der Anteil des privaten Konsums an den gesamten Gesundheitsausgaben 29,4% und war damit um 3,7% höher als 1995 (25,7%). Die öffentlichen Haushalte wendeten 1998 70,6% auf; gegenüber 1995 entsprach dies einer Verringerung von 3,7%. Anteilig an den öffentlichen Gesundheitsausgaben betrugen die Zahlungen von Sozialversicherungsträger, Ländern, Gemeinden und Bund einschließlich der Zahlungen der Landesfonds 1998 95% [Hofmarcher 2000].
Die Zugehörigkeit zu einem sozialen Krankenversicherungsträger kann nicht frei gewählt werden, sondern erfolgt aufgrund der Berufszugehörigkeit. Jeder Bezieher einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung ist automatisch auch krankenversichert und hat vollen Anspruch auf Sach- und Geldleistungen.
Zum überwiegenden Teil hat die Klientel aller Versicherungsträger einen Rechtsanspruch auf Leistungen. Auf diese besteht demnach ein gerichtlich durchsetzbarer Anspruch des Versicherten. Daneben gibt es noch freiwillige Leistungen (z.B. Kuraufenthalte). Der Bezug und der Umfang der Gesundheitsleistungen der sozialen Krankenversicherung sind grundsätzlich beitragsunabhängig. Die Leistungen sind primär Sachleistungen; daneben gibt es aber auch Geldleistungen. Der Versicherungsschutz wird entweder in Folge von Krankheit, infolge von krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit, infolge von Mutterschaft und bei Gesundheitsvorsorgeleistungen wirksam [Hofmarcher 2000].
2.3.2. Zusätzliche Finanzierungsquellen
Wie bereits erwähnt, veränderten sich die Ausgabenanteile in den wichtigsten Aggregaten im Beobachtungszeitraum von sechzehn Jahren zulasten der privaten Haushalte. Die Ausgaben der privaten Haushalte stiegen insbesondere für die Kategorie Ausgaben für ärztliche Dienste überdurchschnittlich stark an. Dieser Anstieg erklärt sich teilweise aus der 1996 vorgenommenen Reduktion des Kostenersatzes für so genannte „Wahlärzte“ [Hofmarcher 2000].
„Out-of-pocket“ - Ausgaben sind Ausgaben der privaten Haushalte für Arzneimittel, für therapeutische Waren und die Kostenbeteiligung für die ersten 28 Tage von Spitalsaufenthalten; diese sind im Zeitraum von 1980 bis 1996 um mehr als 9% gestiegen. Die hohe Ausgabenneigung der privaten Haushalte für Gesundheit findet sich jedoch offenbar nicht in der Neigung, eine private (Zusatz-)Krankenversicherung abzuschließen, denn der Anteil der Ausgaben für private Krankenversicherungen verringerte sich seit 1985 in allen betrachteten Perioden [Hofmarcher 2000].
Um sicherzustellen, dass Österreich an der Wirtschafts- und Währungsunion teilnimmt, wurden 1996 und 1997 Konsolidierungsmaßnahmen getroffen, die vor allem im Bereich Sozial- und Gesundheitspolitik angesiedelt waren. Der laufende Ausbau der Leistungen auf der Grundlage medizinisch-technischer Entwicklungen geht oft mit dem Ausbau bzw. mit der Etablierung von Selbstbehalten und Kostenbeteiligungen einher. Durch diese Politik ist es möglich, den Versicherungsschutz am aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaften auf die gesamte Bevölkerung zu verteilen [European Observatory 2001].
„Out-of-pocket“ - Zahlungen
Selbstbehalte, Zuzahlungen und Kostenbeteiligungen sind die wichtigsten Formen der Ausgaben der privaten Haushalte für Gesundheit. Die Einhebung dieser Formen von privaten Ausgaben ist an eine Vielzahl von Ausnahmebestimmungen gebunden. Außerdem werden in allen Fällen Einkommensuntergrenzen berücksichtigt.
Freiwillige private Krankenversicherungen
Aufgrund des hohen Anteils an Sozialversicherten in der österreichischen Bevölkerung bestehen die Motive für die Inanspruchnahme einer zusätzlichen privaten Krankenversicherung hauptsächlich darin, die Kosten einer besseren Unterbringung im Krankenhaus und die Kosten einer Behandlung durch einen Arzt der eigenen Wahl abzusichern und eine Verkürzung der Wartezeit bei Untersuchungen und therapeutischen Leistungen zu erreichen.
Externe Finanzierung
Die Universitätskliniken erhalten pro Jahr vom Bund zur Abdeckung ihres Mehraufwandes, der durch universitäre Forschung und Lehre entsteht, eine Pauschalsumme, den so genannten „Klinischen Mehraufwand“ ersetzt. Die Universitätskliniken haben darüber hinaus die Möglichkeit, „Drittmittel“ zu lukrieren, indem sie wissenschaftliche Forschungsaufträge entgegennehmen.
2.3.3. Gesundheitsleistungen und Rationierung
Die Leistungen der sozialen Krankenversicherungen umfassen [European Observatory 2001]:
- Die ärztliche Versorgung im primären Sektor, einschließlich physiotherapeutische, ergotherapeutische und logopädische Behandlung, sowie psychotherapeutische Behandlung
- Heilmittel, Heilbehelfe, Hilfsmittel
- Zahnbehandlung, Zahnersatz
- Krankenversorgung
- Medizinische Hauskrankenpflege
- Krankengeld
- Mutterschaftsleistungen
- Medizinische Rehabilitation
- Gesundheitsfestigung und Krankheitsverhütung (z.B. Kuren)
- Früherkennung von Krankheiten und Gesundheitsförderung
- Fahrtspesen und Transportkosten
Prinzipiell ist der Bezug von Leistungen, die als Leistungen der sozialen Krankenversicherung qualifiziert wurden, unbeschränkt und einkommensunabhängig; alle anderen Leistungen müssen beantragt werden. Die Genehmigung erfolgt durch die kasseneigenen Kontrollärzte. Bevor Leistungen als Pflichtleistungen der Krankenkassen gesetzlich verankert werden, werden mit den jeweiligen Berufs- und Standesvertretungen Verhandlungen über die regionale Verteilung des Zuganges zu Gesundheitsleistungen, über die Höhe der Vergütung und über die Einhaltung von Qualitätsstandards geführt.
Patientenrechte finden sich bereits in der Rechtsordnung, aber es bestehen Informationsdefizite und Schwierigkeiten in der Umsetzung. Patientenrechte sind in besonderer Weise mit dem Krankenanstaltenwesen verbunden, da im stationären Sektor die problematischsten Fälle der Medizinhaftung auftreten. Der Charakter der Patientenrechte als Querschnittsmaterie, ihre Zersplitterung in zahlreiche Vorschriften im Rahmen der Rechtsordnung des Bundes und der Länder und die dadurch bedingten Schwierigkeiten in der Durchsetzung führten zur Überlegung, einen Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern abzuschließen, in der sich der Bund und die Länder wechselseitig zur Sicherstellung der darin genannten Patientenrechte im Rahmen ihrer Zuständigkeiten verpflichten. Dabei wird die Absicht verfolgt, eine von der Kompetenzlage losgelöste, vollständige und übersichtliche Zusammenfassung aller Patientenrechte zu erstellen [Mazal 1995].
In allen Bundesländern wurden mittlerweile Patientenanwaltschaften landesgesetzlich verankert. Patientenanwälte sind weisungsfrei und haben Beschwerden über Missstände nachzugehen, sowie Informations- und Beratungspflichten. Neben den unabhängigen Patientenanwaltschaften gibt es in den Bundesländern auch allgemein - medizinische und zahnärztliche Schiedsstellen der Ärztekammern, die ebenfalls der außergerichtlichen Durchsetzung von Patientenrechten dienen.
2.3.4. Gesundheitsausgaben
Zwischen 1970 und 2004 sind die nominellen Gesundheitsausgaben jahresdurchschnittlich etwa um 8,4% gewachsen, zu den Preisen von 2000 sind sie um 4,6% gestiegen. Der BIP - Anteil der Gesundheitsaufgaben in Österreich ist um mehr als 4% gestiegen, von 5,3% 1970 auf 9,6% 2004 [Hofmarcher und Rack 2006].
Die folgende Tabelle veranschaulicht die Entwicklung der Gesundheitsausgaben, die von der Statistik Österreich berechnet und an die OECD gemeldet werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Entwicklung der Gesundheitsausgaben 1970-2004
Einer laufenden Ausweitung, die 1994 dazu führte, dass drei Viertel der Gesundheitsausgaben von den öffentlichen Haushalten bezahlt wurden, folgte bis 1998 ein Rückgang der Quote um etwa 4% auf 70,6%.
Zwischen 1981 und 1997 lag das Wachstum des Gesundheitssektors sowohl nominell als auch real über jenem des Staatssektors insgesamt und war etwa einen Prozentpunkt stärker als das Wirtschaftswachstum. In der Periode 1982 bis 1989 wuchsen insbesondere die realen Ausgaben der privaten Haushalte am deutlichsten. In der Periode 1990 bis 1997 war das Wachstum der Gesundheitsausgaben doppelt so stark wie das Wirtschaftswachstum insgesamt und lag etwas mehr als 1% über dem Wachstum des Staatssektors insgesamt. Der BIP - Anteil der Gesundheitsausgaben in Österreich betrug 1997 8,3%. Im ungewichteten EU - Durchschnitt betrug die Quote 8,5%. Österreichs Quote war geringer als jene in Deutschland, Frankreich, Griechenland und Israel; die Schweiz und Schweden erreichten 1997 einen BIP - Anteil von über 8,4% [OECD Berichte 1999].
Die Höhe der Quote bzw. die relative Position eines Landes gibt noch keinerlei Auskunft darüber, wo der Benchmark ist. Erst die Betrachtung der Produktionsseite bzw. des Outputs (Ergebnisse) über die Zeit in Verbindung mit der Entwicklung der Quote in diesem Sektor erlauben es, qualitative Aussagen über die Effizienz des Gesundheitssektors zu treffen. Im Ländervergleich rangiert Österreich bei Betrachtung des öffentlichen Anteils an den gesamten Gesundheitsausgaben mit etwa 73% im unteren Drittel der Europäischen Region (lt. Definition der WHO: EU-15, Polen, Tschechien, Slowenien, Ungarn) [Council of Europe 1997]. Österreichs Pro-Kopf-Ausgaben für Gesundheit lagen 1997 9% über dem EU-Durchschnitt; gegenüber 1990 erhöhten sie sich relativ zum EU-Durchschnitt um 3% [OECD Berichte 1999].
Die Höhe der Gesundheitsausgaben pro Kopf ist zumeist stark mit der Höhe des gesamtwirtschaftlichen Einkommens pro Kopf assoziiert. Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass umso mehr für den Gesundheitssektor ausgegeben wird, je reicher ein Land ist.
Bezogen auf die funktionelle Aufteilung der Gesundheitsausgaben konsumiert der stationäre Sektor den größten Anteil, der 1997 43% betrug. Die anteiligen Ausgaben für die ambulante medizinische Versorgung haben sich zwischen 1970 und 1997 um etwa 3% von 23,9% auf 26,2% erhöht. Der Anteil der Ausgaben für Arzneimittel ist zwischen 1980 und 1997 von 10,9% auf 15,1% gestiegen, jener für Heilbehelfe und Hilfsmittel von 2,3% auf 2,7%. Investitionen in Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben verringerten sich zwischen 1980 und 1997 um 1,8% von 4,9% auf 3,1% [OECD Berichte 1999].
Dieses Ausgabenmuster ist in fast allen entwickelten Ländern zu finden und hat zur Folge, dass teilweise ähnliche Instrumente zur Eindämmung der Ausgaben eingesetzt wurden und werden. Kostendämpfungsbemühungen sind daher vorwiegend im stationären Bereich angesiedelt. Die Ausgaben für Arzneimittel stehen ebenfalls im Zentrum der Einsparungsbemühungen.
Ein Internationaler Vergleich der Gesundheitsausgaben (gemessen am BIP) findet sich in der nachfolgenden Abbildung [Hofmarcher und Rack 2006]:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Gesundheitsausgaben als Prozentsatz des BIP 2002, WHO Schätzungen
2.4. Leistungserbringung im Gesundheitssystem
Die Leistungserbringung im Gesundheitssystem involviert sehr viele verschiedene Gruppen. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit richtet sich aber vor allem auf Unternehmen im Gesundheitswesen, daher wird der Einheit „Krankenanstalt“ in den folgenden Ausführungen besondere Bedeutung geschenkt; andere Bereiche werden nur aus Übersichts- und Verständlichkeitsgründen erwähnt.
2.4.1. Primäre Gesundheitsversorgung
Die Primärversorgung in Österreich erfolgt durch frei praktizierende Ärzte, die überwiegend in Einzelpraxen tätig sind. Andere Formen ärztlicher Versorgung umfassen Apparategemeinschaften, Praxisgemeinschaften und Tageskliniken.
Darüber hinaus besteht ein direkter Zugang zu Ambulatorien, die sowohl von der sozialen Krankenversicherung als auch von Privatpersonen geführt werden.
Für die primäre Versorgung stehen außerdem in eingeschränktem Umfang die Spitalsambulanzen in den Krankenanstalten zur Verfügung. Organisatorisch basiert die primäre Versorgung überwiegend auf vertraglichen Beziehungen zwischen „Einzelunternehmen“ und den Krankenkassen. Allerdings ist durch die relativ große Bedeutung der Spitalsambulanten in der primären Versorgung, die zudem in den letzten Jahren noch gestiegen ist, der Mix zwischen privater und öffentlicher Produktion stark ausgeprägt [European Observatory 2001].
Ambulatorien
Die Tätigkeit selbständiger Ambulatorien ist im Krankenanstaltengesetz geregelt. Selbständige Ambulatorien sind Krankenanstalten, ihre Leistungsfelder sind jedoch für die primäre Versorgung wichtig. Grundsätzlich sind die Aufgabengebiete mit jenen der frei praktizierenden Ärzte vergleichbar. Sie sind für die Untersuchung und Behandlung von Personen vorgesehen, für die keine Krankenhausbehandlung erforderlich ist. Für die Errichtung und den Betrieb eines selbstständigen Ambulatoriums ist eine Bewilligung der zuständigen Landesregierung notwendig [European Observatory 2001].
2002 gab es insgesamt 836 selbständige Ambulatorien, von denen 131 (16%) von einer Sozialversicherung betrieben wurden, die in der Hauptsache als Zahnambulatorien (64%) und allgemeine Ambulatorien (35%) geführt werden [Hofmarcher und Rack 2006].
Neben Zahnambulatorien betreiben die Krankenversicherungsträger auch noch Röntgenambulatorien, Ambulatorien für physikalische Medizin, gynäkologische Ambulatorien und andere. Sowohl bei den allgemeinen, als auch bei den Zahnambulatorien ist der Eigentümeranteil der Sozialversicherungsträger seit 1975 um mehr als die Hälfte gesunken [Verband der Versicherungsunternehmungen Österreichs 1999]. Diese Entwicklung lässt sich aus dem Bestreben der Sozialversicherungsträger ableiten, kleine und unwirtschaftliche Ambulatorien zu schließen und größere Einheiten zu betreiben [Hofmarcher 2000].
Das ärztliche und fachärztliche Angebot, zusammen mit der guten Ausstattung von Ambulatorien, erzeugt für die frei - praktizierenden Ärzte eine bisweilen starke Konkurrenzsituation, die Ende der 1970er Jahre im Rahmen des so genannten „Ambulatorienstreites“ zur Rechtsauffassung des Verfassungsgerichtshofes geführt hat, dass der Erteilung einer Errichtungsbewilligung für ein selbstständiges Ambulatorium das Einvernehmen zwischen den Interessensvertretungen der Ärzte und dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger vorausgehen muss. Wird keine Einigung erzielt, prüft die Landesregierung den Bedarf [Hofmarcher 2000].
Spitalsambulanzen
Spitalsambulanzen sind eine wichtige Schnittstelle im österreichischen Gesundheitswesen. Sie können gegen Vorlage eines Krankenscheins direkt aufgesucht werden. Diese Ambulanzen (rund 1500) stehen sowohl für die Notfallversorgung und die Akutversorgung, als auch für die Nachsorge und für die Vorsorgeuntersuchungen - teilweise rund um die Uhr - zur Verfügung. Dieser ambulante Leistungsbereich wurde in den letzten Jahren immer umfangreicher [Talos 1994].
Die Anzahl der Fälle in den Spitalsambulanzen der Krankenanstalten betrug 2003 etwa 5,5 Millionen. Im Vergleich zu 1995 entsprach das einer Steigerung von 17%. Zwischen 1997 und 1999 betrug die jährliche Veränderung 9,1% und war damit mehr als doppelt so hoch wie in den Vorperioden. Die Kosten pro ambulantem Fall wuchsen im Gleichklang mit den Fällen [Hofmarcher und Rack 2006].
Gegenüber 1990 waren sie 1998 um 36% höher. Seit 1993 verringert sich die jährliche Zuwachsrate der Kosten pro ambulantem Fall kontinuierlich. In den letzten 3 Jahren betrugen die jährlichen Veränderungen etwa 1% [Verband der Versicherungsunternehmungen Österreichs 1999].
Bislang ist es in Österreich nicht leicht möglich, den Weg von Patienten, die das Gesundheitssystem betreten und auf mehreren Ebenen der Versorgung Hilfe suchen, nachzuvollziehen. Das gesundheitspolitische Ziel der stärkeren Vernetzung zwischen ambulant, stationär und halb - stationär wurde bereits in mehreren Regierungsvereinbarungen als dringlich formuliert. Die Rolle von Krankenhausambulanzen müssen dabei differenzierter betrachtet werden: deren Leistungen sind gegenüber Ambulatorien niedergelassener Ärzte nicht ersetzend sondern vielmehr ergänzend zu sehen; sie sind daher besonders wichtig im Bereich der primären Notfallversorgung. Ihr Leistungsprofil ist bislang aber sowohl aus dem Planungs- als auch dem Finanzierungsgeschehen ausgeklammert, was zu Kostenverschiebungen Anlass gibt. Für Leistungen in Spitalsambulanzen erhalten Krankenanstalten gegenwärtig einen Betrag pro Fall, der deutlich unter den Kosten pro Fall liegt [Hofmarcher und Rack 2006].
Erst durch die konsistente Verfügbarkeit dieser Datengrundlagen wird es für die Gesundheitspolitik möglich sein, verstärkt Anreize zu setzen, um die Integration der Versorgung zu optimieren.
2.4.2. Stationäre Gesundheitsversorgung
Die stationäre Gesundheitsversorgung in Österreich ist überwiegend öffentlich organisiert, bzw. mit Hilfe von privat-gemeinnützigen Eigentümern, die manchmal auch über Öffentlichkeitsrechte verfügen. Eine Krankenanstalt mit Öffentlichkeitsrecht unterliegt einem gesetzlichen Versorgungs- und Aufnahmegebot, wohingegen private, gewinnorientierte Eigentümer prinzipiell Aufnahmen ablehnen können. Das Öffentlichkeitsrecht der Krankenanstalten beinhaltet jedoch auch gesetzlich vorgeschriebene Subventionen des öffentlichen Sektors für den laufenden Betrieb. Diese werden ausbezahlt, wenn das Leistungsspektrum einer gemeinnützigen Krankenanstalt von den staatlichen Behörden als versorgungsrelevant erachtet wird [Talos 1994].
Wichtigste Grundlage für die Entwicklung des stationären Sektors war und ist die Krankenanstaltenplanung. Bislang wurde das Hauptaugenmerk auf die Bettenangebotsplanung gelegt.
Spitalsambulanten sind interne Leistungsanbieter für die Abteilungen der Krankenanstalt, und sie sind auch wichtig im Bereich der primären Notfallversorgung. Allerdings sind sie bislang sowohl aus dem Planungsgeschehen als auch aus der Finanzierung nach Diagnosefallgruppen, die seit 1997 wirksam ist, weitgehend ausgeklammert.
Insgesamt waren 2003 (1998) in 272 (330) Krankenanstalten 67708 (72078) Betten verfügbar. Die Bettendichte entsprach 8,3 (8,9) Betten pro 1000 Einwohner. Bezogen auf alle Krankenanstalten wurden 2003 52,3% (1998 60%) der Betten von den Ländern und von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verfügung gestellt. Knapp 16% waren im Eigentum von geistlichen Orden bzw. Glaubensgemeinschaften. Obwohl 17% der Krankenanstalten 2003 von Privatpersonen betrieben wurden, betrug ihr Bettenanteil an der Gesamtkapazität nur 6,3%. 3% der Krankenanstalten befanden sich im Eigentum der Krankenkassen, von denen 1,6% der Bettenkapazität angeboten wurden. 42,6% aller Krankenanstalten sind allgemeine Krankenanstalten, die vorwiegend von den Ländern betrieben werden und in denen 63,2% der Betten angeboten werden. Der Anteil der Sonderkrankenanstalten ist etwa 8% niedriger, die anteilige Bettenkapazität jedoch beträgt nur etwas mehr als ein Drittel des Bettenanteils in den allgemeinen Krankenanstalten. 5,5% aller Krankenanstalten sind Pflegeanstalten, in denen jedoch nur 3,8% der Bettenkapazität verfügbar ist. Ein ähnliches Verhältnis ist im Bereich der Sanatorien zu beobachten [Hofmarcher und Rack 2006] [European Observatory 2001].
In Österreich gibt es drei Universitätskliniken (Graz, Innsbruck, Wien). 139 Spitäler (51%) aller Krankenanstalten sind die so genannten „Fondskrankenanstalten“, die im Wesentlichen den Bereich der öffentlichen und gemeinnützigen Akutkrankenanstalten (ohne Unfallkrankenhäuser) umfassen und aus öffentlichen Mitteln über Landesfonds finanziert werden. Die Bettenkapazität der Fondskrankenanstalten belief sich Ende 2003 auf 49292 tatsächlich aufgestellte Betten, das entspricht 72,8% der gesamtösterreichischen Bettenkapazität. Mehr als 83% des gesamten Krankenhauspersonals ist in den Fondskrankenanstalten konzentriert [Hofmarcher und Rack 2006].
Die Fondskrankenanstalten versorgten 2003 rund 2,3 Mio. stationäre Patienten. Die Krankenhaushäufigkeit betrug im Bereich der Fondskrankenanstalten rund 28%, das heißt, dass im Durchschnitt jeder vierte Einwohner Österreichs einmal im Jahr 1998 einen stationären Krankenhausaufenthalt absolvierte. Die Bettendichte lag bei rund 6,1 Betten je 1000 Einwohner bzw. bei 165 Einwohnern je Bett. Die durchschnittliche Belagsdauer der Patienten mit einem Aufenthalt in einer Fondskrankenanstalt zwischen 1 und 28 Tagen lag 2003 bei 5,97 Tagen. [Hofmarcher und Rack 2006], [OECD Berichte 1999].
2004 hatte sich die Anzahl der Krankenanstalten in Österreich gegenüber 1990 um 48, d.s. 15%, verringert [Hofmarcher und Rack 2006]. Diese Verringerung wurde auch im EU-Durchschnitt erreicht. Die Bettenkapazität lag 20% unter dem Ausgangsniveau, in der EU war sie um 25% geringer. Die durchschnittliche Belagsdauer halbierte sich in diesem Zeitraum. Während die Auslastung in der EU etwa konstant blieb und 1997 77,3% betrug, sank sie in Österreich um etwa 9% und lag damit 1997 bei 74%. Die Aufnahmeraten sind sowohl in Österreich als auch in der EU um mehr als 25% gestiegen [OECD Berichte 1999].
Die Entwicklung dieser Parameter für die Krankenhausversorgung weist darauf hin, dass steigende Aufnahmezahlen nicht nur eine Frage von verabsäumten Kapazitätsanpassungen sind, sondern dass ihr Wachstum auch durch die vielfältigen Möglichkeiten der Medizin endogen bedingt ist. Sinkende Verweildauern bei steigenden Aufnahmezahlen sind ein Indiz dafür, dass die Intensität der Produktion im Krankenanstaltenbereich deutlich gestiegen ist. Das Muster dieser Entwicklung ist deshalb in allen EU - Staaten zu beobachten [European Observatory 2001].
Bezogen auf Akutbetten (die in Österreich überwiegend in allgemeinen Krankenanstalten durchgeführt wird) lag die Bettendichte in österreichischen Akutkrankenhäusern mit 6,0 Betten pro 1000 Einwohnern deutlich über dem EU-Durchschnitt von 4,2 Betten. Im Vergleich zu anderen EU-15-Ländern war die Akutbettendichte in Österreich nach jener in Deutschland (6,2) die zweithöchste, gefolgt von Belgien, Luxemburg und der Schweiz. Der Abstand zwischen Österreich und dem EU-Durchschnitt betrug 2003 1,9 Akutbetten pro 1000 Einwohner, d.s. 44%. Gegenüber 1990 (1,7 Betten) hat sich dieser Abstand weiter vergrößert: Zwischen 1990 und 2003 verringerte sich die Akutbettendichte im EU-Durchschnitt um 22%, in Österreich nur um 15% [Hofmarcher und Rack 2006].
Österreich weist innerhalb der EU die mit Abstand höchste Aufnahmerate in Akutkrankenanstalten auf (28,8% in 2003)[1]. Die durchschnittliche Verweildauer ist mit 6,4 Tagen vergleichsweise kürzer als im EU-Durchschnitt (6,9 Tage). Die Bettenauslastungsrate lag 2003 mit 76,2% knapp unter dem EU-Durchschnitt (77,5%). Während die Auslastung im EU-Durchschnitt im Vergleich zu 1980 etwa konstant blieb, sank sie in Österreich um 4,6% und lag damit 2003 bei 76,2% - wie oben bereits erwähnt ein Hinweis dafür, dass der Krankenanstaltensektor Überkapazitäten hat [Hofmarcher und Rack 2006].
2.4.3. Personelle Ressourcen
Zwischen 1995 und 1999 ist die Anzahl aller unselbständig Beschäftigten in Österreich um 1,3% gestiegen. Im gesamten Dienstleistungssektor betrug das Wachstum 5,2% und im Sektor Gesundheit, Veterinär- und Sozialwirtschaft 9,8%. 1999 waren 4,6% der unselbständig Beschäftigten in diesem Wirtschaftssektor tätig. In der Wirtschaftsklasse Gesundheit-, Veterinär- und Sozialwirtschaft sind jene Beschäftigten, die im Gesundheitsbereich der öffentlichen Verwaltung bzw. in den Sozialversicherungen tätig sind, nicht enthalten, sodass der Anteil der Beschäftigten im Gesundheitswesen unterschätzt ist. Das Gesundheitswesen ist ein wichtiger Arbeitsmarkt für Frauen. 100 männlich unselbstständig Beschäftigten in dieser Wirtschaftsklasse standen 1999 367 Frauen gegenüber. Das Verhältnis beträgt bei Betrachtung aller unselbständig Erwerbstätigen 100 Männer zu 77 Frauen [OECD Berichte 1999].
1997 betrug die Gesamtzahl der in ausgewählten Berufgruppen im Gesundheitswesen beschäftigten Personen 103784. Gegenüber 1970 war sie mehr als viermal so hoch. 1997 waren 32% der hier einbezogenen Beschäftigten Ärzte, 41,4% Pflegepersonal. Die Gesamtzahl der berufstätigen Ärzte stieg zwischen 1970 und 1997 um 140%. 1997 waren etwa doppelt so viele Krankenpfleger tätig wie 1970. Die Anzahl der medizinisch-technischen Dienste stieg mit über 300% am stärksten. In Bezug auf die Angestellten in Krankenanstalten war der Beschäftigtenstand 1997 3,5 mal höher als 1970. 1997 waren 19% des Krankenhauspersonals Ärzte, fast 50% waren Pflegepersonen. Der Anteil der Sanitätshilfsdienste betrug etwa 20% aller Angestellten, jener der medizinisch-technischen Dienste etwa 11% [European Observatory 2001].
Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Zahlen für ausgewählte Berufsgruppen bis 2003
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3: Ausgewählte Berufsgruppen im österreichischen Gesundheitswesen, 1970-2003
2.5. Verwendung der Finanzmittel im Gesundheitssystem
Die Quantifizierung der Finanzströme im österreichischen Gesundheitswesen erweist sich durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen (mittelbare Bundesverwaltung) und den damit einhergehenden Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern als sehr schwierig. Die Mittel für das Gesundheitswesen werden zum überwiegenden Teil über Beiträge und Steuern (etwa 70%) aufgebracht. Private Haushalte finanzieren etwa 30%. Die Einhebung von Kostenbeteiligungen und Selbstbehalten als Finanzierungsquelle wurde in den letzten Jahren immer bedeutsamer [European Observatory 2001].
2.5.1. Budgetsetzung und Ressourcenallokation
Gemäß Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (VGR) wurden 1998 15,71 Mrd. Euro (ATS 216,2 Mrd.) für den Gesundheitsbereich ausgegeben. Aufgrund der Vielfältigkeit der Strukturen im österreichischen Gesundheitswesen lassen sich weder auf der Anbieterseite noch auf der Nachfrageseite die Zahlungsströme exakt zuordnen. Die in unten stehender Abbildung veranschaulichten Zahlungsströme zeigen im Wesentlichen die Verwendungszwecke und geben somit nur Hinweise auf die Finanzierungsströme.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Finanzierungsströme im Gesundheitswesen
Alle Angaben beziehen sich auf die geltende Finanzierungsgebarung. Innerhalb des öffentlichen Sektors ist die Sozialversicherung der größte Finanzierungsträger und verwendete etwa 70% der öffentlichen Gesundheitsausgaben; Länder und Gemeinden zahlen etwa 20%; der Bund 0,5% [Hofmarcher 1999].
In der Folge wird auf den Budgetprozess für den stationären Bereich näher eingegangen. Dies zum einen, weil er der größte Bereich im Gesundheitswesen ist und zum anderen deshalb, da sich durch die Gesundheitsreform der institutionelle Rahmen bzw. die Finanzierungsströme in diesem Segment neu geordnet haben.
Das Kapitel Gesundheit im Bundesbudget umfasste 1998 etwa 821,2 Mio. Euro (ATS 11,3 Mrd.). Anteilig am gesamten Volumen des Gesundheitswesens liegen in der Budgethoheit des Bundes demnach etwa 5,2%. Mit diesen Mitteln versucht der Bund steuernd auf den Krankenanstaltensektor und damit auf das Gesundheitswesen insgesamt einzuwirken. Etwa die Hälfte der Gesundheitsausgaben in Österreich wird vom Krankenanstaltensektor verbraucht. Zusammen mit den Sozialversicherungen, die etwa die Hälfte der Ausgaben für die Krankenanstalten finanzieren, steht im Budgetprozess für den Krankenanstaltenbereich der Bund den Ländern, Gemeinden bzw. den privaten Eigentümern gegenüber. Aufgrund der Kompetenzverteilung in der Bundesverfassung beschränkt sich die Bundeskompetenz jedoch auf die Wahrnehmung von Steuerungsfunktionen (vgl. Kapitel 2.2 Struktur und Management des Gesundheitssystems) [European Observatory 2001].
Zwischen Bund und Ländern werden regelmäßig Finanzausgleichsverhandlungen geführt. Das Gesamtbudget für die Krankenanstalten, welches von den Krankenversicherungsträgern, von den Ländern und Gemeinden und vom Bund aufgebracht wird, ist dann Bestandteil dieser Finanzausgleichsverhandlungen, wenn der Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern (Art. 15a B-VG Vereinbarung über die Reform des Gesundheitswesens und der Krankenanstaltenfinanzierung) neu abgeschlossen wird. Der letzte bedeutsame Vertrag wurde 1997 für eine Zeitdauer von 4 Jahren abgeschlossen. In diesem Sinn wurde 1997 mit dieser Vereinbarung, dessen Herzstück die Umstellung der Finanzierung im Krankenanstaltensektor war, die Rahmenbedingungen geschaffen, um das größte Leistungssegment im Gesundheitswesen einer globalen Budgetkontrolle zu unterstellen und alle Financiers des Gesundheitswesens dabei einzubinden. Das Krankenanstaltengesetz des Bundes (B-KAG) enthält einen Versorgungsauftrag für die Länder. Nach den Finanzverfassungsgesetzen aus dem Jahr 1948 obliegt es als Pflichtaufgabe grundsätzlich den Ländern, die Kosten für die Errichtung und die Erhaltung von geeigneten Krankenanstalten zu tragen. Außerdem sieht das B-KAG vor, dass sich die Länder, neben den Gemeinden und Eigentümern an der laufenden Finanzierung der öffentlichen Krankenanstalten beteiligen (§34 KAG). Für die Behandlung der Versicherten und deren Angehörigen in den öffentlichen Krankenanstalten wird seitens der Krankenversicherungen ungefähr ein Drittel der Beitragseinnahmen ausgegeben. 1998 umfasste dieser Betrag etwa 2,69 Mrd. Euro (ATS 37 Mrd.), 1999 betrug er 2,81 Mrd. Euro [European Observatory 2001].
2.5.2. Finanzierung von Krankenhäusern
Seit 1997 wurden etwas weniger als drei Viertel des Leistungsgeschehens im Krankenanstaltenbereich prospektiv abgegolten. Etwa 30% werden retrospektiv nach Tagessätzen abgerechnet. Die Tagessatzabrechnung erfolgt z.B. im Bereich der Psychiatrie für die halb-stationäre Behandlung [European Observatory 2001].
Im Jahr 2000 werden 6,1% der Bundesmittel über die Umsatzsteuer finanziert, 6,9% zahlen die Länder (4,1%) und Gemeinden (2,8%) aus dem Umsatzsteueraufkommen. Zusammen mit den zusätzlich pauschalierten Mitteln des Bundes werden vom Bundesbudget 465,6 Mio. Euro (ATS 6,41 Mrd.) oder 12,8% der gesamten Mittel für die Krankenanstaltenfinanzierung aufgebracht. 3,5% der Mittel jährlich fließen in den Strukturfonds. Nach Abzug einiger Pauschalbeträge wird die Restsumme gemäß definierter Quoten an die Landesfonds verteilt [European Observatory 2001].
Die Mittel der sozialen Krankenversicherung für die Finanzierung der öffentlichen Krankenhäuser belaufen sich im Jahr 2000 auf etwa 2,9 Mrd. Euro (ATS 40 Mrd.). Gegenüber 1997 wurde der Betrag von ATS 37 Mrd. auf ATS 40 Mrd. valorisiert. Mit dieser Pauschalsumme sind sowohl der stationäre Aufenthalt als auch alle Leistungen der Spitalsambulanzen abgegolten. Die Höhe dieses Budgets ist prospektiv fixiert und steigt unter der Voraussetzung steigender Beitragseinnahmen. 1998 wurden von der sozialen Krankenversicherung etwa 30% der Gesamtausgaben für Krankenanstalten verwendet. Anteilig am Bruttoinlandsprodukt betrug der Finanzierungsaufwand der Sozialversicherung 1998 etwa 1,5% [BM f. Gesundheit und Soziales 2000].
Die gesamten Mindestmittel für die Dotierung der Landesfonds betragen im Jahr 2000 3,64 Mrd. Euro (ATS 50 Mrd.). Der klinische Mehraufwand ist ein Errichtungs- und Erweiterungsbeitrag des Bundes an jene öffentlichen Krankenanstalten, die gleichzeitig als Ausbildungsstätten der medizinischen Fakultäten in Wien, Graz und Innsbruck fungieren. Somit ergibt sich insgesamt eine Summe von 3,99 Mrd. Euro (ATS 55 Mrd.). Dies entspricht etwa 2% des Bruttoinlandsproduktes 1998. In diesem Finanzierungsmodus sind etwa die Hälfe aller Krankenanstalten einbezogen, in denen etwa 70% der Bettenkapazitäten und 85% des Personals konzentriert sind (Fondskrankenanstalten). Mit diesem Betrag ist etwa die Hälfte der Kosten für die Fondskrankenanstalten abgedeckt, die verbleibende Hälfte wird von den Krankenhauseigentümern aufgebracht [European Observatory 2001], [BM f. Gesundheit und Soziales 2000].
Durch die Nutzung landesgesetzlicher Spielräume entstand eine Vielfalt von Abrechnungsformen. Die Wahlmöglichkeiten führten dazu, dass weniger als die Hälfte der österreichweit für die Finanzierung der Krankenanstalten benötigten Mittel über die Landesfonds verteilt wird. So werden beispielsweise in fünf Bundesländern die Eigentümermittel in die Fonds eingespeist. Dadurch erfolgt die Krankenhausfinanzierung grundsätzlich nur über Fonds. Trotzdem wird ein allenfalls entstandener Ausgabenüberschuss noch außerhalb der Landesfonds durch den jeweiligen Eigentümer finanziert. In zwei Bundesländern wird der Eigentümeranteil an der Finanzierung außerhalb der Landesfonds aufgebracht. In den zwei verbleibenden Bundesländern wird ein Teil der Eigentümermittel in die Landesfonds einbezahlt, der Rest wird außerhalb abgewickelt. In allen Bundesländern werden Investitions- und Betriebskosten grundsätzlich getrennt. Die Finanzierung der privaten, nicht gemeinnützigen Spitäler wurde durch die Sozialversicherung gesondert geregelt [European Observatory 2001]. Diese Krankenanstalten erhielten für 1997 ein Budget von 65,41 Mio. Euro (ATS 900 Mio.). Dieser Betrag ist ebenfalls prospektiv fixiert. Insgesamt konsumiert der Krankenanstaltensektor in Österreich etwas weniger als die Hälfte der Gesundheitsausgaben [BM f. Gesundheit und Soziales 2000].
2.5.3. Politische Zielvorgaben der Gesundheitsreformen
Die Zielsetzungen der Gesundheitsreformen in den 1990er Jahren und dabei insbesondere das Ziel, die Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens nachhaltig sicherzustellen, sind in dem gesamtwirtschaftlichen Ziel der Budgetkonsolidierung eingebettet, nachdem Österreich 1998 mit dem Eintritt in die Wirtschafts- und Währungsunion der EU auch die aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt resultierende Verpflichtung zu einem „Quasi-Nulldefizit“ übernommen hat [Hofmarcher und Rack 2006].
Die österreichischen Reformbemühungen zur Konsolidierung und Kostendämpfung in den 1990er Jahren konzentrierten sich – wie in allen Industrieländern – darauf, die langfristige Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems (v.a. durch Zuzahlungen und leistungsorientierte Bezahlformen und Budgets) sicher zu stellen. Auch die Gesundheitsreform 2005 orientierte sich an der Sicherstellung der Finanzierbarkeit des österreichischen Gesundheitswesens durch Maßnahmen zur Kostendämpfung (Erhöhung der Beitragssätze, Anhebung der Höchstbemessungsgrundlage, Erhöhung der Tabaksteuer,…) und Effizienzsteigerung bzw. Steuerung (Steigerung der tagesklinischen Behandlungen, Bettenreduktion, Vermeidung von Doppelgleisigkeiten, Senkung von Kosten im patientenfernen Bereich, Strukturreformen (Bundesgesundheitskommission, Landesgesundheitsfonds,…), Gesundheitsqualitätsgesetz, Vereinheitlichung der Dokumentation, Gesundheitstelematik, …) im Gesundheitswesen[4] [Hofmarcher und Rack 2006].
Die folgende Tabelle (nach [Hofmarcher und Rack 2006]) zeigt überblicksmässig die Schwerpunktsetzung in den Gesundheitsreformen seit 1997 sowie deren Zielfunktionen (Zugang, Qualität und Effektivität, nachhaltige Finanzierung):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 4: Schwerpunktsetzung in den Gesundheitsreformen 1977-2005
3. Innovationstheorien
3.1. Einführung
Die Wurzeln von Wissenschaft und Technik reichen bis in das Altertum zurück; schon damals spielten zwei Dinge gleichermaßen eine Rolle: Erkenntnisgewinn und Wohlstandsmehrung. Aufgrund der schon damals offensichtlichen Kopplung des technischen Fortschritts an ökonomisches Wohlergehen stand für die frühen Neuerer die Bedeutung der Wissenschaft für ökonomischen und sozialen Fortschritt außer Frage [Grupp 1997].
Die Anfänge dessen, was man als Innovationsforschung bezeichnen kann, kann auf die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts datiert werden. In diesem Zeitraum wurden Innovationen nicht nur erfolgreich vorgebracht, sondern auch die zugrunde liegenden Prozesse beschrieben. Die Erkenntnisse dieses Zeitraums sind untrennbar mit dem Namen Schumpeter verbunden [Schumpeter 1911].
Aufgrund der „Verwissenschaftlichung der Technik“ bzw. der sog. „Science-Based Industry“ in den vergangenen Jahren ist es gerade innerhalb der Innovationsforschung nicht mehr ausreichend, nur den technischen Wandel zu berücksichtigen. Vielmehr müssen gleichermaßen Fortschritte in den Wissenschaften und ihre Beziehungen zur Technik analysiert werden. Gerade interdisziplinäre Aspekte über einzelne Forschungsdisziplinen hinweg spielen in der Innovationsforschung eine immer bedeutendere Rolle. Innovationsaktivitäten im Unternehmen sind meist nur eingeschränkt rational. Die Grenzen der Rationalität[5] liegen z.B. in begrenzter Kompetenz oder im Mangel an vollständiger Information [Grupp 1997].
In weiterer Folge soll zunächst auf eine Begriffsbestimmung eingegangen werden. Im Anschluss sollen neben einer überblicksmäßigen Darstellung eines funktionalen Referenzschemas der Innovation vor allem auf ein Schema der Entstehung innovativer Märkte eingegangen werden, welches im späteren Verlauf dieser Arbeit zur Einordnung der aufgezeigten Trends herangezogen wird. Ebenso soll im Lauf dieses Kapitels ein kurzer Abriss des Stands der Innovationstheorie gegeben werden.
3.2. Begriffsbestimmungen
Unter Wissenschaft wird die Schaffung, Entdeckung, Überprüfung, Zusammenstellung, Umorganisation und Verbreitung von Wissen über die physikalische, biologische oder soziale Natur verstanden [Kline und Rosenberg 1986]. Technologie ist das Wissen über die Lehre oder die Wissenschaft von der Nutzbarmachung der Naturwissenschaften für den Menschen [Lenk 1979]. Jedoch bezieht sich „Technologie“ oftmals nicht nur auf die Lehre (oder die Wissenschaft) von der Technik, da im Englischen die Begriffe „Technologie“ und „Technik“ mit „technology“ weitgehend identisch gebraucht. Aufgrund der Tatsache, dass ein Großteil der Literatur aus dem Englischen stammt, wird auch im Deutschen vermehrt „Technologie“ als identisch zu „Technik“ verstanden. Technik ist aber nicht nur das Wissen über die Anpassung wissenschaftlicher Ergebnisse, sondern jede zweckmäßige Handlung, Methode, Arbeitsweise und Kunstfertigkeit zur Nutzbarmachung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse [Grupp 1997].
Aus Sicht der sozialwissenschaftlichen Systemtheorie [Luhmann 1988] besteht die Gesellschaft aus sozialen Systemen, die jeweils autonom reagieren. Die Systemtheorie betrachtet die jeweiligen Differenzen zwischen den Subsystemen und deren Umwelt. Der Argumentation von Stankiewicz [Stankiewicz 1992] folgend, ist die Technik ein autonomes, sozio-kognitives Subsystem und kann daher mit dem wissenschaftlichen oder dem ökonomischen Subsystem in Konflikt treten. Bernal erkannte als einer der ersten die verschiedenen „langen Wellen“ wirtschaftlicher Entwicklung (siehe dazu auch [Nefiodow 2001]) und die Tatsache, dass jeweils verschiedene Sektoren die Träger von Fortschritt und Wachstum waren. Sein wesentlicher Beitrag zur Innovationsforschung und anderen Sozialwissenschaften war seine klare Vorstellung zur Professionalisierung des Forschungsprozesses im Unternehmen, zur Organisiertheit von Forschung und Entwicklung, zur zentralen Bedeutung der Allokation von Ressourcen für den Forschungsprozess, die verbundenen wissenschaftlichen und technischen Dienste und ihr effizientes Management [Grupp 1997].
Forschung und Entwicklung (FuE) ist die systematische, schöpferische Arbeit zur Erweiterung des Kenntnisstandes, einschließlich der Erkenntnisse über den Menschen, die Kultur und die Gesellschaft sowie deren Verwendung mit dem Ziel, neue Anwendungsmöglichkeiten zu finden [Grupp 1997]; man unterscheidet:
- Grundlagenforschung: d.i. experimentelle oder theoretische Arbeit zur Gewinnung neuer Erkenntnisse;
- Angewandte Forschung: d.s. Untersuchungen, um neues Wissen zu gewinnen;
- Experimentelle Entwicklung: d.i. systematische Arbeit, die auf existierendem Wissen aufbaut.
FuE werden als treibende Kraft für das Innovationsgeschehen angesehen. Wissenschaft und Technik wird dabei oft von FuE durch eine institutionelle Abgrenzung unterschieden; mit diesem Verständnis ist wissenschaftliche Forschung diejenige FuE, die sich außerhalb der Unternehmen vollzieht. Der Begriff „Wissenschaft“ schließt die Hochschullehre ein, während FuE für die Produktion von Wissen steht [Essig 1977]. Es empfiehlt sich jedoch, die Begriffe „Wissenschaft“ und „Technik“ als soziale Subsysteme zu sehen und von FuE (einer ökonomischen Tätigkeit) abzugrenzen und die Begriffe nicht mit einem institutionellen Ansatz zu erklären; Forschung ist nicht gleich Wissenschaft und experimentelle Entwicklung nicht gleich Technik [Grupp 1997].
Innovation bezieht sich auf eine realisierte Menge von Ideen; man kann in diesem Sinne Innovation als diskretes Ereignis verstehen. Innovieren bezeichnet als Verb den zugehörigen Entwicklungsprozess. Im Bereich der Wirtschaftswissenschaften setzt vor allem die ergebnisorientierte Begriffsbildung durch Schumpeter Maßstäbe (Stichwort: Innovationsrenten) [Grupp 1997]. Innovationsrenten sind Faktorrenten, welche sich im Zeitablauf aufgrund des Wirkens von Konkurrenzprozessen wieder aufheben, sie können in Form neuer Konsumgüter, neuer Produktions- oder Transportmethoden, neuer Märkte oder neuer Organisationen auftreten [Schumpeter 1942]. Ein ausführlicherer Definitionsversuch erfolgt in Kapitel 3.3.
Weiters können sequentielle und rückgekoppelte Modelle unterschieden werden:
Während Schumpeters Denkmodell davon ausgeht, dass neue wissenschaftliche Ergebnisse zur Technologie werden und diese dann zur Innovation, welche anschließend über Märkte diffundiert, sind vor dem Hintergrund der Systemtheorie (nach der Wissenschaft, Technik und Wirtschaft in Konflikt treten können) rückgekoppelte Modelle zweifellos als realitätsnäher anzusehen, können jedoch ebenfalls nicht ausreichend erklären, warum Innovationen überhaupt zustande kommen, denn Rückkoppelung alleine führt ohne mikroökonomisches Kalkül nicht notwendigerweise zum Zustandekommen von Neuerungen [Grupp 1997][6].
3.3. Definitionsversuche und Kriterien für „Innovation”
Bei Innovationen geht es um etwas Neuartiges: Neuartig ist mehr als neu, es bedeutet eine Änderung der Art, nicht nur dem Grad nach. Es geht um neuartige Produkte, Verfahren, Vertragsformen, Vertriebswege, Werbeaussagen, Corporate Identity. Innovation ist wesentlich mehr als eine graduelle Verbesserung und mehr als ein technisches Problem [Hamel 1996].
Im Folgenden soll, angelehnt an Hauschildt und Salomo [Hauschildt und Salomo 2007], ein Überblick über ausgewählte Ansätze zur Definition gegeben werden.
Innovation als neuartige Produkte oder Prozesse der Tatsache und dem Ausmaß der Neuartigkeit nach:
- „An innovation is ... any thought, behaviour or thing that is new because it is qualitatively different from existing forms.“ [Barnett 1953]
- „Die Innovation ist eine signifikante Änderung im Status Quo eines sozialen Systems, welche, gestützt auf neue Erkenntnisse, soziale Verhaltensweisen, Materialien und Maschinen, eine direkte und / oder indirekte Verbesserung innerhalb und / oder außerhalb des Systems zum Ziel hat. Die Systemziele selbst können auch Gegenstand der Innovation sein.“ [Aregger 1976]
Innovation als neuartige Produkte oder Prozesse der Erstmaligkeit nach:
- „When an enterprise produces a good or service or uses a method or input, that is new to it, it makes a technical change. The first enterprise to make a given technical change is an innovator. Its action is innovation.“ [Schmookler 1966]
- „Als Innovationen sollen alle Änderungsprozesse bezeichnet werden, die die Organisation zum ersten Mal durchführt.“ [Kieser 1969]
- „An innovation is an invention brought to its first use, its first introduction into the market.“ [Vedin 1980]
Innovation als neuartige Produkte oder Prozesse der Wahrnehmung nach:
- „An innovation is an idea, practice or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption. It matters little, so far as human behaviour is concerned, whether or not an idea is „objectively“ new... . The perceived unit of the idea for the individual determines his or her reaction to it. If the idea seems new to the individual, it is an innovation.“ [Rogers 1983]
- „... We consider as an innovation any idea, practice, or material artefact perceived to be new by the relevant unit of adoption. The adopting unit can vary from a single individual to a business firm, a city, or a state legislature.“ [Zaltman et al. 1984]
Innovation als neuartige Kombination von Zweck und Mitteln:
- Daraus wird deutlich, dass mit Innovation eigentlich das Ergebnis zweier Prozesse beschrieben wird. Auf der einen Seite steht der potenzielle Wandel der Verfügbarkeit bzw. des Angebots von Problemlösungen durch neue Ideen, Erfindungen und Entdeckungen, auf der anderen Seite die Nachfrage nach Problemlösungen, die ebenfalls veränderlich ist. Werden beide Seiten zur Deckung gebracht, also eine Anwendung bzw. Verwendung erreicht bzw. durchgesetzt, wobei auf mindestens einer Seite etwas „Neues“ auftritt, so spricht man von Innovation.“ [Pfeiffer und Staudt 1975]
- „Most generally, innovation can be seen as the synthesis of a market need with the means to achieve and produce a product to meet that need.“ [Moore und Tushman 1982]
- „Innovation is a process whereby new ideas are put into practice. ... To be more specific it is the process of matching the problems (needs) of systems with solutions which are new and relevant to those needs...“ [Rickards 1985]
Innovation als Verwertung neuartiger Produkte oder Prozesse:
- „... innovation = invention + exploitation. The invention process covers all efforts aimed at creating new ideas and getting them to work. The exploitation process includes all stages of commercial development, application, and transfer, including focusing of ideas or inventions towards specific objectives, evaluating those objectives, downstream transfer of research and/or development results, and the eventual broad-based utilization, dissemination, and diffusion of the technology-based outcomes.“ [Roberts 1987]
- „Liegt eine Erfindung vor und verspricht sie wirtschaftlichen Erfolg, so werden Investitionen für die Fertigungsvorbereitung und die Markterschließung erforderlich, Produktion und Marketing müssen in Gang gesetzt werden. Kann damit die Einführung auf dem Markt erreicht werden oder ein neues Verfahren eingesetzt werden, so spricht man von einer Produktinnovation oder einer Prozessinnovation.“ [Brockhoff 1992]
Innovation als Prozess:
- „Unter einer Innovation soll hier der gesamte Prozess der Erforschung, Entwicklung und Anwendung einer Technologie verstanden werden. Dieser Prozess besteht definitionsgemäß also aus mehreren logisch aufeinander folgenden Phasen (Subprozessen), die sich analytisch unterscheiden lassen.“ [Uhlmann 1978]
- „Innovation from idea generation to problem-solving to commercialization is a sequence of organizational and individual behaviour patterns connected by formal resource allocation decision points.“ [Goldhar 1980]
Innovation als neuartige Dienstleistungen jenseits industrieller Produkte und Prozesse:
- „Unter Innovationen werden pauschal betrachtet Neuerungen verstanden. Dabei können insbesondere Finanzinnovationen (z.B. neu Wertpapiertypen), Sozialinnovationen (z.B. gleitende Arbeitszeit), Marktinnovationen (Durchdringung neuer Absatz- und Beschaffungsmärkte), Organisationsinnovationen (z.B. Spartenkonzept, Holdingkonzern), Produktinnovationen und Verfahrensinnovationen (Prozessinnovationen) unterschieden werden.“ [Chmielewicz 1991]
- „Innovation is defined as adoption of an internally generated or purchased device, system, policy, program, process, product or service that is new to the adopting organization.“ [Damanpour 1991]
Man erkennt, dass aufgrund der vorliegenden Vielfalt die Gefahr von Missverständnissen besteht; eine Einordnung der Begriffsbestimmungen all dessen, was innovativ genannt werden soll, anhand klar bestimmter Kriterien sollte daher unmissverständlich vorgenommen werden [Hauschildt und Salomo 2007].
Alle genannten unterschiedlichen Ansätze zielen in erster Linie auf die Neuartigkeit ab. Innovation ist aber mehr als nur Invention; zu Beginn der 1970er Jahre wurde intensiv diskutiert, ob diejenigen Innovationen erfolgreicher sind, die zweckinduziert von der Nachfrage stimuliert („demand pull“) oder mittelinduziert vom Angebot angestoßen („technology push“) werden. Da sich herausgestellt hat, dass diese monokausale Sichtweise unrealistisch ist, kann ganz allgemein gesagt werden, dass erfolgreiche Innovationen auf der Zusammenführung von „demand pull“ und „technology push“ beruhen. Eine Verknüpfung zwischen Zweck und Mittel von Innovationen hat sich auf dem Markt oder im innerbetrieblichen Einsatz bewährt, das reine Hervorbringen der Idee genügt nicht, gerade die Parameter Verkauf oder Nutzung unterscheiden Innovation von Invention [Hauschildt und Salomo 2007].
Damit stellt sich die Frage nach den Dimensionen der Innovation, welche folgend – angelehnt an die Methodik und Hauschildt und Salomo [Hauschildt und Salomo 2007] – betrachtet werden sollen.
3.3.1. Inhaltliche Dimension
3.3.1.1. Produkt- und Prozessinnovationen
Die vorherrschende Sicht in den Innovationstheorien unterscheidet „Produktinnovationen“ und „Prozessinnovationen“; es sind sowohl Ziel- als auch Durchsetzungsaspekt beinhaltet [Hauschildt und Salomo 2007]:
- Unter dem Gesichtspunkt des Zielaspektes sind Prozessinnovationen neuartige Faktorkombinationen, durch die die Produktion eines Gutes kostengünstiger, qualitativ hochwertiger, sicherer oder schneller erfolgen kann. Ziel dieser Innovation ist die Steigerung der Effizienz.
- Bei Produktinnovationen geht es aber nicht nur um den Kombinations-, sondern auch um den Verwertungsprozess am Markt. Eine Produktinnovation offeriert Leistungen, die es dem Benutzer erlauben, neue Zwecke oder vorhandene Zwecke besser oder in anderer Weise zu erfüllen. Ziel dieser Innovation ist die Steigerung der Effektivität (was nicht ausschließt, dass daneben auch noch Effizienzgewinne realisiert werden).
- Unter dem Durchsetzungsaspekt sind Produktinnovationen in einem Markt, Prozessinnovationen idR „nur“ innerbetrieblich durchzusetzen (wenn man davon absieht, dass ein Unternehmen Prozessinnovationen am Markt verwertet)
Damit erscheinen Produktinnovationen zunächst schwerer durchsetzbar als Prozessinnovationen; empirische Befunde belegen aber eher das Gegenteil:
Prozessinnovationen sind stärker mit dem Gesamtsystem verzahnt und dadurch komplexer („tacit knowledge“), da der innovative Fortschritt schlechter erkennbar ist [Gopalakrishnan et al. 1999]. Sie werden daher langsamer und weniger bereitwillig übernommen als Produktinnovationen [Damanpour und Gopalakrishnan 2001].
Eine klare Trennung von Produkt- und Prozessinnovation ist nicht immer möglich und wird daher zunehmend hinterfragt (siehe beispielsweise bei [Totterdell et al. 2002], [Voeth und Gawantka 2005] oder [Schuh und Friedli 2005]), bei Dienstleistungsinnovationen fallen Produkt- und Prozessinnovation meist zusammen.
3.3.1.2. Innovationen der Systemeigenschaften
Man kann die Betrachtung des Innovationsinhaltes dadurch erweitern, indem man unter dem Gesichtspunkt eines Systemtheoretischen Ansatzes die Zahl und die Verzahnung der Elemente des innovativen Produktes oder Prozesses berücksichtigt [Shenhar 1998].
Man bestimmt zunächst umfassend das System selbst und unterscheidet:
- innovative Systemkomponenten (Teileinheiten, durch die ein bestehendes Produkt ergänzt oder verbessert wird, z.B. ein verbesserter Monitor für eine Befundungsworkstation)
- innovative Systeme (neuartige Produkte oder Prozesse, die von Grund auf neu entwickelt werden, z.B. ein Operationsroboter)
- innovative Systemverbünde (Vernetzung mehrerer eigenständiger, neuartiger Systeme, z.B. eine österreichweite elektronische Gesundheitsplattform)
Diese Unterscheidung ist vor allem für die Steuerung von Prozessen interessant.
Bei genauerer Detailbetrachtung lassen sich zwei weitere Varianten von Innovationen unterscheiden [Henderson und Clark 1990]:
Die Innovation betrifft dann
- entweder neue Systemkomponenten („modular innovation“) unter Beibehaltung der gegebenen Verknüpfungen (z.B. neuartige Software)
- oder die Schaffung neuer Systemverknüpfungen („architectural innovation“) unter Beibehaltung der gegebenen Systemkomponenten (z.B. neuartige Software, die zusätzliche Informationen und Regelwerke beinhaltet)
Schließlich können Systemkomponenten oder -verknüpfungen nach ihrer Relevanz differenziert und geordnet werden:
- Kernkomponenten (hochrangig, für das Gesamtsystem relevant, z.B. die CPU eines PCs)
- Peripherkomponenten oder -verknüpfungen (nachrangig, z.B. Monitor eines PCs)
3.3.1.3. Innovationen jenseits der Technik
Für Schumpeter ist das Wesen der Innovation die „Durchsetzung neuer Kombinationen“, die diskontinuierlich auftritt [Schumpeter 1939]. Schumpeters Typologie verlagert den Blick von technischen oder technologischen Gesichtspunkten auf eine ganzheitliche Sicht; Innovation ist nicht nur ein naturwissenschaftliches oder technisches Problem, sie ist darüber hinaus ein Problem der Ökonomie und Managementlehre; Märkte und Organisation sind somit gleichrangig mit Technik und Produktion zu setzen. Damit rückt der Aspekt der Innovation als „schöpferisch-destruktiver Prozess“ in den Vordergrund; sie löst vorhandene Produkte oder Verfahren ab, stellt geltendes Herrschaftswissen in Frage und zerstört eingespielte Beziehungen, setzt aber konstruktiv an die Stelle des Alten etwas Neues [Hauschildt und Salomo 2007].
Zahn und Weidler [Zahn und Weidler 1995] haben unter Rückgriff auf den Ansatz Schumpeters drei Dimensionen des „integrierten Innovationsmanagements“ erfasst:
- technische Innovationen: Produkte, Prozesse, technisches Wissen
- organisatorische Innovationen: Strukturen, Kulturen, Systeme
- geschäftsbezogene Innovationen: Erneuerung des Geschäftsmodells, der Branchenstruktur, der Marktstrukturen und –grenzen, der Spielregeln
3.3.1.4. Postindustrielle Systeminnovationen
Die traditionelle Sichtweise, dass Innovationen vorzugsweise industriell und innerbetrieblich auftreten, wird in der aktuellen Betrachtungsweise erweitert: Gerade in bis dato nicht oder wenig betrachteten Branchen findet ebenso Innovation statt. Neben Innovationen in Banken, im Handel, in der öffentlichen Verwaltung [Thom und Ritz 2000] und des Sports rücken vor allem umweltorientierte Prozessinnovationen [Schwarz und Höllweger 2001] in Innovationen in der Informations- und Kommunikationswirtschaft [Picot 1998] in den Vordergrund.
Derartige Innovationen erfolgen in einem Netzwerk vielfältiger Kooperationsbeziehungen; die Zahl der Kooperationspartner ist groß, umfasst viele Branchen, schließt Dienstleistungsunternehmen mit ein und erfordert oftmals die Integration von Behörden und öffentlichen Verwaltungen. Diese Art von Innovationen werden postindustrielle Systeminnovationen genannt [Hauschildt und Salomo 2007].
3.3.2. Intensitätsdimension
Das Ausmaß der Neuartigkeit kann vielfältig bestimmt werden [Hauschildt und Salomo 2007]:
- Neu der Tatsache nach: Ein Lösung zur Bestimmung der Erstmaligkeit eines Produktes oder Prozesses könnte darin liegen, die technische Erfindungshöhe im Rahmen eines Patentverfahrens feststellen zu lassen. Neben Unschärfeproblemen innerhalb des Verfahrens stellt sich die Frage nach dem Ausmaß der Innovation jedoch auch bei vielen Neuerungen, die nicht patentiert werden sollen oder können. Hierzu werden weitere Konzepte benötigt.
- Neu dem Grade nach: Die Bestimmung der Neuheit einer Innovation der Tatsache nach reicht oftmals nicht aus, vielmehr ist eine Aussage über den Innovationsgrad wünschenswert; man soll den graduellen Unterschied gegenüber dem bisherigen Zustand mess- und bewertbar machen. Neben der Aufteilung nach Dichotomien, Ordinalskalen oder Scoring bieten sich vor allem auch Multidimensionale Ansätze oder Konsequenzanalysen für die Betrachtung an. Für eine detaillierte Betrachtung sei beispielsweise auf Hauschildt und Salomo [Hauschildt und Salomo 2007] verwiesen.
3.3.3. Subjektive Dimension
Eine Einschätzung der qualitativen Unterschiede der Innovation ist naturgemäß subjektgebunden und kann allenfalls objektiviert, nicht aber objektiv bestimmt werden. Neben der tatsächlichen technischen Basis ist vor allem die Wahrnehmung des Unterschiedes von großer Bedeutung. Innovation ist somit das, was für innovativ gehalten wird [Hauschildt und Salomo 2007].
Die Frage des Subjekts, das die Einschätzung des innovativen Zustandes vornimmt, ist somit maßgeblich; je nachdem ob es sich um Experten, Führungskräfte, die jeweilige Branche, eine jeweilige Nation oder sogar die Menschheit handelt, kann das Ergebnis verschieden ausfallen Für eine detaillierte Ausführung sei ebenso auf Hauschildt und Salomo [Hauschildt und Salomo 2007] verwiesen.
3.3.4. Prozessuale Dimension
Wie bereits erwähnt ist Innovation mehr als nur Invention; selbst die Invention ist nicht der erste Schritt in einem Prozess, der zu einer Innovation führt. Nach Hauschildt und Salomo [Hauschildt und Salomo 2007] lässt sich dieser idealtypisch in folgende Schritte unterteilen:
1. Idee/Initiative (Entschluss, sich mit einem bisher nicht näher bekannten Gegenstand zu beschäftigen)
2. Entdeckung/Beobachtung (Feststellung einer Auffälligkeit bzw. einer Abhängigkeit)
3. Forschung (theoretische Fundierung und empirische Überprüfung)
4. (gegebenenfalls) Erfindung (definierte Merkmale und exakt beschreibbare Eigenschaften, die zur Patentierung geeignet sind)
5. Entwicklung (Umsetzung der Ergebnisse in Konstruktionen bzw. Prototypen)
6. Verwertungsanlauf (Produkt- bzw. Verfahrenseinführung, Umsetzung in eine wirtschaftlich nutzbare Form)
7. laufende Verwertung (Serienproduktion)
Somit kann der Innovationsbegriff nach der jeweilig gerade durchlaufenen Stufe differenziert werden
3.3.5. Fazit
Wirkliche Innovationen bzw. der Innovationsgrad einer Neuerung können erst im Nachhinein exakt erfasst werden. Im ersten Augenblick, wenn man sich mit bisher nicht bekannten Produkten, Verfahren, etc. beschäftigt, weiss die Unternehmung bzw. der Entscheidungsträger in der Regel noch nicht, ob die Neuheit später mit dem Begriff „Innovation“ belegt wird. Die birgt einerseits Risiken, eröffnet andererseits aber ebenso Chancen, d.h. mit anderen Worten, dass am Anfang des Innovationsmanagements das Innovationsbewusstsein steht [Hauschildt und Salomo 2007].
Da innovative Materie definitionsgemäß keinen Vorläufer hat, kann der Entscheidungsträger die Konsequenzen seiner Entscheidung nicht überschauen. Neben den zu treffenden Einschätzungen spielt aber auch das unternehmerische Umfeld eine Rolle: in einem turbulenten Unternehmensumfeld wird ein anderes Innovationsbewusstsein existieren als in einem stabilen.
3.4. Funktionales Referenzschema der Innovation
Bezugnehmend auf das von Grupp [Grupp 1997] vorgestellte Referenzschema werden vier Merkmale deutlich, die das Modell charakterisieren:
- die innovationsgerichteten Stadien weisen starke Rückkoppelungen auf;
- FuE stellen keine Einheit dar, sondern zerfallen in verschiedene Prozesse, die explizit benannt werden können;
- das Wechselspiel zwischen den FuE- und den Innovationsprozessen ist funktional aufzufassen;
- die zeitliche Dimension ist sensibel für das Fortschrittsverständnis, wobei ebenfalls explizit verschiedene Stadien angegeben werden können.
Das funktionale Referenzschema von Grupp [Grupp 1997] erfüllt alle genannten Anforderungen; es ist in Abbildung 4 graphisch dargestellt, die zeitliche Achse ist dabei nicht zu erkennen (siehe dazu Kapitel 3.5).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Referenzschema gekoppelter Fortschrittsfunktionen nach Grupp [Grupp 1997]
Auf der vertikalen Achse sind vier idealtypische innovationsgerichtete Stadien dargestellt; idealtypisch deshalb, weil im Normalfall keine eindeutigen Grenzen zwischen diesen gezogen werden können.
Eine mögliche Funktion der FuE-Prozesse ist es, zu verbesserten Theorien zu führen; dadurch werden Ideen realisiert und Entdeckungen gemacht. Eine andere Funktion von FuE ist die Hervorbringung technisch funktionsfähiger Konzeptionen. Unter Konstruktion wird verstanden, dass FuE-Tätigkeiten über die technische Funktionalität hinaus Fragen der Kosten, Preise, Herstellungsprozesse, Gewährleistung, Einhaltung von Standards und anderes mehr berücksichtigen („Produkt-Design“). Innovation findet nur in Unternehmen statt, welches die industrielle FUE als erstes mit einem neuen Produkt zu Ende bringt. Die Diffusion schließlich schließt die Verbreitung von neuem Wissen als auch die Nachahmung von Innovation (Imitation) mit ein. Mit der wachsenden Umweltproblematik stellt sich nunmehr vermehrt die Fragen nach Nutzung und Entsorgung von neuen Produkten, hier spielt die Idee der so genannten Technikfolgenabschätzung eine Rolle [Grupp 1997]. Krupp [Krupp 1996] z.B. weist auf das Problem hin, dass die langfristige Stabilisierung der Wirtschaft eine Umorientierung der Innovationsvorgänge auf die Energie- und Umweltproblematik erforderlich macht.
Alle Stadien der wissensbasierten, technologischen Innovation werden von wissenschaftlich oder technisch ausgebildeten Personen ausgeführt und sind daher in ihrer Gesamtheit an den Vorrat an Wissen gekoppelt. Ebenso werden potentiell alle FuE-Arten benötigt, um Innovationen hervorzubringen. Im funktionalen Referenzschema wird FuE als eine Art der Problemlösung verstanden, auf die zu jedem Zeitpunkt des Innovationsprozesses zurückgegriffen werden kann [Grupp 1997].
3.5. Schema der Entstehung innovativer Märkte
Das in Abbildung 4 dargestellte Schema weist bisher noch keine Zeitachse auf. Da sich die zeitlichen Aspekte in einem geschlossenen Modell nur schwer darstellen lassen, sollen dieser getrennt dargestellt werden. Aufgrund der Tatsache, dass FuE als Begleiter von Innovationsprozessen verstanden wird, und die Beziehungen zueinander die Interaktion von Wirtschaftssubjekten repräsentiert, wird deutlich, dass entstehende Märkte nicht als „S-Kurven“ modelliert werden können, sondern vielmehr die Rückkoppelungen des Modells zu einem Auf und Ab führen. In einer frühen Phase werden durch starke FuE-Tätigkeit die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse versuchsweise realisiert. Die tatsächliche Nachfrage nach Innovationen spielt in dieser Phase keine große Rolle, die Nachfragepräferenzen formen sich erst im Lauf der Zeit aus der Vielfalt technisch denkbarer Lösungen heraus. Eine idealtypische Marktentstehung des vorgestellten Referenzmodells wird in Abbildung 5 aufgezeigt; es wird dabei eine feste Beziehung zwischen dem Ausmaß von Wissenschaft, Technik und Produktion unterstellt, die allerdings nicht in jedem Einzelfall gleichermaßen gelten muss [Grupp 1997].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5:Standardisiertes Schema zur Einordnung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts bei der Marktentstehung nach Grupp [Grupp 1997] (die Kurvenverläufe stellen ein willkürliches Beispiel dar)
Die dargestellten Situationen sind so definiert, dass jeweils zwei benachbarte zu den Innovationsstadien der Abbildung 4 passen: in den ersten beiden Stadien werden Prinzipien wissenschaftlich erklärt. In den Phasen 3 und 4 kommen FuE-Akteure dazu, während in den Phasen 5 und 6 Innovationen hervorgebracht werden. In den beiden letzten Phasen kommt es zur breiten Nutzung und allgemeinen Verwendung von neuen Produkten und Verfahren. Die Stadien 1 bis 4 liegen dabei vor der üblicherweise an den Beginn des Lebenszyklus eines Produkts gesetzten Innovationsphase; dieser entsprechen die Phasen 5 und 6 [Grupp 1997].
Bezüglich einer weiterführenden Vertiefung sowie einer Klärung offener Fragen in Bezug auf Messung und Bewertung des Modells sowie dessen Gültigkeit sei auf Grupp [Grupp 1997] verwiesen.
Ebenfalls soll auf die zahlreiche bereits vorhandene Literatur zum Thema Innovation hingewiesen werden; neben Grupp ist für eine vertiefende Analyse vor allem auf Hauschildt und Salomo [Hauschildt und Salomo 2007], Nefiodow [Nefiodow 2001] u.a. hinzuweisen.
Für die weitere Ausführung dieser Arbeit und Einordnung der vorgestellten Trends erscheint die Tiefe der dargestellten Ausführung ausreichend.
3.6. Stand der Innovationstheorie
3.6.1. Überblick und klassische Ansätze
Es gibt eine Reihe von Schulen ökonomischen Denkens zum technischen Fortschritt. Die nachstehende Abbildung gibt einen einfachen Überblick über die Innovationsökonomik. Unter Einbeziehung der aus den Sozialwissenschaften bekannten systemtheoretischen Ansätzen lässt sich der Ansatz auf die Innovationsforschung ausdehnen. Das Referenzschema von Grupp (siehe Kapitel 3.4) kann in der Form charakterisiert werden, dass es ausgehend von nicht-mathematisch formulierten, systemanalytischen Zusammenhängen unter Zulassung von Rückkoppelungen in die aus den ökonomischen Innovationstheorien bekannten funktionalen Zusammenhänge die neuesten Erkenntnisse aus der sozialwissenschaftlichen Technikgeneseforschung soweit als möglich einbezieht [Grupp 1997].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Überblick über formale Theorien und andere Ansätze der Innovationsforschung und Innovationsökonomik
In verschiedenen Beiträgen zur Innovationsforschung wird definiert, dass die Modellbildung entweder „neoklassisch“ [Stadler 1993] oder „evolutorisch“ [Schwitalla 1993] erfolgt, dabei ist eine sachliche Einordnung innovationswissenschaftlicher Arbeiten in eine der beiden Kategorien nicht eindeutig möglich; sie folgt eher Konventionen als strengen wissenschaftssystematischen oder –logischen Ansprüchen – denn während neoklassische Ansätze eher die Eigenschaften von Gleichgewichtszuständen in ökonomischen Systemen intensiver behandeln, haben evolutorische Ansätze gemeinsam, dass die Prozesse, die zu Gleichgewichtszuständen führen, genauer beschrieben werden, oft ohne die Eigenschaften des Endzustandes anzugeben [Grupp 1997].
Zu den „Klassikern“ der Innovationsforschung gehören zweifellos A. Smith und K. Marx. Adam Smith wies bereits 1776 darauf hin, dass „jedes Individuum ein immer größerer Experte im Arbeitsbereich wird … und die Menge an Naturwissenschaft beträchtlich anwächst“ [Smith 1776]. Das Modell ist jedoch sehr exogen geprägt und die Erklärungen an die physikalische Welt angelehnt – es wirken Kräfte zwischen Angebot und Nachfrage, die von einer unsichtbaren Hand – den „Marktkräften“ geleitet werden. Die fundamentalen Unterschiede zwischen Physik und Ökonomie, die aus dem bewussten und willkürlichen Handeln von Individuen resultieren, spielen bei Smith keine Rolle [Clark und Juma 1988]. Für Karl Marx führt der Kapitalismus zur Expansion des wirtschaftlichen Geschehens, weil das System Anreize bietet und Institutionen hervorbringt, die den technischen Wandel beschleunigen und Kapital akkumulieren. Neben dem technischen Wandel betonte Marx in seinen Werken die Wissenschaft als notwendige Voraussetzung für neue Maschinen, Produktionsmethoden bzw. neue Technologie [Grupp 1997].
Schumpeter folgerte aus den Arbeiten von Marx, dass der kapitalistische Wirtschaftsprozess auf der fortwährenden Veränderung der Produktion beruht, und daher von der Dynamik des technischen Wandels lebt. Er stellt den Unternehmer als Wirtschaftssubjekt mit einem ganz bestimmten Verhalten ins Zentrum seiner Betrachtung; der Schumpetersche Unternehmer ist immer bereit zur Risikoübernahme und zeigt dauernden Mut zur Innovation (dem gegenüber stehen die „Wirte“, die ihre Aufgaben pflichtbewusst und verwaltungsmäßig erledigen) [Schumpeter 1911]. Seine „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ wurde weder von ihm selbst, noch von anderen Ökonomen, mathematisch formalisiert.
3.6.2. Neoklassische mikroökonomische Ansätze und neue Wachstumstheorie
Die neoklassische Innovationstheorie wurde von Schumpeter beeinflusst und hat mikro- und makroökonomische Ausprägungen erfahren. In der Neoklassik sind Produzenten mengenanpassend; die Nachfragemenge richtet sich nach individuellen Nutzenkalkülen der Haushalte. In der neoklassischen Theorie geht es um Mengen und Preise, nicht um die Produktqualität oder Produktionsverfahren. Die seit den 1960ern auftretenden mikroökonomischen, neoklassischen Ansätze stützen sich zwar weiterhin auf den rationalen, gewinnmaximierenden Unternehmer, beziehen aber neben Preisen und Produktionsmengen auch Forschung und Entwicklung (FuE) mit ein. Als wesentliche Elemente neoklassischer Innovationstheorien stellen sich somit Elemente der Wettbewerbstheorie, der Entscheidungstheorie und der Spieltheorie heraus [Grupp 1997].
Einige Beispiele dazu sind [Grupp 1997]:
- Arrows Wettbewerbstheorie: Diese hebt die Marktstruktur als bedeutende Variable hervor. Demzufolge bietet vollkommener Wettbewerb einen größeren Innovationsanreiz als ein Monopol.
- Von Hayeks Wettbewerbstheorie: Diese untersucht die Bedeutung des Wissens in der Ökonomie und bezieht sich auf die Kapazität von Unternehmen, durch die Marktmechanismen informiert zu sein, welche Güter oder Dienstleistungen nachgefragt werden.
- Kantzenbachs Wettbewerbstheorie: Diese argumentiert, dass die optimale Wettbewerbsintensität und die bestmöglichen Marktergebnisse bei mäßiger Produktdifferenzierung und dem Vorliegen eines Oligopols mit nicht zu geringer Anbieterzahl erreicht werden.
- Grossekettlers Koordinationsmängelkonzept: Die empirische Konzeption eignet sich für das Aufspüren nicht-funktionsfähiger Märkte mit der jedoch auch die Qualität neuer Produkte geprüft werden kann. Im Rahmen dieses Konzepts ist auch ein Zusammenhang zwischen Marktstruktur und Fortschrittsrate darstellbar.
- Entscheidungstheorie und Innovation: In Fortführung der neoklassischen Ansätze bildeten sich entscheidungstheoretische Überlegungen heraus, die für das Innovationsgeschehen typische Phänomene wie Unsicherheit, Dynamik, Externalität u.a. berücksichtigen.
- Spieltheorie und Innovation: Spieltheoretische Ansätze können als Fortführung der entscheidungstheoretischen angesehenen werden, weil es mit ihnen möglich wird, einige Wechselwirkungen zwischen FuE-Entscheidungen der Unternehmen einzubeziehen. Das Modell zieht darauf ab, die Frage zu klären, welche Marktstruktur zu einem gesellschaftlich optimalen Umfang von FuE führt.
- Neoklassische Wachstumstheorie: Hier spielt der technische Fortschritt als Wachstumsdeterminante eine wichtige Rolle, der Schwerpunkt der Argumentation liegt auf den Wirkungen des technischen Wandels, nicht so sehr auf seinem Entstehungszusammenhang.
- Neue Wachstumstheorie: Diese geht davon aus, dass die Wirtschaftssubjekte bei der Bildung ihrer Erwartung an die zukünftige Entwicklung verschiedener ökonomischer Variablen alle verfügbaren Informationen zugrundelegen und dabei systematische Fehler ausschließen. Wirtschaftseinheiten stellen nun auch an den technischen Fortschritt Erwartungen, d.h. es wurde eine Endogenisierung des technischen Fortschrittes in das Modell vollzogen.
Als Kritik über neoklassische Innovationstheorien kann gesagt werden, dass diese nicht alle für eine Innovationserklärung wichtigen Aspekte plausibel abbilden können. Arrows nimmt beispielsweise an, dass die Erfindung außerhalb des betrachteten Industriezweigs gemacht und dann an diesen verkauft wird. Der entscheidungstheoretische Ansatz von Kamien und Schwartz geht davon aus, dass das betrachtete Unternehmen ein einziges neues Gut entwickelt und damit ein einziges altes ersetzt. Als Ergebnis der Bemühungen, die neoklassischen Innovationstheorien empirisch zu bestätigen hat man die Erkenntnis gewonnen, dass der technische Fortschritt nicht mit einem einzigen Parameter erfasst und quantitativ gemessen werden kann [Grupp 1997].
3.6.3. Institutionen- und evolutionsökonomische Ansätze
Die Institutionenökonomik geht davon aus, dass nicht nur Marktmechanismen, sondern auch der institutionelle und organisatorische Aufbau einer Volkswirtschaft für eine effektive Allokation der Ressourcen, sowie die Verteilung der Einkommen betrachtet werden müssen. Bezogen auf die Innovationsforschung wird nicht nur die Bildung von Institutionen und die sich verändernden Beziehungen zwischen dem ökonomischen und dem Rechtsystem betrachtet, sondern auch die Wirkung des technischen Wandels auf die institutionelle Struktur. Bei Untersuchungen zu letzterem findet sich häufig der Begriff „evolutorische Ökonomik“, in der es nicht um die ganze Breite der Institutionenökonomik sondern speziell um die Wechselwirkungen zwischen Innovationsvorgängen und institutionellen Strukturen geht [Grupp 1997].
Diese Wirtschaftsforschung als Schumpeter-Nachfolge aufzufassen liegt nahe, da Schumpeter das Wirtschaftsgeschehen als evolutionären Prozess dargestellt hat, dessen Triebkräfte die Innovation in Form neuer Konsumgüter, neuer Produktions- und Transportmethoden, neuer Märkte und neuer industrieller Organisationen sind (zusammenfassend in [Clark und Juma 1988], [Rahmeyer 1993], [Schwitalla 1993]).
3.6.4. Nachfragetheoretische Ansätze
Die Nachfrage nach einem Gut regelt sich aus seinem Preis im Vergleich zu anderen Gütern sowie dem Einkommen. In Zusammenhang mit dem Innovationsthema ist daher unter nachfragetheoretischen Aspekten die Produktinnovation im Zentrum des Interesses. Führt ein Unternehmen innovative Güter in seinem Produktionsprozess ein, so ist hierfür die Bezeichnung Prozessinnovation üblich [Grupp 1997].
Unter einer Produktinnovation versteht man entweder ein substantiell neues oder eine wesentliche Leistungsverbesserung bei einem existierenden Produkt; eine Prozessinnovation hingegen bezeichnet die Einführung neuer oder wesentlich verbesserter Produktionsmethoden (siehe dazu Kapitel 3.3). In den meisten der bisher erwähnten Innovationstheorien findet sich diese Entscheidung nicht, diese erscheint jedoch für nachfragetheoretische Ansätze unabdingbar, auch wenn eine klare Trennung oftmals nicht möglich erscheint, da beispielsweise Produkt- und Prozessinnovation gleichzeitig auftreten können oder die Produktinnovation eines Sektors die Prozessinnovation eines anderen Sektors ist (z.B. kann ein neuartiger Roboter für den Hersteller eine Produktinnovation sein, für den Anwender in der Medizin eine Prozessinnovation) [Grupp 1997]. In einer Studie von Archibugi [Archibugi et al. 1994] wird festgestellt, dass nur 3,1% der beobachteten Innovationen eindeutig klassifiziert werden konnten, während 96,9% in eine Grauzone fallen.
Es besteht jedoch ein Unterschied zwischen Produkt- und Prozessinnovationen, der an den Eigenschaften des hergestellten Produktes festgemacht wird: Prozessinnovationen ändern die Eigenschaften des Produktes nicht, sondern nur seine Herstellkosten, während Produktinnovationen sich in veränderter Leistungscharakteristik, zusätzlichen Eigenschaften oder in einem gänzlich neuen Produkt äußern [Cohen und Klepper 1992].
Aufgrund dieser Überlegungen lässt sich ein hoher Stellwert der Produkteigenschaften bei der Fortschrittsmessung und ihrem Zusammenhang mit der Nachfrage feststellen [Grupp 1997].
Gemessene Produkteigenschaften werden üblicherweise unter dem Schlagwort „Produktqualität“ zusammengefasst. Nach der DIN-Norm 55350 ist die Qualität „die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen eines Produkts, die sich auf dessen Eignung zur Erfüllung angegebener Erfordernisse bezieht“ [Cuhls 1993].
3.7. Fazit und Einordnung des funktionalen Referenzschemas von Grupp
Die verschiedenen – aus der Beobachtung von Realphänomenen des technischen Fortschrittes abzuleitenden – funktionalen Anforderungen (Unterscheidung verschiedener FuE-Typen, Einbezug der wissenschaftsbasierten Technik, Zulassung von Produkt- und Prozessinnovationen, Rückkoppelungen,…) an eine Endogenisierung des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts können im Rahmen der neoklassischen Modelle erst in den jüngsten Erweiterungen ansatzweise abgebildet werden. Die evolutionstheoretischen Ansätze sind der neoklassischen Betrachtung zwar dahingehend überlegen, dass sie eine Bewertung des Konkurrenzmechanismus beinhalten, jedoch wird einerseits kein mathematisches Lösungsmodell vorgelegt und andererseits scheint vollständiger Wettbewerb für die Modelle nicht ideal zu sein (die innovatorische Vielfalt führt meist zu unvollständiger Konkurrenz) [Grupp 1997].
Wichtige Impulse für ein funktionales Innovationsverständnis ergeben sich aus nachfragetheoretischen Ansätzen (z.B. angelehnt an das Eigenschaftsbündel von Lancaster, siehe dazu [Lancaster 1991] oder [Grupp 1997]), da die Darstellung und Messung der Eigenschaften von Produkten / Innovationen zentral wird.
Von den nichtmathematischen Innovationstheorien erscheint besonders Dosis Innovationsmodell für das vorgestellte Referenzschema hilfreich zu sein, da er die wichtigsten Zusammenhänge des sektoralen und unternehmensspezifischen technischen Wandels formuliert [Grupp 1997].
In Abbildung 7 wird die Einordnung des Referenzschemas in die Formulierung von Dosi versucht: Im Kern findet sich das in Kapitel 3.4 vorgestellte Referenzschema, links davon die Determinanten, die für die konkurrierenden Unternehmen gleich sind und rechts diejenigen, die selektiv auf sie wirken. In Ergänzung sind noch ausdrücklich die Nachfragepräferenzen und die Orientierung von innovativen Produkten mit mutmaßlich großer Nachfrage einbezogen. Ebenfalls wurden die nichtindustrielle FuE-Infrastruktur im öffentlichen Bereich, die Bindung zur Wissenschaft und die wettbewerblichen Rahmenbedingungen eingebaut [Grupp 1997].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Einordnung des funktionalen Referenzschemas in die ökonomischen Grundstrukturen (nach [Grupp 1997])
Für die in späterer Folge (Kapitel 6) vorgestellten Trends erscheint es sinnvoll, diese schematisch in das vorgestellte Referenzschema einzubauen, um einerseits den aktuellen technologischen Status abzubilden und um andererseits aufgrund des „noch zu gehenden Weges“ bis zur Marktreife (und damit der Erreichung von zumindest Stadium 7 oder 8 in der in Abbildung 5 skizzierten Grafik) abschätzen zu können[7]. Im Kapitel 6.11 wird daher versucht, die vorgestellten Innovationspotentiale mit einer kurzen Beschreibung hinsichtlich der Einordnung in das Referenzschema zu klassifizieren.
3.8. Dimensionen der Innovation im Gesundheitswesen
Die zentralen aktuellen und zukünftigen Herausforderungen an das Gesundheitssystem, etwa neu auftretende Krankheitsbilder, neue Diagnose- und Behandlungsansätze und offene Finanzierungsfragen, können nur durch Innovation bewältigt werden [Metaforum 2007].
Durch die Fokussierung der vorherrschenden Diskussion auf kurzfristige Kosten- und Nutzenaspekte und dadurch entstehende Hindernisse in der effizienten Einführung von neuen Behandlungsmethoden und Versorgungsstrukturen werden weitere wichtige Dimensionen für eine angemessene Bewertung von Innovationen im Gesundheitswesen vernachlässigt [Bührlen und Kickbusch 2008].
Die für das Gesundheitssystem bedeutsamen gesellschaftlichen Gruppen haben mitunter gegensätzliche Interessen. Damit Entwickler, Zulassungsbehörden, Leistungsträger, Bürger und Politiker, Kliniken, Ärzte und Patienten dennoch Entscheidungen treffen können, ist ein Verständnis von Innovation im Gesundheitswesen nötig, das alle wichtigen Aspekte abdeckt und von allen Beteiligten akzeptiert wird [Bührlen und Kickbusch 2008].
Oftmals sind dafür unaufgelöste Zielkonflikte zwischen verschiedenen Handlungs- und Politikfeldern, z.B. die Begrenzung von Ausgaben gegenüber wirtschaftlichen Potentialen, die Hindernisse in der Entwicklung und Einführung von neuen Medikamenten, Behandlungsmethoden, Versorgungsstrukturen, etc. darstellen. Daher stellt sich die Frage, welche Erwartungen die verschiedenen am Innovationsprozess Beteiligten an eine neue Technologie haben, damit sie als nützliche Innovationen angesehen wird [Bührlen 2008].
3.8.1. Innovationsprozess
Innovationen (z.B. verstanden als neue Behandlungsmethoden) haben ihren Ursprung üblicherweise in der Grundlagenforschung, schreiten fort über präklinische und klinische Forschung hin zu einem Produktmuster, für das die Marktzulassung beantragt werden kann. Nach Erteilung derselben kann mit Produktion und Vertrieb gestartet werden; die Nachfrage im Gesundheitsbereich wiederum ist stark von der Kostenerstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen abhängig. Eine schematische Darstellung des gezeigten Innovationsprozesses findet sich in folgender Abbildung [Bührlen 2008].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Innovationsprozess im Gesundheitswesen
Das gezeigte Schema stellt jedoch keinen linearen Ablauf dar, der Prozess enthält zahlreiche Rückkopplungsmechanismen; z.B.:
- Wird nur eine geringe Nachfrage erwartet, kann unter Umständen auf die klinische Forschung verzichtet werden.
- Läuft der Vertrieb schlecht, wird die Produktion gedrosselt.
- Je nach Ergebnis der klinischen Forschung müssen weitere präklinische Studien vorgenommen oder sogar in der Grundlagenforschung neue Ansätze entwickelt werden.
Der Innovationsprozess kann dadurch verkompliziert werden, dass bei jedem Schritt verschiedene Interessensgruppen Einfluss nehmen (z.B. Patientengruppen, die sich für mehr Forschung für eine bisher nicht behandelbare Krankheit einsetzen; Krankenkassen, die ihre Versicherten kostengünstiger versorgen lassen wollen; Kliniker, die die Nachfrage mitbestimmen; oder die Politik, die über Forschungsförderung, aber auch über Interventionen der Zulassungs- und Erstattungsmechanismen, Preisbildung usw. Einfluss auf das gesamte System nimmt) [Bührlen 2008].
[...]
[1] Der stärkere Anstieg der Rate in Österreich ist teilweise darauf zurückzuführen, dass die Daten teilweise ambulant in Krankenhäusern behandelte Fälle enthalten.
[2] Pflegehelfer können erst ab 1998 gesondert ausgewiesen werden (vorher waren diese bei Sanitätshilfsdiensten inkludiert)
[3] Index 2000 = 100
[4] Für eine detaillierte Auflistung der Inhalte der angesprochenen Reform sei auf Hofmarcher und Rack, S.220ff [Hofmacher und Rack 2006] verwiesen.
[5] Der Begriff „eingeschränkte Rationalität“ wurde vom Ökonomen Herbert Simon geprägt. Allerdings hat sich eine präzise Modellierung dieser Idee als schwierige Aufgabe erwiesen und der Ansatz hat bisher keinen nachhaltigen Einfluss auf die ökonomische Theorie genommen [Holler und Illing 1993]. Erst in den letzten Jahren hat sich die Spieltheorie mit Modellen zur Einschränkung der Rationalität beschäftigt. Für weitere Informationen sei beispielsweise auf Grupp [Grupp 1997] verwiesen.
[6] Für eine detaillierte Ausführung sei hier auf Grupp [Grupp 1997] bzw. Nefiodow [Nefiodow 2001] verwiesen.
[7] Was in Bezug auf eine formal-mathematische Methode jedoch explizit nicht Teil dieser Arbeit sein soll, da in weiterer Folge nur Handlungsalternativen im Dienstleistungsprozessbereich gezeigt werden, ohne eine formale Messung vorzunehmen. Für einen technometrischen Ansatz und Grundzüge im Bereich der Messung von technischem Fortschritt sei beispielsweise auf Grupp [Grupp 1997] verwiesen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Auswirkungen haben neue Technologien auf das Gesundheitswesen?
Technologien wie eHealth, elektronische Krankenakten und Entscheidungsunterstützungssysteme steigern die Effizienz, verbessern die Koordination zwischen Ärzten und Spitälern und transformieren die Arzt-Patient-Beziehung.
Was sind die Vorteile der elektronischen Krankenakte?
Sie fördert die Informationstransparenz, unterstützt das Behandlungsmanagement durch klinische Pfade und ermöglicht eine bessere Vernetzung aller beteiligten Akteure im Gesundheitswesen.
Was versteht man unter eHealth-Anwendungen?
eHealth umfasst telematische Anwendungen in der Patientenversorgung, Forschung, Aus- und Weiterbildung sowie Programme zum Disease Management und Home Monitoring.
Wie verändert das Internet die Arzt-Patient-Beziehung?
Patienten nutzen das Internet verstärkt zur Information, was zu einer stärkeren Einbindung des Kunden in den Dienstleistungsprozess und zu einer Partnerschaft auf Augenhöhe mit dem Arzt führen kann.
Was ist integrierte Versorgung?
Integrierte Versorgung zielt auf eine sektorenübergreifende Vernetzung (z.B. zwischen Hausarzt und Fachklinik) ab, um Behandlungsabläufe durch Clinical Pathways effizienter zu gestalten.
Welche Rolle spielt „Mobile Health“ im Krankenhaus?
Mobile Health nutzt WLAN, Bluetooth und mobile Endgeräte für die Visite, Datenübertragung und Prozessoptimierung direkt am Patientenbett.
- Citation du texte
- Mag. Dr. Hannes Moser (Auteur), 2008, Auswirkungen neuer Technologien auf das Unternehmen im Gesundheitswesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205223