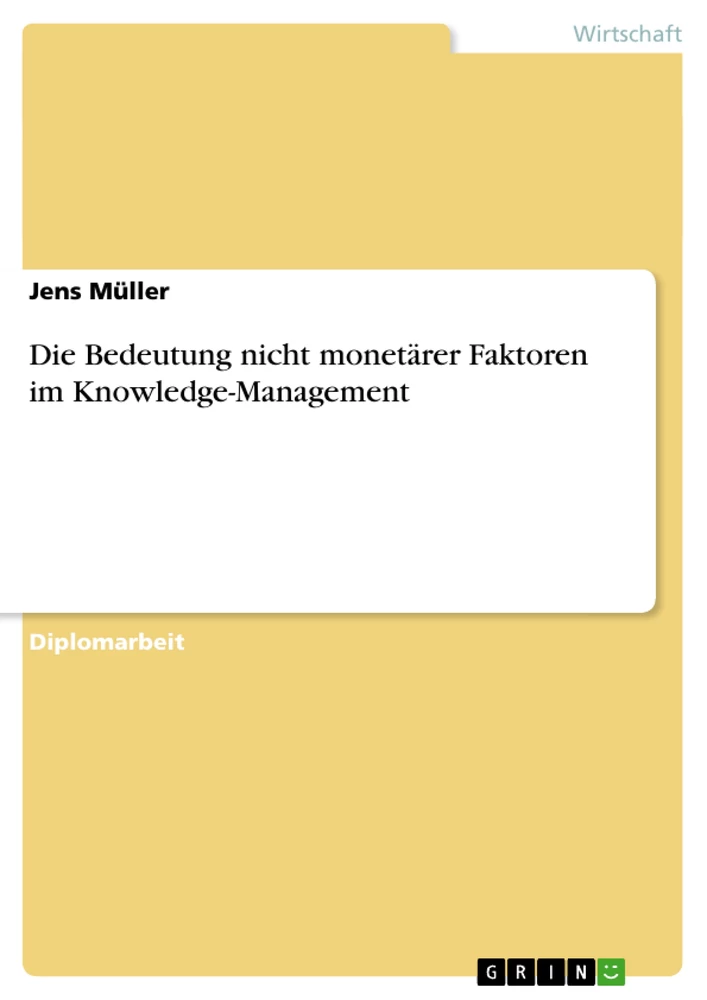„Die wirtschaftliche Abhängigkeit der Unternehmen von verfügbarem Wissen, die rasche Zunahme von Wissen allgemein und die schnelle Alterung von Wissen stellen für Unternehmen ernsthafte Kosten- und für deren Mitarbeiter Motivationsprobleme dar. Unternehmen, denen es nicht gelingt, das Management von Wissen sowohl effektiv als auch effizient zu gestalten, laufen Gefahr, ihre Wettbewerbsposition einzubüßen.“ Der Umgang mit Wissen muss demnach vom Unternehmen im Rahmen des Wissensmanagements aktiv gesteuert werden.
Knowledgemanagement, oder auch Wissensmanagement, ist ein sehr diffuser Begriff. Häufig wird Wissen als „der vierte Produktionsfaktor“ oder „die wichtigste Ressource des Unternehmens“ bezeichnet. Die meisten Organisationen haben jedoch noch kein gesteuertes und auswertbares Wissensmanagement. Einer der Gründe liegt sicherlich darin, dass Wissen eine im Controlling nur schwer abbildbare Größe darstellt und damit im Gegensatz zu finanzwirtschaftlichen Indikatoren die klassischen Steuerungsinstrumente nicht ohne weiteres angewendet werden können.
Steuerung basiert im Unternehmensalltag auf definierten Kennzahlen. Aber wie soll die Ressource Wissen gesteuert werden, wenn Wissen mit finanziellen Indikatoren, wie dem Wiederbeschaffungswert oder über die Differenz zwischen Marktwert und Buchwert gemessen werden? Beide Größen sagen nichts über die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit aus. Sie stellen nicht den Wert des Wissens für das Unternehmen dar, sondern den Versuch, auch Wissen als wertvolles Gut darzustellen und finanziell zu bewerten. Für die Steuerung der Ressource Wissen müssen andere, nicht finanzielle Faktoren, zu Hilfe genommen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wissen
- 2.1 Entstehung von Wissen
- 2.1.1 Individuelles Lernen
- 2.1.2 Individuelles Wissen
- 2.1.3 Organisationales Lernen
- 2.1.4 Organisationales Wissen
- 2.2 Bedeutung des Lernens für die organisationale Wissensentwicklung
- 2.3 Bedeutung des Lernens für den Umgang mit Wissen in Organisationen
- 2.4 Die organisationale Wissensbasis
- 2.1 Entstehung von Wissen
- 3. Wissensmanagement
- 3.1 Ziele des Wissensmanagements
- 3.2 Konzepte des Wissensmanagements
- 3.2.1 Informatikorientierte Ansätze
- 3.2.2 Nach der Funktion der Wissensgenerierung
- 3.2.3 Ganzheitlicher Ansatz
- 3.2.4 Unterschieden nach individuellem und organisationalem Wissen
- 3.2.5 Personalwirtschaftlich
- 3.2.6 Kritische Würdigung der Ansätze
- 3.3 Wissensmanagement nach dem ganzheitlichen Ansatz
- 3.3.1 Strategisches Wissensmanagement im ganzheitlichen Ansatz
- 3.3.2 Operatives Wissensmanagement im ganzheitlichen Ansatz
- 3.3.2.1 Zielsetzung
- 3.3.2.2 Wissensidentifikation
- 3.3.2.3 Wissenserwerb
- 3.3.2.4 Wissensentwicklung
- 3.3.2.5 Verteilung des Wissens
- 3.3.2.6 Nutzung
- 3.3.2.7 Wissensbewahrung
- 3.3.2.8 Bewertung des Wissens
- 3.4 Modell der lernenden Organisation
- 4. Monetäre und nicht monetäre Faktoren
- 4.1 Kennzahlen und Controlling
- 4.2 Eigenschaften monetärer und nicht monetärer Faktoren
- 4.3 Ursache- und Wirkungszusammenhänge
- 4.4 Definition und Überprüfung von Ursache-Wirkungsbeziehungen
- 4.5 Bewertung nicht monetären Kapitals
- 4.6 Wert- und Leistungstreiber
- 4.7 Komplexität
- 4.8 Funktionen nicht monetärer Faktoren
- 4.8.1 Koordination
- 4.8.2 Integration
- 4.8.2.1 Zielsetzung
- 4.8.2.2 Maßnahmenplanung
- 4.8.2.3 Definition der Messgrößen
- 4.8.2.4 Erfolgsmessung
- 4.8.3 Information
- 4.8.4 Innovation
- 5. Nicht monetäre Faktoren im Wissensmanagement
- 5.1 Bewertung des intellektuellen Kapitals
- 5.2 Bedeutung nicht monetärer Faktoren in den Prozessschritten
- 5.3 Messung der wissensbedingten Einflüsse im Unternehmen
- 5.4 Wissensveränderungen messen
- 5.5 Darstellung im Beispiel
- 6. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Bedeutung nicht-monetärer Faktoren im Wissensmanagement. Ziel ist es, die Herausforderungen der Steuerung von Wissen als Ressource zu beleuchten, da klassische, finanzorientierte Kennzahlen hierfür ungeeignet sind. Die Arbeit analysiert alternative Bewertungsmethoden und zeigt den Einfluss nicht-monetärer Faktoren auf die Effizienz und Effektivität von Wissensmanagementprozessen.
- Bedeutung von Wissen als Ressource im Unternehmen
- Herausforderungen der Messung und Steuerung von Wissen
- Analyse nicht-monetärer Faktoren im Wissensmanagement
- Bewertungsansätze für nicht-monetäres Kapital
- Einfluss nicht-monetärer Faktoren auf Wissensmanagementprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Wissensmanagements ein und betont die Herausforderungen, die sich aus der wachsenden Bedeutung von Wissen und seiner schwierigen Messbarkeit ergeben. Sie hebt die Notwendigkeit hervor, neben monetären Faktoren auch nicht-monetäre Aspekte im Wissensmanagement zu berücksichtigen, da traditionelle finanzielle Kennzahlen die Komplexität von Wissen nicht erfassen können. Die Einleitung legt den Grundstein für die gesamte Arbeit, indem sie die Problematik der Wissensbewertung und -steuerung definiert und die Notwendigkeit einer umfassenderen Betrachtungsweise unterstreicht.
2. Wissen: Dieses Kapitel befasst sich grundlegend mit dem Begriff des Wissens, seiner Entstehung sowohl auf individueller als auch auf organisationaler Ebene. Es beleuchtet den Prozess des organisationalen Lernens und die Bedeutung des Lernens für die Entwicklung und den Umgang mit Wissen in Organisationen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der organisationalen Wissensbasis und deren Bedeutung für den Unternehmenserfolg. Die Kapitelteile bauen aufeinander auf und schaffen eine fundierte Basis für das Verständnis von Wissensmanagement.
3. Wissensmanagement: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Konzepte und Ansätze des Wissensmanagements, angefangen von informatikorientierten bis hin zu ganzheitlichen Ansätzen. Es analysiert deren Stärken und Schwächen und konzentriert sich schließlich auf den ganzheitlichen Ansatz, der als umfassendstes Modell betrachtet wird. Der ganzheitliche Ansatz wird detailliert in seine strategischen und operativen Komponenten zerlegt, wobei die einzelnen Prozessschritte (Zielsetzung, Wissensidentifikation, Wissenserwerb etc.) explizit beschrieben werden. Das Kapitel liefert ein detailliertes Verständnis der verschiedenen Wissensmanagement-Ansätze und legt den Schwerpunkt auf die Umsetzung des ganzheitlichen Ansatzes.
4. Monetäre und nicht monetäre Faktoren: Dieses Kapitel vergleicht monetäre und nicht-monetäre Faktoren im Kontext des Wissensmanagements. Es analysiert die Eigenschaften beider Kategorien, ihre Messbarkeit und ihre Bedeutung für die Steuerung von Unternehmensprozessen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Definition und Überprüfung von Ursache-Wirkungsbeziehungen, die für die Bewertung des Einflusses nicht-monetärer Faktoren unerlässlich sind. Es werden verschiedene Methoden zur Bewertung von nicht-monetärem Kapital vorgestellt und kritisch bewertet. Das Kapitel bildet den Kern der Arbeit, indem es die Notwendigkeit und die Methoden zur Berücksichtigung nicht-monetärer Faktoren im Wissensmanagement detailliert erläutert.
5. Nicht monetäre Faktoren im Wissensmanagement: Dieses Kapitel wendet die Erkenntnisse der vorherigen Kapitel auf konkrete Aspekte des Wissensmanagements an. Es untersucht die Bedeutung nicht-monetärer Faktoren in den einzelnen Prozessschritten des Wissensmanagements und beschreibt Methoden zur Messung und Darstellung des Einflusses von Wissen auf den Unternehmenserfolg. Es verdeutlicht die Anwendung der beschriebenen Konzepte anhand eines Beispiels und zeigt, wie nicht-monetäre Faktoren in der Praxis berücksichtigt werden können. Dieses Kapitel integriert die vorherigen Kapitel und bietet eine praktische Anwendung der theoretischen Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Wissensmanagement, nicht-monetäre Faktoren, intellektuelles Kapital, Wissensbewertung, Lernende Organisation, Kennzahlen, Controlling, Ursache-Wirkungszusammenhänge, Effizienz, Effektivität.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Nicht-monetäre Faktoren im Wissensmanagement
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die Bedeutung nicht-monetärer Faktoren im Wissensmanagement. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Steuerung von Wissen als Ressource, da klassische, finanzorientierte Kennzahlen hierfür ungeeignet sind. Die Arbeit analysiert alternative Bewertungsmethoden und zeigt den Einfluss nicht-monetärer Faktoren auf die Effizienz und Effektivität von Wissensmanagementprozessen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Bedeutung von Wissen als Ressource im Unternehmen, die Herausforderungen der Messung und Steuerung von Wissen, die Analyse nicht-monetärer Faktoren im Wissensmanagement, Bewertungsmethoden für nicht-monetäres Kapital und den Einfluss nicht-monetärer Faktoren auf Wissensmanagementprozesse. Sie umfasst eine detaillierte Beschreibung verschiedener Wissensmanagement-Ansätze, insbesondere den ganzheitlichen Ansatz, sowie eine Analyse monetärer und nicht-monetärer Faktoren und deren Zusammenhänge.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Wissen (inkl. Entstehung und Bedeutung von Wissen), Wissensmanagement (inkl. verschiedener Konzepte und des ganzheitlichen Ansatzes), Monetäre und nicht-monetäre Faktoren (inkl. Kennzahlen, Controlling und Bewertung nicht-monetären Kapitals), Nicht-monetäre Faktoren im Wissensmanagement (inkl. Bewertung des intellektuellen Kapitals und Messung wissensbedingter Einflüsse) und Ausblick. Jedes Kapitel baut auf dem vorherigen auf und liefert detaillierte Informationen zu den jeweiligen Themenbereichen.
Welche Arten von Wissensmanagement-Ansätzen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Wissensmanagement-Ansätze, darunter informatikorientierte Ansätze, funktionsorientierte Ansätze (nach der Funktion der Wissensgenerierung), einen ganzheitlichen Ansatz und Ansätze, die nach individuellem und organisationalem Wissen unterscheiden. Der Fokus liegt auf dem ganzheitlichen Ansatz, der detailliert in seine strategischen und operativen Komponenten zerlegt wird.
Wie werden nicht-monetäre Faktoren im Wissensmanagement bewertet?
Die Arbeit analysiert Methoden zur Bewertung nicht-monetären Kapitals und untersucht den Einfluss dieser Faktoren auf die einzelnen Prozessschritte des Wissensmanagements (Zielsetzung, Wissensidentifikation, Wissenserwerb, Wissensentwicklung, Verteilung, Nutzung, Wissensbewahrung, Bewertung). Sie beschreibt Methoden zur Messung und Darstellung der Einflüsse von Wissen auf den Unternehmenserfolg und zeigt die Anwendung der Konzepte anhand eines Beispiels.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter, die die Arbeit prägnant beschreiben, sind: Wissensmanagement, nicht-monetäre Faktoren, intellektuelles Kapital, Wissensbewertung, lernende Organisation, Kennzahlen, Controlling, Ursache-Wirkungszusammenhänge, Effizienz und Effektivität.
Welche Herausforderungen werden im Zusammenhang mit der Messung und Steuerung von Wissen angesprochen?
Die Arbeit hebt die Herausforderungen hervor, die sich aus der wachsenden Bedeutung von Wissen und seiner schwierigen Messbarkeit ergeben. Traditionelle finanzielle Kennzahlen erfassen die Komplexität von Wissen nicht ausreichend. Die Arbeit betont daher die Notwendigkeit, neben monetären Faktoren auch nicht-monetäre Aspekte zu berücksichtigen.
Wie wird der ganzheitliche Ansatz des Wissensmanagements beschrieben?
Der ganzheitliche Ansatz wird detailliert in seine strategischen und operativen Komponenten zerlegt. Die operativen Komponenten umfassen die Prozessschritte: Zielsetzung, Wissensidentifikation, Wissenserwerb, Wissensentwicklung, Verteilung des Wissens, Nutzung, Wissensbewahrung und Bewertung des Wissens. Jeder Schritt wird explizit beschrieben.
Welche Rolle spielt das organisatorische Lernen in der Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des organisationalen Lernens für die Entwicklung und den Umgang mit Wissen in Organisationen. Sie beschreibt den Prozess des organisationalen Lernens und dessen Einfluss auf die organisationale Wissensbasis.
- Citation du texte
- Diplom-Kaufmann (FH) Jens Müller (Auteur), 2002, Die Bedeutung nicht monetärer Faktoren im Knowledge-Management, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20525