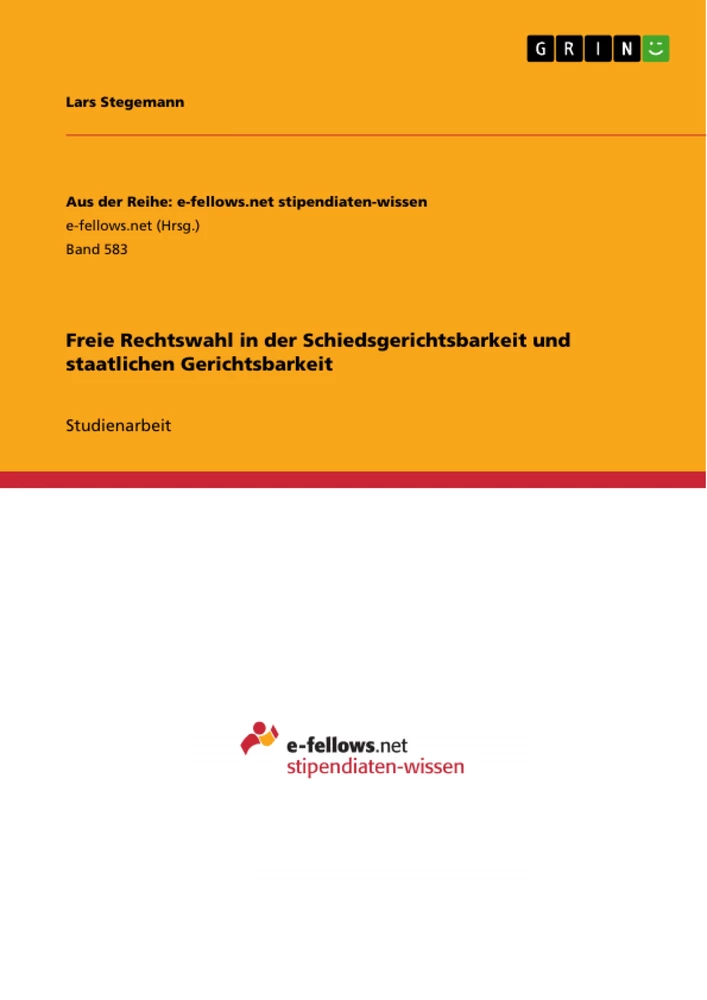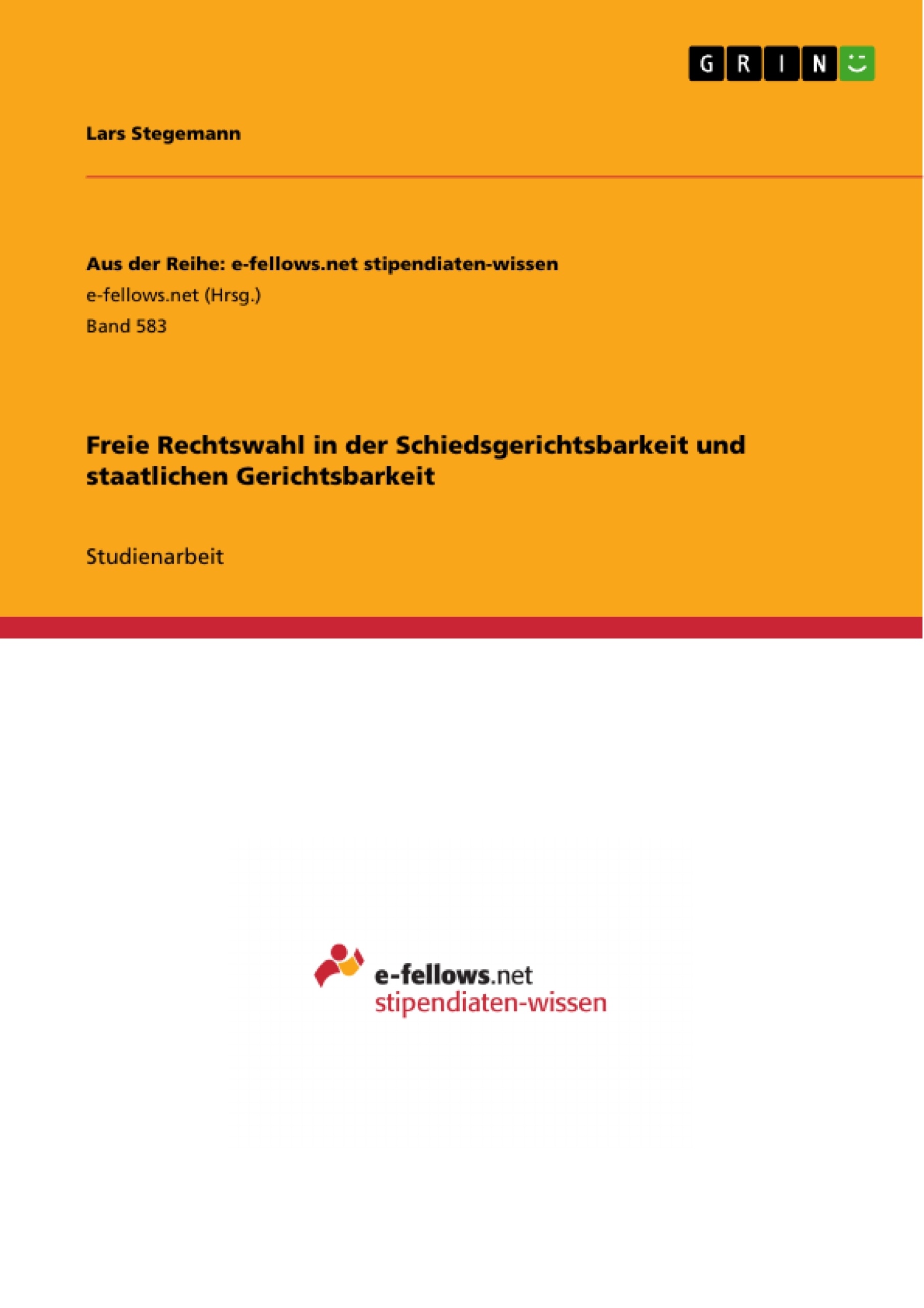Bekannt aus dem Studium ist die Privatautonomie als der bestimmende Grundsatz des Zivilrechts. Privatautonomie bedeutet, dass jeder seine Rechtsverhältnisse nach seinem eigenen Willen und in eigener Verantwortung gestalten kann. Weniger bekannt aus dem Studium, in der Praxis des Internationalen Wirtschaftsrechts jedoch von nicht geringerer Bedeutung ist die Parteiautonomie. Diese kollisionsrechtliche Freiheit, im Gegensatz zur materiellrechtlichen Freiheit, der Privatautonomie, spielt vor allem dann eine Rolle, wenn ein Sachverhalt Bezug zum Recht verschiedener Staaten aufweist. Sie erlaubt den Parteien, das auf ihre Rechtsverhältnisse anwendbare Recht zu wählen und damit auch Einfluss auf die Reichweite der Privatautonomie zu nehmen.
Die Seminararbeit stellt die Rechtswahlfreiheit vor staatlichen Gerichten der Parteiautonomie vor Schiedsgerichten gegenüber. Dabei werden Rechtsgrundlage, Gestaltungsmöglichkeiten und Einschränkungen der Rechtswahlfreiheit vor staatlichen Gerichten und vor Schiedsgerichten verglichen und erläutert. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf der Wählbarkeit nichtstaatlichen Rechts. Damit sind solche Rechtsquellen gemeint, die nicht durch Staaten erlassen, sondern von Privaten ausgearbeitet wurden. Als Beispiele lassen sich die lex mercatoria, die UNIDROIT Principles, aber auch die Transferreglements der FIFA anführen. Schließlich widmet sich der letzte Abschnitt einem Ausblick auf eine mögliche Reform der Parteiautonomie vor staatlichen Gerichten hin zu mehr Liberalität. Diskutiert wird das Für und Wider einer Angleichung der Rechtswahlfreiheit vor staatlichen Gerichten an die Parteiautonomie vor Schiedsgerichten im Hinblick auf die Wählbarkeit nichtstaatlichen Rechts.
Inhaltsverzeichnis
- A. Parteiautonomie im Internationalen Schuldvertragsrecht
- B. Rechtswahl vor staatlichen Gerichten
- I. Der Anwendungsbereich der Rom I-VO
- II. Rechtswahl unter der Rom I-VO
- 1. Wählbares Recht
- 2. Wirksamkeit und Zustandekommen der Rechtswahl
- 3. Gestaltungsmöglichkeiten der Rechtswahl
- III. Grenzen der Rechtswahl
- 1. Inlandssachverhalte und Binnenmarktklausel
- 2. Weitere Grenzen der Rechtswahlfreiheit
- IV. Zwischenergebnis
- C. Rechtswahl vor Schiedsgerichten
- I. Anwendbarkeit der Rom I-VO in der Schiedsgerichtsbarkeit
- II. Anwendungsbereich des § 1051 ZPO
- III. Rechtswahlfreiheit nach § 1051 Abs. 1 ZPO
- 1. Die Frage des wählbaren Rechts
- 2. Gestaltungsmöglichkeiten und Wirksamkeit der Rechtswahl
- IV. Einschränkungen der Rechtswahlfreiheit
- V. Folgen einer Missachtung des § 1051 ZPO durch das Schiedsgericht
- VI. Zwischenergebnis
- D. Rechtswahl vor staatlichen Gerichten: De lege ferenda
- E. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rechtswahlfreiheit in der Schiedsgerichtsbarkeit und staatlichen Gerichtsbarkeit. Sie analysiert die Anwendbarkeit der Rom I-VO und des § 1051 ZPO auf die Rechtswahl und beleuchtet die Grenzen der Parteiautonomie in beiden Bereichen.
- Parteiautonomie im internationalen Schuldvertragsrecht
- Anwendbarkeit der Rom I-VO in der Schiedsgerichtsbarkeit und vor staatlichen Gerichten
- Grenzen der Rechtswahlfreiheit vor staatlichen Gerichten und Schiedsgerichten
- Der Anwendungsbereich des § 1051 ZPO
- Folgen einer fehlerhaften Rechtswahl
Zusammenfassung der Kapitel
A. Parteiautonomie im Internationalen Schuldvertragsrecht: Dieses Kapitel legt die Grundlage für die spätere Untersuchung der Rechtswahl, indem es die Bedeutung der Parteiautonomie im internationalen Schuldvertragsrecht erörtert. Es wird die Bedeutung der Vertragsfreiheit und die Möglichkeit der Parteien, das anwendbare Recht selbst zu bestimmen, herausgestellt. Die Ausführungen bilden den theoretischen Rahmen für die Analyse der konkreten Rechtswahlmöglichkeiten in den folgenden Kapiteln.
B. Rechtswahl vor staatlichen Gerichten: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rechtswahl vor staatlichen Gerichten unter besonderer Berücksichtigung der Rom I-VO. Es analysiert den Anwendungsbereich der Verordnung, die Möglichkeiten der Rechtswahl, die Anforderungen an deren Wirksamkeit und die Grenzen der Rechtswahlfreiheit, einschließlich der Inlandssachverhalte und der Binnenmarktklausel. Der Fokus liegt auf der Auslegung und Anwendung der Rom I-VO im Kontext der staatlichen Gerichtsbarkeit.
C. Rechtswahl vor Schiedsgerichten: Dieses Kapitel untersucht die Rechtswahl im Kontext der Schiedsgerichtsbarkeit. Es analysiert die Anwendbarkeit der Rom I-VO und des § 1051 ZPO, beleuchtet die spezifischen Regelungen zur Rechtswahl in der Schiedsgerichtsbarkeit und erörtert die damit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten und Grenzen. Die potentiellen Folgen einer fehlerhaften Rechtswahl durch das Schiedsgericht werden ebenfalls behandelt. Die komplexen Interaktionen zwischen nationalem Recht (ZPO) und internationalem Recht (Rom I-VO) stehen im Mittelpunkt dieses Kapitels.
D. Rechtswahl vor staatlichen Gerichten: De lege ferenda: Dieses Kapitel befasst sich mit der zukünftigen Gestaltung der Rechtswahl vor staatlichen Gerichten. Es analysiert kritisch die bestehenden Regelungen und diskutiert mögliche Verbesserungen und Anpassungen an aktuelle Herausforderungen. Die Ausführungen bieten einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Rechtsgebiets.
Schlüsselwörter
Rechtswahl, Parteiautonomie, Internationales Schuldvertragsrecht, Rom I-VO, § 1051 ZPO, Schiedsgerichtsbarkeit, Staatliche Gerichtsbarkeit, Grenzen der Rechtswahlfreiheit, Wählbares Recht, Vertragsstatut.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Parteiautonomie und Rechtswahl im internationalen Schuldvertragsrecht
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument untersucht die Rechtswahlfreiheit im internationalen Schuldvertragsrecht, insbesondere im Kontext der Schiedsgerichtsbarkeit und der staatlichen Gerichtsbarkeit. Es analysiert die Anwendbarkeit der Rom I-VO und des § 1051 ZPO und beleuchtet die Grenzen der Parteiautonomie bei der Bestimmung des anwendbaren Rechts.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Parteiautonomie im internationalen Schuldvertragsrecht, die Anwendbarkeit der Rom I-VO und des § 1051 ZPO auf die Rechtswahl, die Grenzen der Rechtswahlfreiheit in beiden Gerichtsbarkeiten (staatlich und schiedsgerichtlich), den Anwendungsbereich des § 1051 ZPO und die Folgen einer fehlerhaften Rechtswahl. Es umfasst eine detaillierte Analyse der Rechtswahl vor staatlichen Gerichten und vor Schiedsgerichten sowie einen Ausblick "de lege ferenda".
Welche Rechtsquellen werden im Dokument analysiert?
Das Dokument analysiert hauptsächlich die Rom I-Verordnung (Rom I-VO) und den § 1051 der Zivilprozessordnung (ZPO). Es untersucht die Interaktion zwischen nationalem (ZPO) und internationalem Recht (Rom I-VO) im Kontext der Rechtswahl.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in fünf Abschnitte gegliedert (A-E). Abschnitt A legt die Grundlagen der Parteiautonomie dar. Abschnitt B behandelt die Rechtswahl vor staatlichen Gerichten unter der Rom I-VO. Abschnitt C analysiert die Rechtswahl vor Schiedsgerichten unter Berücksichtigung der Rom I-VO und des § 1051 ZPO. Abschnitt D befasst sich mit der zukünftigen Gestaltung der Rechtswahl vor staatlichen Gerichten ("de lege ferenda"). Abschnitt E bietet eine Zusammenfassung und einen Ausblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Rechtswahl, Parteiautonomie, Internationales Schuldvertragsrecht, Rom I-VO, § 1051 ZPO, Schiedsgerichtsbarkeit, Staatliche Gerichtsbarkeit, Grenzen der Rechtswahlfreiheit, Wählbares Recht, Vertragsstatut.
Welche Fragen werden in Bezug auf die Rechtswahl vor staatlichen Gerichten behandelt?
Es wird der Anwendungsbereich der Rom I-VO untersucht, die Möglichkeiten und Grenzen der Rechtswahl, die Anforderungen an die Wirksamkeit der Rechtswahl und die Behandlung von Inlandssachverhalten und der Binnenmarktklausel analysiert.
Welche Aspekte werden in Bezug auf die Rechtswahl vor Schiedsgerichten behandelt?
Es werden die Anwendbarkeit der Rom I-VO und des § 1051 ZPO in der Schiedsgerichtsbarkeit untersucht, die Gestaltungsmöglichkeiten und Grenzen der Rechtswahl analysiert und die Folgen einer fehlerhaften Rechtswahl durch das Schiedsgericht erörtert.
Was ist der Ausblick "de lege ferenda"?
Der Ausblick "de lege ferenda" beschäftigt sich mit der zukünftigen Gestaltung der Rechtswahl vor staatlichen Gerichten. Er analysiert kritisch bestehende Regelungen und diskutiert mögliche Verbesserungen und Anpassungen an aktuelle Herausforderungen.
Für wen ist dieses Dokument bestimmt?
Dieses Dokument ist für Wissenschaftler, Juristen und Studierende im Bereich des internationalen Schuldvertragsrechts gedacht, die sich mit Fragen der Rechtswahl und Parteiautonomie befassen.
- Arbeit zitieren
- Lars Stegemann (Autor:in), 2012, Freie Rechtswahl in der Schiedsgerichtsbarkeit und staatlichen Gerichtsbarkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205294