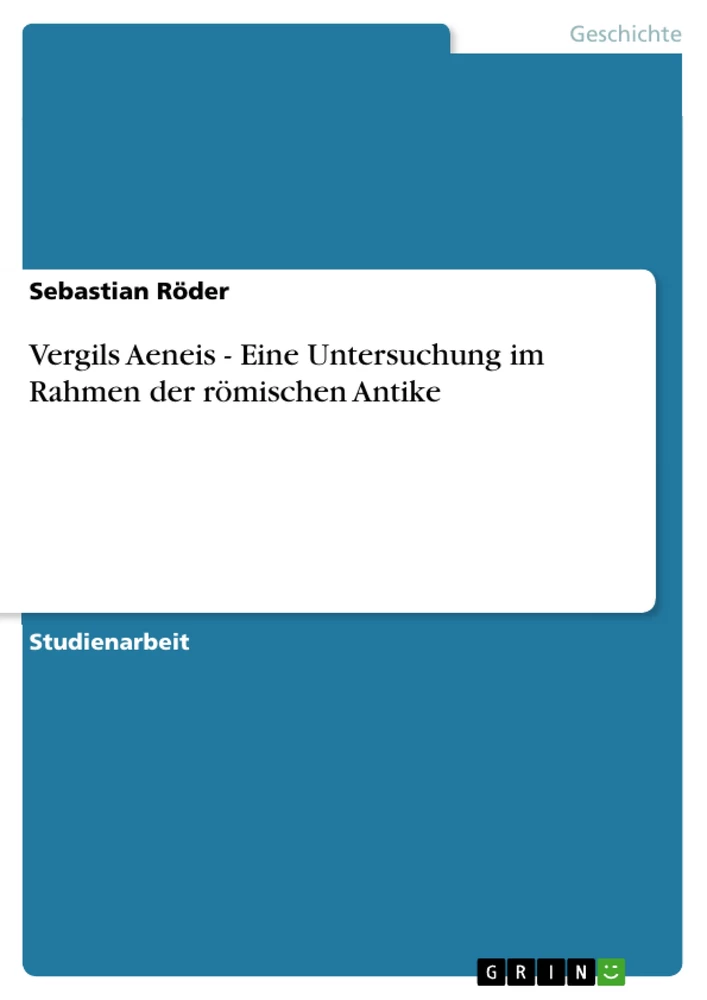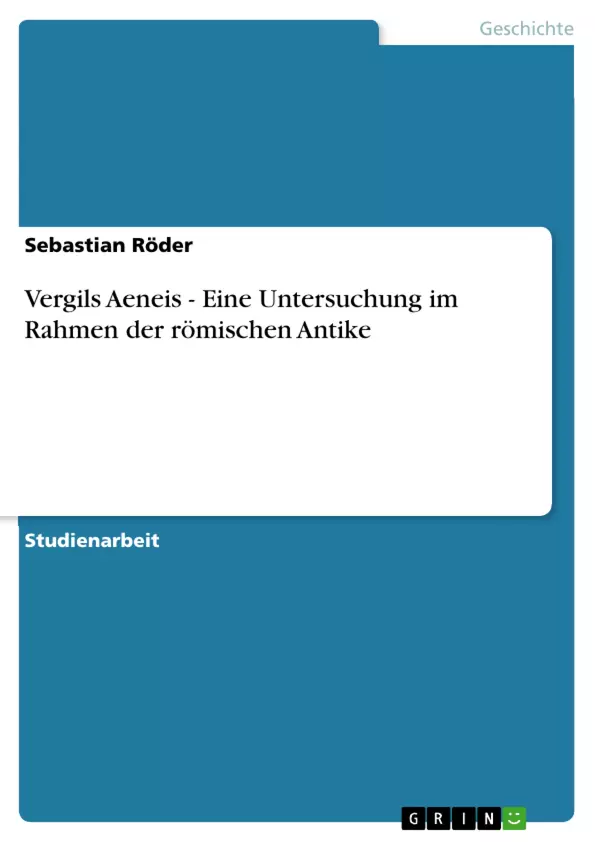Das Rom des ersten Jahrhunderts vor Christus war gezeichnet durch ein Leiden der Republik, welches dann um die Jahrhundertmitte durch Augustus (63 v. Chr. – 14 n. Chr.) beendet worden war. Nach den Iden des März 44 v. Chr. begann Augustus den Kampf gegen die Mörder des Adoptivvaters und nach erfolgreicher Beendigung der Vendetta und Wiederherstellung der pietas, begann Augustus bedeutende restaurative Maßnahmen in Rom. Er veranlasste große Schenkungen, begann viele Baumaßnahmen und sorgte für seine Veteranen. Am 13. Januar 27 v. Chr. legte Augustus sogar seine außerordentlichen Vollmachten nieder und gab dem Senat die Verfügungsgewalt über die res publica zurück. Auch wenn man sich in der Forschung einig ist, dass er dies nur tat, um zu vermeiden, dass er die gleichen Fehler wie sein Vater begeht, war er sich dennoch der Tatsache bewusst, dass ihm im Vertrauen des Volkes ähnliche Vollmachten wiedergegeben werden würden, woraus dann auch das Prinzipat entstand. Diese allgemeine Schilderung der Situation jener Zeit soll auch die Umstände verständlich machen, welche das Wirken vieler Gelehrter und Schriftsteller beeinflussten. Der Protagonist dieser Arbeit, Vergil (70 – 19 v. Chr.), lebte in dieser Zeit und war ein Zeitgenosse Augustus’. Vergil wurde schon vor den Arbeiten an der Aeneis von Augustus’ Taten inspiriert und beeinflusst. Als Augustus 36 v. Chr. Dem Räuberunwesen in Italien ein Ende bereitete und begann die Verhältnisse zu ordnen, brachte diese Entwicklung Vergil dazu, seinen Friedenshoffnungen bereits in der Georgia Ausdruck zu verleihen. In seinem letzten großen Werk, der Aeneis, sollte sogar auftragsgemäß ein Augustuskult verarbeitet werden und in die mythologischen Zusammenhänge eingeflochten werden.
Diese Arbeit soll sich mit der Einbindung eines Augustuskultes in die Aeneis beschäftigen. Zudem soll die mythologische Bedeutung des Werkes und sein Wert für die römische Gesellschaft betrachtet werden. Welche Rolle spielte Augustus in der Aeneis und welcher metaphorischer Vergleich verbirgt sich für die römische Kultur darin?
Hierzu wird zunächst der Autor näher behandelt und sein Verhältnis zu Augustus. Anschließend wird das Werk untersucht, wobei hier weniger Wert auf die Handlung gelegt wird, sondern mehr auf die Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der Autor
- III. Die Aeneis
- IV. Die Aeneis und Augustus
- V. Die Mythologie der Aeneis
- VI. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einbindung eines Augustuskultes in Vergils Aeneis und beleuchtet die mythologische Bedeutung des Werkes sowie seinen Wert für die römische Gesellschaft. Die zentrale Fragestellung ist die Rolle des Augustus in der Aeneis und die dahinterliegende metaphorische Bedeutung für die römische Kultur.
- Der Einfluss von Augustus auf Vergils Werk
- Die mythologische Bedeutung der Aeneis
- Die Rolle des Aeneas als Symbol für Roms Gründung und Aufstieg
- Vergils literarische Gestaltung und seine Bedeutung für die römische Kultur
- Das Verhältnis zwischen Vergil und Augustus
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt den historischen Kontext des Werkes dar, indem sie das Rom des ersten Jahrhunderts v. Chr. und die restaurativen Maßnahmen Augusts nach den Ides des März beschreibt. Sie betont die Bedeutung des Prinzipats und den Einfluss dieser politischen und gesellschaftlichen Umstände auf das Werk Vergils, insbesondere seine Aeneis, welche im Auftrag Augusts einen Augustuskult verarbeiten sollte. Die Arbeit selbst widmet sich der Einbindung dieses Kultes, der mythologischen Bedeutung der Aeneis, und der Rolle des Augustus innerhalb des Werkes und seiner metaphorischen Bedeutung für die römische Kultur.
II. Der Autor: Dieses Kapitel beschreibt Leben und Werk des Autors Vergil. Es beleuchtet seinen sozialen Status als Ritter, seine Bekanntschaft mit Augustus, und seine drei großen Werke: die Bucolica, die Georgica und die Aeneis. Es wird Vergils Stil, seine Sympathie für Mensch, Tier und Natur, und sein Streben nach Formvollendung und Intertextualität hervorgehoben. Die enge Beziehung zwischen Vergil und Augustus, inklusive finanzieller Unterstützung durch Augustus und gemeinsame Reisen, wird diskutiert. Vergils Wunsch, die unvollendete Aeneis nach seinem Tod zu vernichten, und Augustus' Intervention, welche die Erhaltung des Werkes für die Nachwelt sicherte, wird ebenfalls beschrieben.
III. Die Aeneis: Das Kapitel beschreibt die Aeneis als Darstellung der Flucht der Trojaner nach der Zerstörung Trojas und ihre Suche nach einer neuen Heimat in Latium. Die zentrale Rolle des Aeneas und seine charakteristische Eigenschaft der Pietas, seinem Verpflichtung den Fata zu dienen, werden hervorgehoben. Die Irrfahrt der Trojaner über zwölf Jahre und die symbolische Bedeutung der zwölf Bücher werden erklärt, wobei der Fokus auf der Bedeutung des Werkes für die römische Identität und die Legitimation des augusteischen Regimes liegt. Die Kapitel endet ohne die Handlung detailliert darzustellen und lenkt den Fokus auf die tiefere Bedeutung der Aeneis.
Schlüsselwörter
Vergil, Aeneis, Augustus, Römische Religion, Mythologie, Pietas, Augustuskult, Römische Literatur, Kaiserzeit, Imperium Romanum, Literaturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Aeneis-Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert Vergils Aeneis im Kontext des augusteischen Zeitalters. Der Fokus liegt auf der Einbindung eines Augustuskultes in das Werk, seiner mythologischen Bedeutung und seinem Stellenwert für die römische Gesellschaft. Die zentrale Frage ist die Rolle des Augustus in der Aeneis und deren metaphorische Bedeutung für die römische Kultur.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: den Einfluss Augusts auf Vergils Werk, die mythologische Bedeutung der Aeneis, die Rolle des Aeneas als Symbol für Roms Gründung und Aufstieg, Vergils literarische Gestaltung und deren Bedeutung für die römische Kultur, sowie das Verhältnis zwischen Vergil und Augustus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel I (Einleitung) stellt den historischen Kontext dar, Kapitel II (Der Autor) beschreibt Vergils Leben und Werk, Kapitel III (Die Aeneis) behandelt die Aeneis als literarisches Werk, ohne die Handlung im Detail zu beschreiben, Kapitel IV (Die Aeneis und Augustus) untersucht die Beziehung zwischen Aeneis und Augustus, Kapitel V (Die Mythologie der Aeneis) widmet sich der mythologischen Bedeutung der Aeneis, und Kapitel VI (Schlussbetrachtung) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Vergil, Aeneis, Augustus, Römische Religion, Mythologie, Pietas, Augustuskult, Römische Literatur, Kaiserzeit, Imperium Romanum, Literaturgeschichte.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Einbindung des Augustuskultes in Vergils Aeneis zu untersuchen und die mythologische Bedeutung des Werkes sowie seinen Wert für die römische Gesellschaft zu beleuchten. Sie untersucht die Rolle des Augustus in der Aeneis und die dahinterliegende metaphorische Bedeutung für die römische Kultur.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den historischen Kontext und die Forschungsfrage etabliert. Es folgt ein Kapitel über den Autor Vergil, bevor die Aeneis selbst behandelt wird. Ein weiteres Kapitel untersucht die Beziehung zwischen der Aeneis und Augustus, bevor die mythologische Bedeutung des Werkes analysiert wird. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Röder (Autor:in), 2010, Vergils Aeneis - Eine Untersuchung im Rahmen der römischen Antike, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205300