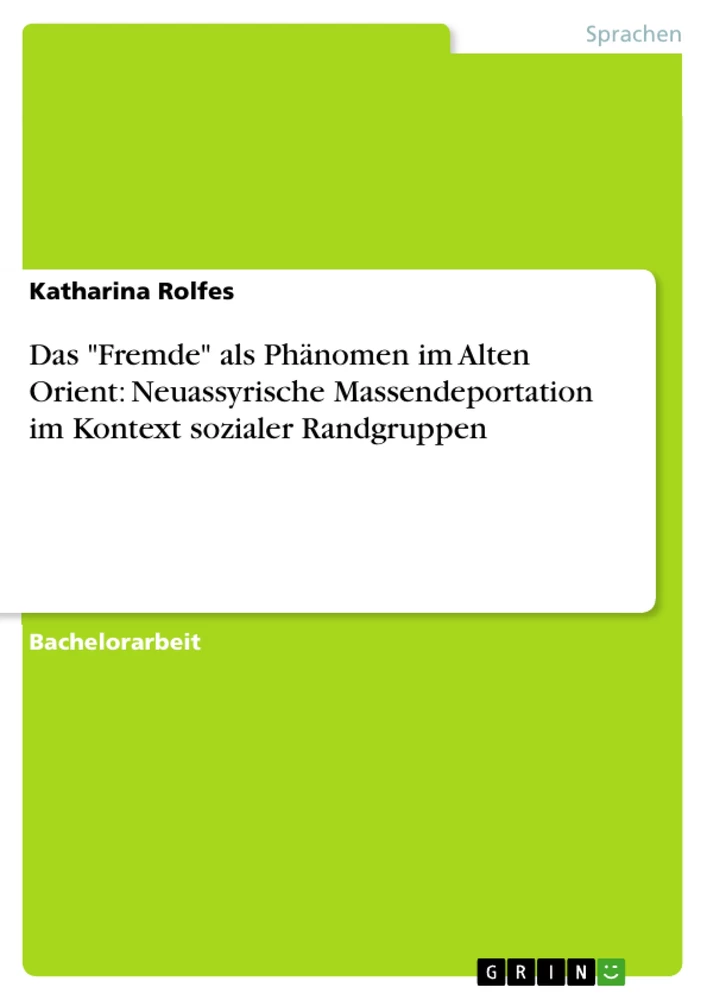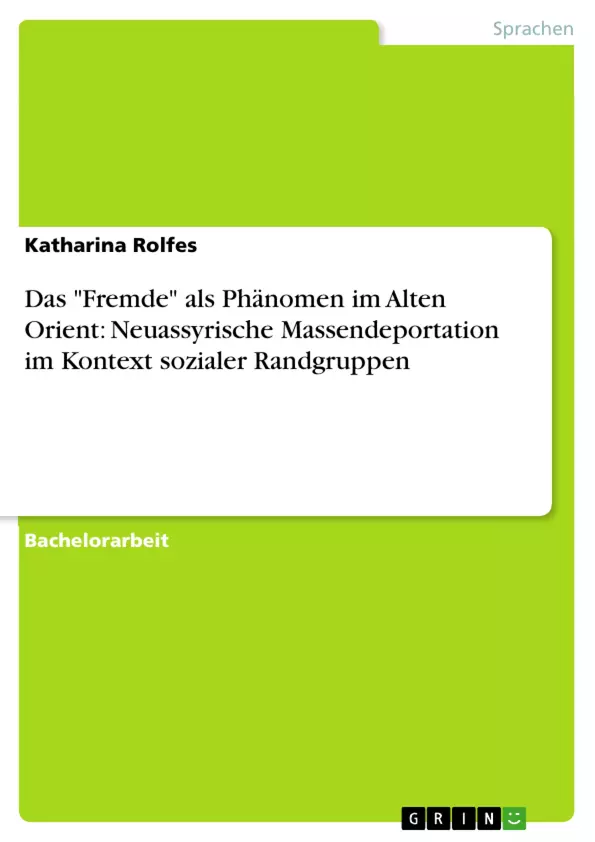Das Interesse an der Thematik sozialer Randgruppen im Alten Orient ist erst seit den 1970er Jahren Bestandteil der Forschung in der Altertumswissenschaft. Sozialhistorische Forschungsinteressen in Bezug auf Minoritäten und Außenseiter in der antiken Gesellschaft gehörten lange nicht zum Untersuchungsgegenstand.
Wie definiert man Fremde und Randgruppen heute? Wie wurden sie im Alten Orient definiert? Die Deportierten wurden nach bestimmten Kriterien durch die Assyrer bestimmt. Die Assyrer haben sich selbst definiert, um sich nach außen abzugrenzen. Welche Kriterien waren für die Identitätsbildung im neuassyrischen Staat ausschlaggebend?
Fragestellungen in Bezug auf Ziele und Hintergründe der neuassyrischen Massendeportationen sind folgende: Wie viele Menschen wurden deportiert und woher kamen sie? War die Auswahl der Deportierten selektiv, oder auf eine bestimmte soziale Gruppe beschränkt?
Der nächste Schritt ist die Integration oder die Marginalisierung. Folgende Fragen ergeben sich aus dieser Ebene: Wie war der Einfluss der Deportierten in der neuassyrischen Gesellschaft? War eine Integration der Deportierten möglich? Wie war ihr rechtlicher und wirtschaftlicher Status? Wurden sie aufgrund von Vorurteilen diskriminiert oder sogar marginalisiert, d. h. an den Rand der Gesellschaft gedrängt?
Können die Deportierten nach heutiger Begriffsbestimmung als soziale Randgruppe bezeichnet werden? Waren die Deportierten Fremde, Unbekannte oder Ausländer, die von der Gesellschaft abgelehnt und ausgegrenzt wurden?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Forschungsstand
- 1.2 Fragestellungen
- 1.3 Ziel und Methoden
- 2. Soziale Randgruppen und das „Fremde“ in der Theorie und im Alten Orient
- 2.1 Was sind soziale Randgruppen in der modernen Theorie?
- 2.2 Was sind soziale Randgruppen im Alten Orient?
- 2.3 Was ist das „Fremde“ in der modernen Theorie?
- 2.4 Was ist das „Fremde“ im Alten Orient?
- 3. Quellen
- 3.1 Königsinschriften
- 3.2 Onomastikon und Quellenproblematik
- 4. Neuassyrische Massendeportation
- 4.1 Ziele der neuassyrischen Massendeportationen
- 4.2 Wie viele Menschen wurden deportiert?
- 4.3 Woher kamen die Deportierten?
- 4.4 Wer genau wurde deportiert?
- 4.5 Wie wurden die Deportierten behandelt?
- 4.6 Definition und Integration: Über den Status der Deportierten mithilfe der Terminologie
- 4.6.1 Wahrnehmung durch die Assyrer
- 4.6.2 Integrationswillen der Assyrer: Was gibt es für Hinweise einer Integration der Deportierten?
- 4.6.2.1 Hinweise in der Terminologie
- 4.6.2.2 Hinweise auf den rechtlichen Status
- 4.6.2.3 Hinweise auf den wirtschaftlichen Status
- 4.7 Konsequenzen und Auswirkungen: Rebellion vs. Loyalität
- 5. Zusammenfassung und Auswertung der Ergebnisse: Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit Fremden und Randgruppen im Alten Orient
- 5.1 Warum die Deportierten Fremde waren
- 5.2 Warum die Deportierten keiner sozialen Randgruppe angehörten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht neuassyrische Massendeportationen unter Anwendung soziologischer Theorien zu Fremdheit und sozialen Randgruppen. Das Hauptziel ist die Analyse des Status der Deportierten innerhalb der assyrischen Gesellschaft und die Klärung der Frage, ob sie als „fremd“ und/oder als soziale Randgruppe einzustufen sind. Die Arbeit basiert auf der Interpretation neuassyrischer Königsinschriften.
- Definition von Fremdheit und sozialen Randgruppen in der modernen Theorie und im Alten Orient
- Ziele und Hintergründe der neuassyrischen Massendeportationen
- Selektionsprozesse und die Zusammensetzung der Deportierten
- Integration oder Marginalisierung der Deportierten in der assyrischen Gesellschaft
- Rechtlicher und sozioökonomischer Status der Deportierten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der neuassyrischen Massendeportationen ein und beleuchtet den Forschungsstand zu sozialen Randgruppen und dem „Fremden“ im Alten Orient. Es werden zentrale Forschungsfragen formuliert, die sich auf die Definition von Fremdheit und sozialen Randgruppen im Kontext des Alten Orients und die Analyse der neuassyrischen Deportationen beziehen. Das Kapitel skizziert die Methodik der Arbeit, die sowohl soziologische als auch philologische Ansätze verbindet, um die neuassyrischen Königsinschriften zu interpretieren und den Status der Deportierten zu bestimmen. Der Fokus liegt auf der Anwendung moderner soziologischer Theorien auf die historische Realität des Alten Orients.
2. Soziale Randgruppen und das „Fremde“ in der Theorie und im Alten Orient: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Konzepte von „sozialen Randgruppen“ und „Fremdheit“ sowohl in der modernen Soziologie als auch im Kontext des Alten Orients. Es analysiert die verschiedenen Definitionen und Perspektiven auf diese Phänomene und legt die Grundlage für die spätere Anwendung dieser Konzepte auf die neuassyrischen Deportationen. Der Vergleich zwischen moderner Theorie und altorientalischer Realität bildet den Kern dieses Kapitels und schafft den notwendigen Rahmen für die nachfolgenden Analysen.
3. Quellen: Dieses Kapitel beschreibt die verwendeten Quellen, vor allem die neuassyrischen Königsinschriften, und diskutiert die damit verbundenen Herausforderungen der Quellenkritik, einschließlich der Onomastik und der Problematik der Interpretation antiker Texte. Es beleuchtet die spezifischen Schwierigkeiten und Möglichkeiten, die sich aus der Verwendung dieser Primärquellen für die Untersuchung der Massendeportationen ergeben. Die kritische Auseinandersetzung mit der Qualität und den Limitationen der Quellen ist essentiell für eine fundierte Analyse.
4. Neuassyrische Massendeportation: Dieses Kapitel analysiert die neuassyrischen Massendeportationen im Detail. Es beleuchtet die Ziele der Deportationen, die Anzahl und Herkunft der Deportierten sowie die Auswahlkriterien. Es untersucht die Behandlung der Deportierten durch die Assyrer, ihren rechtlichen und wirtschaftlichen Status, sowie die Möglichkeiten der Integration oder Marginalisierung in der assyrischen Gesellschaft. Hier wird im Detail auf die Terminologie der assyrischen Quellen eingegangen, um den Status der Deportierten zu beleuchten. Die Analyse der verschiedenen Facetten der Deportationen bildet den Schwerpunkt dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Neuassyrisches Reich, Massendeportationen, Soziale Randgruppen, Fremdheit, Integration, Marginalisierung, Königsinschriften, Identitätsbildung, Rechtlicher Status, Sozioökonomischer Status, Alte Orient, Soziologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Neuassyrische Massendeportationen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht neuassyrische Massendeportationen unter Anwendung soziologischer Theorien zu Fremdheit und sozialen Randgruppen. Das Hauptziel ist die Analyse des Status der Deportierten innerhalb der assyrischen Gesellschaft und die Klärung der Frage, ob sie als „fremd“ und/oder als soziale Randgruppe einzustufen sind. Die Arbeit basiert auf der Interpretation neuassyrischer Königsinschriften.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition von Fremdheit und sozialen Randgruppen (in moderner Theorie und im Alten Orient), Ziele und Hintergründe der neuassyrischen Massendeportationen, Selektionsprozesse und Zusammensetzung der Deportierten, Integration oder Marginalisierung der Deportierten in der assyrischen Gesellschaft sowie deren rechtlichen und sozioökonomischen Status.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquellen sind neuassyrische Königsinschriften. Das Kapitel 3 diskutiert die Quellenkritik, einschließlich der Onomastik und der Problematik der Interpretation antiker Texte, sowie die damit verbundenen Herausforderungen und Möglichkeiten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Forschungsstand, Fragestellungen, Ziel und Methoden), Soziale Randgruppen und das „Fremde“ in der Theorie und im Alten Orient (theoretische Grundlagen), Quellen (Beschreibung und Kritik der Quellen), Neuassyrische Massendeportation (detaillierte Analyse der Deportationen) und Zusammenfassung und Auswertung der Ergebnisse (Vergleich mit Fremden und Randgruppen im Alten Orient).
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verbindet soziologische und philologische Ansätze. Moderne soziologische Theorien werden auf die historische Realität des Alten Orients angewendet, um die neuassyrischen Königsinschriften zu interpretieren und den Status der Deportierten zu bestimmen.
Welche Schlüsselfragen werden untersucht?
Zentrale Fragen sind: Wie definieren moderne soziologische Theorien Fremdheit und soziale Randgruppen? Wie lassen sich diese Konzepte auf den Alten Orient anwenden? Was waren die Ziele der neuassyrischen Massendeportationen? Wie wurden die Deportierten behandelt? Galt es für die Deportierten als "fremd" und/oder als soziale Randgruppe? Welchen rechtlichen und sozioökonomischen Status hatten die Deportierten?
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse analysieren den Status der Deportierten innerhalb der assyrischen Gesellschaft und untersuchen, ob sie als "fremd" und/oder als soziale Randgruppe einzustufen sind. Die Analyse basiert auf einer detaillierten Interpretation der neuassyrischen Königsinschriften und der Anwendung soziologischer Theorien.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Neuassyrisches Reich, Massendeportationen, Soziale Randgruppen, Fremdheit, Integration, Marginalisierung, Königsinschriften, Identitätsbildung, Rechtlicher Status, Sozioökonomischer Status, Alte Orient, Soziologie.
- Quote paper
- Katharina Rolfes (Author), 2010, Das "Fremde" als Phänomen im Alten Orient: Neuassyrische Massendeportation im Kontext sozialer Randgruppen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205378