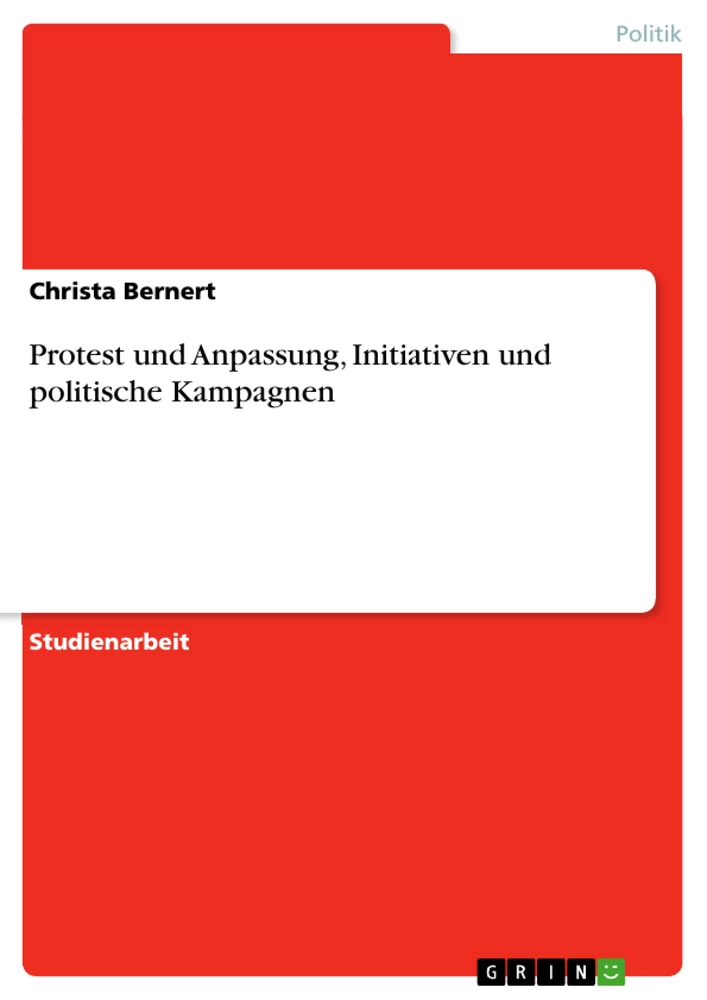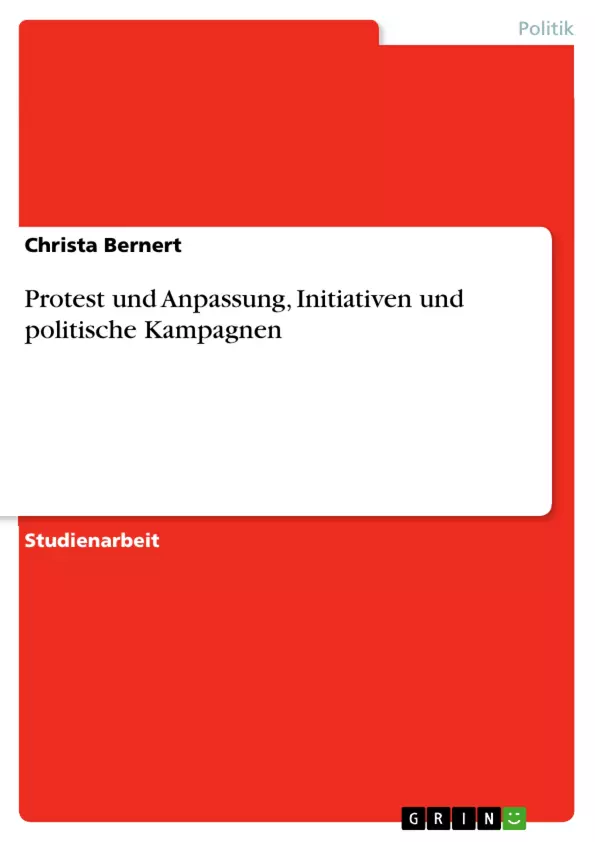Seit mehr als zwei Jahrzehnten befindet sich die Arbeit und die gesamte Wirtschaft in allen industrialisierten Ländern der Erde in einem Umbruch, der in unserem Jahrhundert ohne Vergleich ist. Der ökonomische Modernisierungsprozeß, der in den 70er Jahren begonnen hat und in den 80er Jahren durch strukturelle Wirtschaftskrisen verstärkt wurde, hat durch die Globalisierung in den 90er Jahren eine zusätzliche Dynamik gewonnen.
Mit dem Ende des Kalten Krieges begann in raschem Tempo der Wandel von der Industriegesellschaft zur Informationsgesellschaft. So stellt heute nur eine Minderheit von Erwerbstätigen tatsächlich noch Produkte her. Und diese Minderheit nimmt weiter ab. Die meisten Erwerbstätigen sind - in der einen oder anderen Form - mit dem Erbringen von Dienstleistungen befaßt. Im Zeitalter der Globalisierung fand ein Prozeß der Entstofflichung von Arbeit statt. Arbeit verlor seine Bindung an Ort und Raum. In der Ideenökonomie bemißt sich der Wert von Produkten immer weniger am Einsatz von Kapital und Arbeit, sondern an einer sich freilich rasch verändernden Position von Anbietern am Markt. Digitalisierung ermöglicht eine neue Mobilität von Dienstleistungen.
Heute wird zentral gesteuert, aber dezentral, nahe den Absatzmärkten in quasi-transnationalen Unternehmen produziert. Aus weltweit agierenden Konzernen werden Netzwerke.
Die Frage nach der Zukunft der Arbeit und der Arbeit der Zukunft ist eine zentrale Frage der gesellschaftlichen Entwicklung und des gesellschaftlichen Zusammenhalts geworden. Einerseits wird die Arbeit immer weniger; dieser Umstand wird durch Statistiken (z.B. sind in Deutschland derzeit über 4 Millionen Menschen arbeitslos) ausgedrückt. Andererseits wird Arbeit immer mehr, weil sie selbst ein universeller Ausdruck für Lebenstätigkeit geworden ist. Denn wer immer für eine Tätigkeit Geld bekommt, auch wenn er nicht unmittelbar produktiv ist, arbeitet selbstverständlich. Arbeit ist längst zur einzig relevanten Quelle und zum einzig gültigen Maßstab für die Wertschätzung unserer Tätigkeiten geworden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zu meiner Arbeit
- Begriffsdefinitionen
- Arbeit
- Globalisierung
- Grundzüge der Globalisierung
- Flexible Arbeitsformen
- Globalisierung - Verlust des Politischen
- Konsequenz für die Politik
- Sennetts: Der flexible Mensch
- Einfluß der Politik auf die Globalisierung
- Grundsicherung
- Wozu ein Grundeinkommen
- Was ist das Grundeinkommen
- Motive, Zugänge für ein Grundeinkommen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Auswirkungen der Globalisierung auf die Arbeitswelt und die Rolle der Politik in diesem Kontext. Sie konzentriert sich auf das Buch „Der flexible Mensch - Die Kultur des neuen Kapitalismus“ von Richard Sennett, um die Herausforderungen der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes zu verstehen.
- Der Wandel der Arbeitswelt im Zeitalter der Globalisierung
- Die Folgen der Flexibilisierung für den Arbeitsmarkt
- Die Rolle der Politik in der Gestaltung der Arbeitswelt
- Das Konzept der Grundsicherung als möglicher Lösungsansatz
- Sennets Analyse der „Kultur des neuen Kapitalismus“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Wandel der Arbeitswelt seit den 1970er Jahren dar, der durch Globalisierung und technologische Fortschritte geprägt ist. Die Arbeit wird als ein universeller Ausdruck für Lebenstätigkeit definiert und die Frage nach der Zukunft der Arbeit wird als zentrale gesellschaftliche Herausforderung aufgezeigt.
Das Kapitel „Zu meiner Arbeit“ präsentiert das Buch von Richard Sennett als Ausgangspunkt der Analyse. Es wird die Frage nach der Handlungsfähigkeit der Politik in Zeiten des globalisierten Marktes behandelt und die Grundsicherung als politische Handlungsmöglichkeit vorgestellt.
Im Kapitel „Begriffsdefinitionen“ werden die Begriffe „Arbeit“, „Globalisierung“ und „flexible Arbeitsformen“ mithilfe von Sekundärliteratur definiert. Der Wandel von der klassischen Vorstellung von Arbeit hin zu einer modernen Definition wird erläutert.
Das Kapitel „Sennetts: Der flexible Mensch“ setzt sich mit den Ausführungen von Richard Sennett auseinander und analysiert die Konsequenzen der Globalisierung für den Arbeitsmarkt. Sennetts Beschreibung der „Kultur des neuen Kapitalismus“ wird vorgestellt.
Das Kapitel „Einfluß der Politik auf die Globalisierung“ beschäftigt sich mit den Möglichkeiten und Grenzen der politischen Einflussnahme auf die Globalisierungsprozesse. Es wird die Frage aufgeworfen, inwieweit die Politik in der Lage ist, die negativen Folgen der Globalisierung für den Arbeitsmarkt abzumildern.
Das Kapitel „Grundsicherung“ untersucht das Konzept der Grundsicherung als politische Handlungsmöglichkeit im Kontext der flexiblen Arbeitswelt. Es werden Argumente für und gegen ein Grundeinkommen diskutiert und verschiedene Motive und Zugänge zu einem Grundeinkommen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Arbeit, Globalisierung, flexible Arbeitsformen, Kultur des neuen Kapitalismus, Grundsicherung, politische Handlungsfähigkeit und die Frage nach der Zukunft der Arbeit. Diese Themen werden in einem historischen Kontext betrachtet und die Analyse konzentriert sich auf die Folgen der Globalisierung für den Arbeitsmarkt und die Rolle der Politik in dieser Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat die Globalisierung die Arbeitswelt verändert?
Die Globalisierung führte zu einem Wandel von der Industriegesellschaft zur Informationsgesellschaft, geprägt durch Dezentralisierung und die Entstofflichung der Arbeit.
Was ist die Kernaussage von Richard Sennetts „Der flexible Mensch“?
Sennett analysiert die Kultur des neuen Kapitalismus und die Konsequenzen der ständigen Flexibilisierung für den Charakter und das Leben der arbeitenden Menschen.
Welche Rolle spielt die Politik in der modernen Arbeitswelt?
Die Arbeit untersucht, ob die Politik in Zeiten globaler Märkte noch handlungsfähig ist und wie sie den Wandel der Arbeitswelt gestalten kann.
Was wird unter dem Begriff „Grundsicherung“ diskutiert?
Die Grundsicherung bzw. das Grundeinkommen wird als möglicher Lösungsansatz für die Herausforderungen einer flexiblen Arbeitswelt und hoher Arbeitslosigkeit untersucht.
Warum verliert Arbeit ihre Bindung an Ort und Raum?
Durch die Digitalisierung und die Zunahme von Dienstleistungen in der „Ideenökonomie“ können Tätigkeiten heute oft unabhängig vom physischen Standort erbracht werden.
- Citation du texte
- Christa Bernert (Auteur), 2002, Protest und Anpassung, Initiativen und politische Kampagnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20539