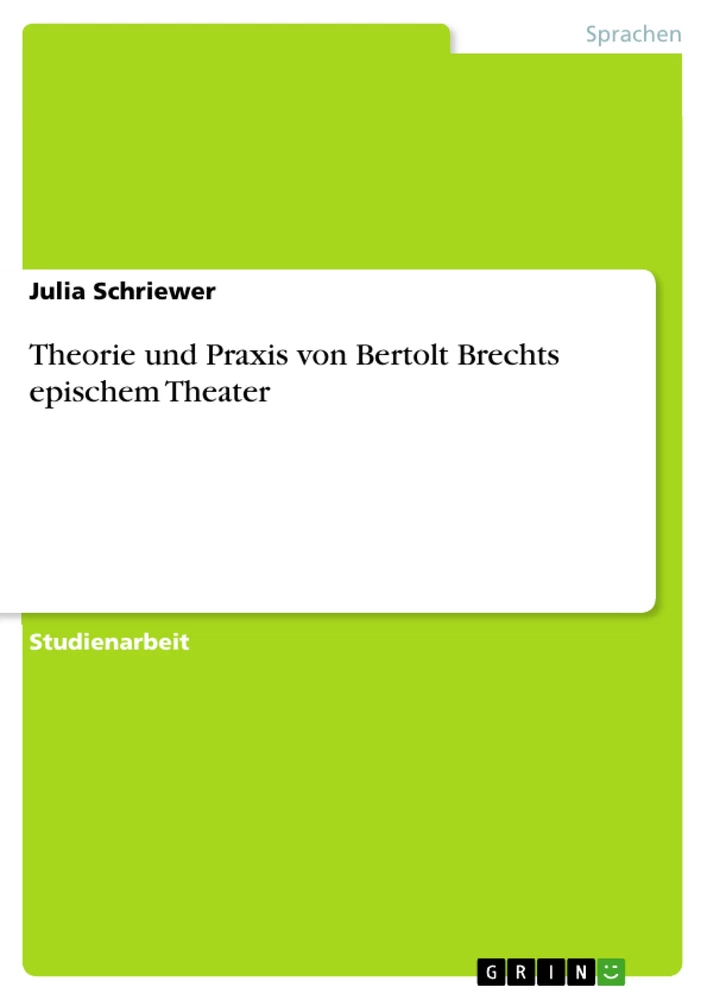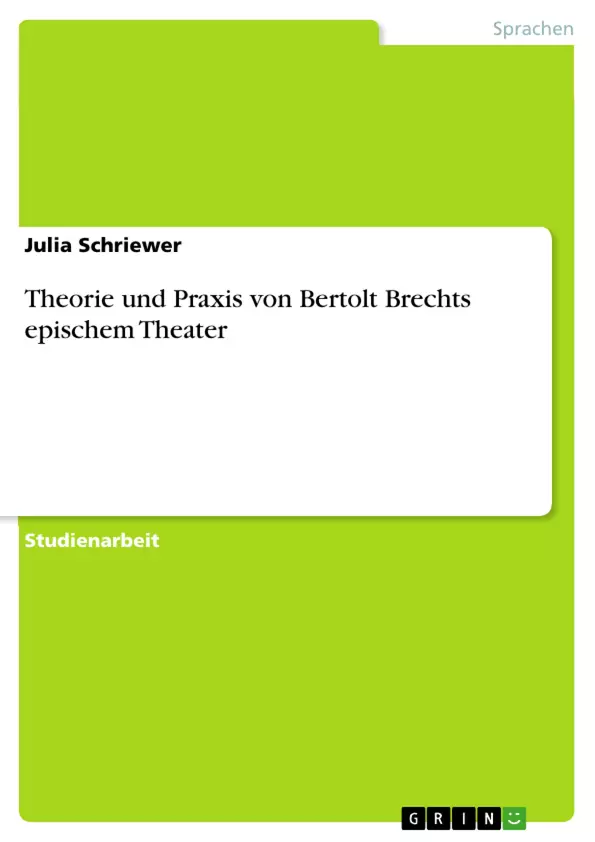Das Theater, die über zweitausend Jahre alte Tradition, die die szenische Performanz in ihren unzähligen Erscheinungsformen umschreibt, diente über einen langen Zeitraum hinweg der Vermittlung und Festigung von kultischen, religiösen, politischen und ästhetischen Ideen. Jede Epoche brachte eigene Spielarten und Theorien des Theaters hervor. Die Vermittlung von politischen und gesellschaftlichen Ideen steht bei dem von Bertolt Brecht entwickelten epischen Theater im Vordergrund.
In der folgenden Auseinandersetzung geht es zunächst im zweiten Kapitel um die Theorie des epischen Theaters. Im ersten Teil wird dargelegt, dass die Entstehung der Theorie durch die politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen in der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg in großem Maß beeinflusst wird. Brechts Interesse an der arbeitenden Bevölkerungsschicht und Kontakte zu linken Intellektuellen führen zu einer Beschäftigung mit dem Marxismus, die seine Arbeit prägen sollte. Der zweite Teil des zweiten Kapitels soll verdeutlichen, wie Brecht den marxistischen Aufklärungsgedanken in seine Theorie mit einbezieht und mit welchen Mitteln er die erwünschte Wirkung bei den Zuschauern herbeiführen möchte.
Im Zentrum des dritten Kapitels steht Brechts Arbeit am Berliner Ensemble. Nach einer kurzen Übersicht zu dem Hintergrund der Entstehung des Berliner Ensembles geht es im ersten Teil um die Inszenierungsarbeit unter der Gesamtleitung Brechts. Dabei wird die Probenarbeit Brechts mit den Schauspielern und ebenso die Arbeit mit den Bühnenbildnern und Komponisten thematisiert. Im zweiten Teil soll gezeigt werden, dass Brecht seine Arbeit mit dem Berliner Ensemble auch direkt und indirekt jenseits der eigenen Theatermauern fortführt. Fremde Bühnen, die Brechts am Berliner Ensemble aufgeführte Stücke inszenieren, erhalten Unterstützung durch die von Brecht und seinen Mitarbeitern hergestellten Modellbücher.
Zusätzlich bringt Brecht seine Inszenierungen mit dem Ensemble neben Gastspielen im nahen Ausland in den Jahren 1949- 1951 direkt in die Betriebe.
Das letzte Kapitel der Arbeit dient der übersichtlichen Zusammenfassung.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Theorie des epischen Theaters
2.1 Der Weg zu einer neuen Theatertheorie
2.2 Die Einflüsse des Marxismus auf die Theorie des epischen Theaters
3. Die Praxis des epischen Theaters- Brechts Arbeit am Berliner Ensemble
3.1 Brechts Inszenierungsarbeit am Berliner Ensemble
3.1.1 Die ersten Inszenierungen
3.1.2 Die Arbeit mit den Schauspielern
3.1.3 Die Arbeit mit den Bühnenbildnern
3.1.4 Die Arbeit mit den Komponisten
3.2 Brechts Arbeit mit dem Berliner Ensemble jenseits der Theatermauern
4. Schluss
5. Verwendete Literatur
Häufig gestellte Fragen
Was ist das epische Theater von Bertolt Brecht?
Eine Theaterform, die nicht auf Mitfühlen (Einfühlung), sondern auf Distanz und kritisches Denken setzt, um gesellschaftliche Zustände veränderbar zu machen.
Was ist der Verfremdungseffekt (V-Effekt)?
Ein Mittel, um Bekanntes als fremd oder merkwürdig darzustellen (z. B. durch Lieder oder direkte Ansprache), damit der Zuschauer eine kritische Distanz wahrt.
Welchen Einfluss hatte der Marxismus auf Brecht?
Der Marxismus lieferte Brecht das theoretische Fundament, um soziale Ungerechtigkeiten zu analysieren und das Theater als Werkzeug zur Aufklärung der arbeitenden Klasse zu nutzen.
Was war das Berliner Ensemble?
Die von Brecht und Helene Weigel 1949 gegründete Theatergruppe, die seine Theorie des epischen Theaters in die Praxis umsetzte.
Was sind Brechts „Modellbücher“?
Detaillierte Dokumentationen seiner Inszenierungen, die anderen Theatern als Vorlage dienen sollten, um seine Regiekonzepte originalgetreu umzusetzen.
- Quote paper
- Julia Schriewer (Author), 2011, Theorie und Praxis von Bertolt Brechts epischem Theater , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205692