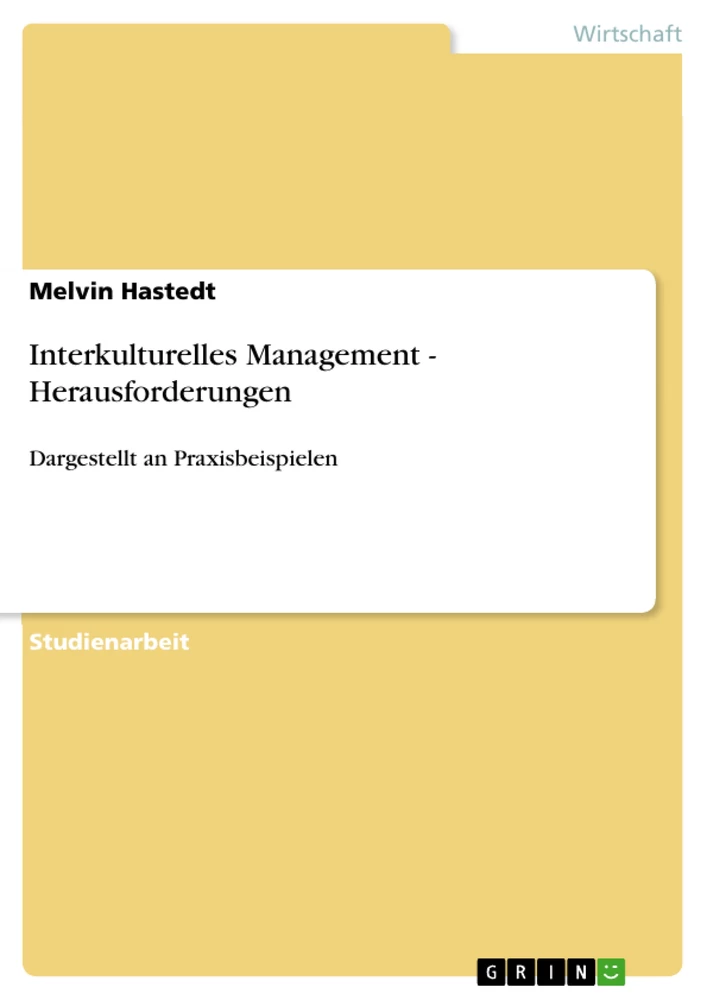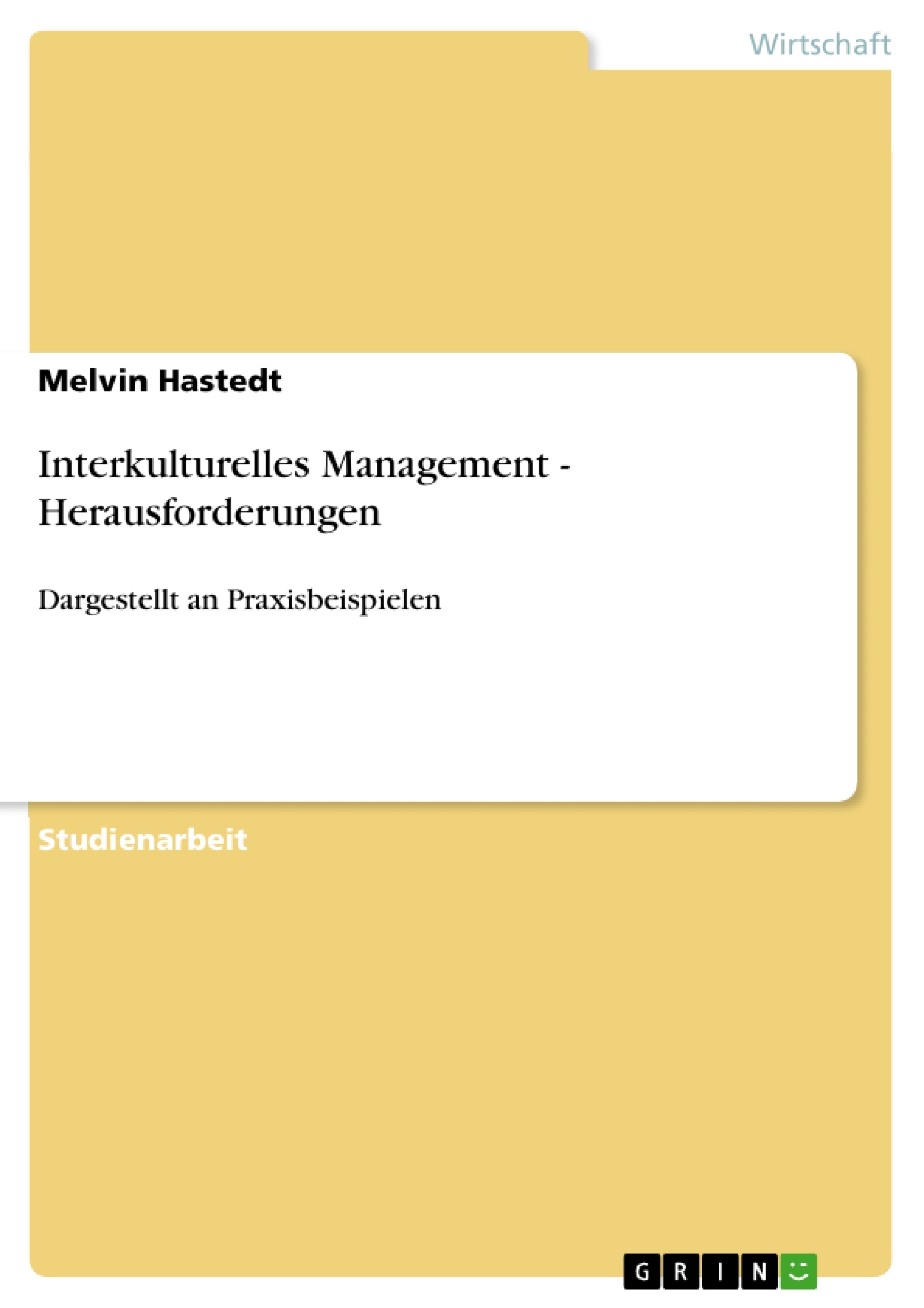I Inhaltsverzeichnis
II Abbildungsverzeichnis II
III Abkürzungsverzeichnis II
1 Einführung 2
1.1 Vorüberlegungen 2
1.2 Geschichte und Entwicklung 2
2 Bedeutung des interkulturellen Managements 2
2.1 Unterschied zwischen international und interkulturell 2
2.2 Begriffsbestimmung 2
3 Unterschiedliche Kulturerklärungen 2
3.1 Kulturmodell nach Hall 2
3.2 Kulturmodell von Hofstede 2
3.3 Unternehmenskulturen 2
4 Bestandteile des interkulturellen Managements 2
4.1 Interkulturelle Kompetenz 2
4.2 Zusammenführen der Kompetenzen 2
5 Fazit 2
IV Literaturverzeichnis II
V Ehrenwörtliche Erklärung II
Inhaltsverzeichnis
II Abbildungsverzeichnis
III Abkürzungsverzeichnis
1 Einführung
1.1 Vorüberlegungen
1.2 Geschichte und Entwicklung
2 Bedeutung des interkulturellen Managements
2.1 Unterschied zwischen international und interkulturell
2.2 Begriffsbestimmung
3 Unterschiedliche Kulturerklärungen
3.1 Kulturmodell nach Hall
3.2 Kulturmodell von Hofstede
3.3 Unternehmenskulturen
4 Bestandteile des interkulturellen Managements
4.1 Interkulturelle Kompetenz
4.2 Zusammenführen der Kompetenzen
5 Fazit
IV Literaturverzeichnis
II Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 The Iceberg Model
Abb. 2 High-low-context cultures
Abb. 3 Concept of Time
Abb. 4 Vergleich Deutschland und Mexico
Abb. 5 Vergleich Großbritannien und Panama
Abb. 6 Strategien zum Kulturtransfer
III Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einführung
1.1 Vorüberlegungen
Wer nicht nur national unternehmerisch tätig ist, sondern ebenfalls international agiert und dabei erfolgreich Wirtschaften will, muss das interkulturelle Management beherrschen. Jedes einzelne Land hat seine Besonderheiten und gehört einer bestimmten Kultur an. Werden diese Unterschiede nicht berücksichtigt, ist es, trotz eines bestens aufgestellten Unternehmens, schwierig mit ausländischen Partnern zusammenzuarbeiten oder ausländische Standorte zu errichten oder aufrecht zu erhalten. Viele Unternehmen befassen sich zuerst mit den juristischen Unterschieden eines Landes, doch allein dieser Aspekt reicht bei Weitem nicht aus um Erfolg zu haben.[1] Schon die Begrüßung eines ausländischen Geschäftspartners kann sich als schwierig herausstellen: In Kuwait ist es verboten als Mann eine Frau in der Öffentlichkeit mit einem Handschlag zu begrüßen oder überhaupt zu berühren.[2] Solche Fauxpas können mit ein wenig Engagement vermieden werden. Nachfolgend werden die grundlegenden Voraussetzungen sowie Problematiken im Zusammenhang von kulturellen Interaktionen und anhand von theoretischen und praktischen Beispielen erläutert.
1.2 Geschichte und Entwicklung
Schon zu Zeiten der Ägypter, Griechen, Phönizier und Römer wurden grenzüberschreitende unternehmerische Tätigkeiten ausgeübt. So wurde etwa im Römischen Reich Handel betrieben, der sich vom heutigen Großbritannien bis ins Ägyptische Reich erstreckte. Im Mittelalter wurden die globalen Handelswege unter anderem durch die Hanse oder die Seidenstraße erweitert. In der Neuzeit haben die Entwicklungen im Zuge der Globalisierung und Internationalisierung zum Anstieg internationaler Verflechtungen beigetragen.[3] Dabei hat die Internationalisierung heute einen Grad erreicht, der vor zwanzig Jahren noch undenkbar war.[4]
Der Begriff Management hat seinen Ursprung im Lateinischen von manus agere, dies bedeutet so viel wie jemanden an der Hand zu führen. Heute befasst sich das Management mit einem Objekt und dessen Ziel, da eißt das zu erreichende Ziel muss unter bestimmten Bedingungen und Abgrenzungen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erreicht werden.[5]
Der Begriff Kultur ist so vielfältig, dass eine genaue und eindeutige Definition nicht möglich ist.[6] Die Abstammung ist jedoch lateinisch und entstammt dem Begriff cultura. Vor längerer Zeit assoziierte man alltagssprachlich den Begriff Kultur mit den von Menschen erstellten Werken wie zum Beispiel Architektur, und Musik. Diese Ansichtsweise wird als objektive Kultur bezeichnet. Heute ist die Ansicht der subjektiven Kultur weit verbreitet. Sie beschäftigt sich mit menschlichem Verhalten, dem Kommunikationsstil und anderen dahinter liegenden Werten.[7]
2 Bedeutung des interkulturellen Managements
2.1 Unterschied zwischen international und interkulturell
Interkulturelles Management ist ein wichtiger Bestandteil des internationalen Managements. Das internationale Management beschäftigt sich mit den ökonomischen, politischen, technischen und rechtlichen Einflüssen. Das interkulturelle Management hingegen befasst sich mit der Wahrnehmung und Interpretation der kulturellen Umwelt.[8] Kommt es zu einem Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen in Entscheidungs- und Kommunikationssituationen international agierender Unternehmen, gewinnt das interkulturelle Management an betriebswirtschaftlicher Bedeutung.[9]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 The Iceberg Model
Quelle: http://www.york-associates.co.uk/BM-TS-demo/resources/cultureiceberg.jpg .
Hierzu wird das Eisberg Modell das erstmals durch Edward T. Hall seine Anwendung fand, als Erklärungsansatz hinzugezogen. Treffen zwei Personen unterschiedlicher kultureller Herkunft aufeinander, so werden zunächst nur die über Wasser liegenden, sichtbaren Elemente wahrgenommen. Dazu zählen u.a. Rituale, Artefakte, Sprache und Musik. Diese werden aber lediglich von darunterliegenden und verborgenen Werte-vorstellungen, Denkweisen und Normen bestimmt.[10]
Laut Hall kann man die daraus resultierenden Möglichkeiten für Missverständnisse, zum Beispiel das unterschiedliche Interpretieren von Gesten, nur überwinden, indem man sich die Zeit für die Interaktion mit der anderen Kultur nimmt um so die internen, verborgenen Werte kennen zu lernen und zu verstehen.[11]
[...]
[1] Vgl. Fischer, C., 05.05.2010, Interkulturelles Management: Erfolgreich Geschäfte mit anderen Ländern machen.
[2] Vgl. Grusser, G., November 2008, Business-Knigge - Ein Ratgeber für den Umgang mit ausländischen
Geschäftspartnern, S. 70.
[3] Vgl. Schipper, K., 2007, S. 8.
[4] Vgl. Krystek/Zur, 2002, S. 3, in Hummel/Zander, 2005, S. 6.
[5] Vgl. Aydt, S., 2008, S. 136 ff.
[6] Vgl. Bolten, J., 2007, S. 10.
[7] Vgl. Aydt, S., 2008, S. 136 f.
[8] Vgl. Engelhard, J., Gabler Verlag, Gabler Wirtschaftslexikon,
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/4692/interkulturelles-management-v4.html.
[9] Vgl. Perlitz, M., 2000, S. 297.
[10] Vgl. http://www.transkulturelles-portal.com/index.php/3/31.
[11] Vgl. Hall, E.T., Beyond cultures, 1976, in
http://www.constantforeigner.com/uploads/3/8/5/7/3857081/iceberg_model.pdf.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen internationalem und interkulturellem Management?
Internationales Management befasst sich mit ökonomischen und rechtlichen Aspekten, während interkulturelles Management die Wahrnehmung und Interpretation kultureller Unterschiede fokussiert.
Was erklärt das „Eisberg-Modell“ von Edward T. Hall?
Es besagt, dass nur ein kleiner Teil der Kultur sichtbar ist (Sprache, Bräuche), während der Großteil (Werte, Normen, Denkmuster) verborgen unter der Oberfläche liegt.
Welche Kulturmodelle sind für das Management wichtig?
Die Arbeit nennt insbesondere die Modelle von Hall (High/Low Context) und Hofstede (Kulturdimensionen) als theoretische Grundlagen.
Was versteht man unter interkultureller Kompetenz?
Es ist die Fähigkeit, in kulturellen Überschneidungssituationen angemessen zu agieren und Missverständnisse durch Wissen über fremde Werte zu vermeiden.
Warum scheitern viele Unternehmen an kulturellen Hürden?
Häufig werden nur rechtliche oder finanzielle Aspekte beachtet, während „weiche“ Faktoren wie Begrüßungsrituale oder Kommunikationsstile unterschätzt werden.
- Quote paper
- Melvin Hastedt (Author), 2012, Interkulturelles Management - Herausforderungen , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205694