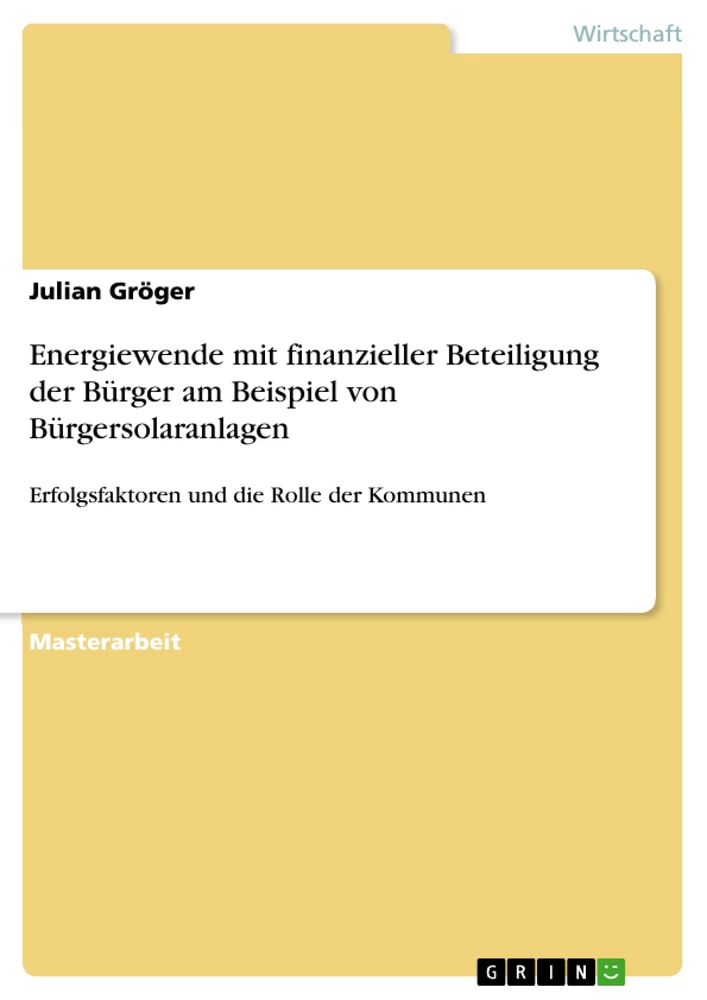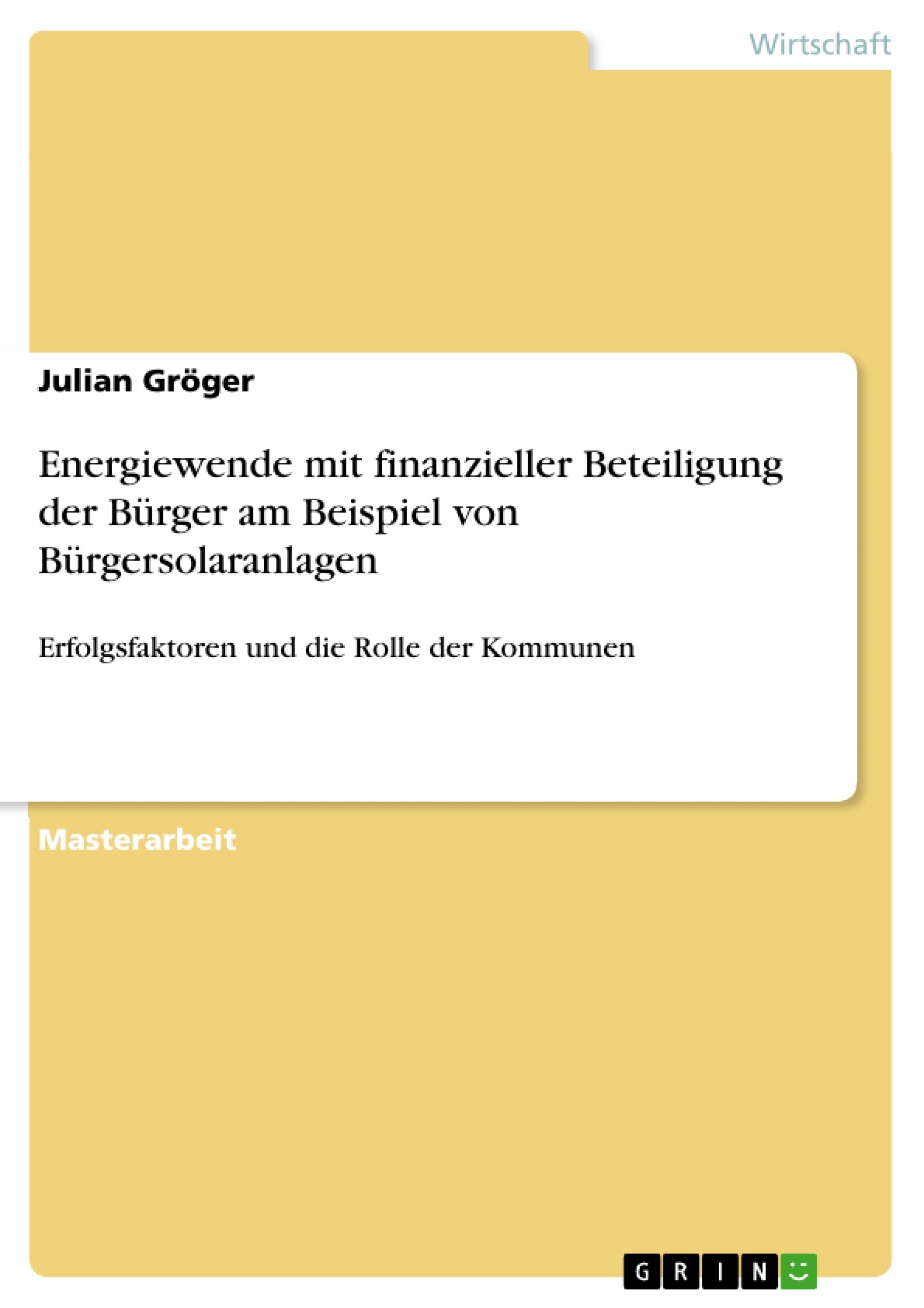Energiewende in Bürgerhand. Mehr und mehr Menschen verstehen, dass sie sich aktiv in die Diskussionen um das EEG einbringen können und dabei Geld verdienen können. Sozial-ökonomische Unterschiede können dadurch ausgeglichen werden, indem sich Bürger zusammenschließen und gemeinsam Anlagen bauen. Dann reicht auch oft eine geringe Investition und man benötigt kein eigenes Dach. Hinzu kommt, dass die Energiewende auf diese Art und Weise Bildungsarbeit in Sachen Energieproduktion bereitet und Menschen (meist Nachbarschaften) zusammenbringt.
Diese Masterarbeit bespricht folgende Fragen: Welche Formate gibt es bei einer Bürgersolaranlage? Unter welchen Bedingungen schließen sich Menschen zu solch einer gemeinsamen Investition zusammen? Wann sind sie erfolgreich? Und was kann eine Kommune tun, um solche Initiativen zu fördern? Die Arbeit schließt mit Handlungsempfehlungen für Initiativen und Entscheidungsträger in Kommunen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Fragestellung und Ziel der Untersuchung
- 1.3 Untersuchungsgegenstand
- 1.4 Forschungsstand
- 1.4.1 Kompetenz in den Regionen und Kommunen
- 1.4.2 Akteure eines nachhaltigen Ausbaus von Erneuerbaren Energien
- 1.4.3 Erfolgsbedingungen für Solarinitiativen
- 1.4.3.1 Erfolgsbedingungen aus Sicht des Ressourcenmobilisierungsansatz
- 1.4.3.2 Erfolgsbedingungen aus Sicht des Collective Action Problems
- 1.5 Aufbau der Arbeit
- 2. Bürgersolaranlagen
- 2.1 Struktur
- 2.1.1 Rechtsform einer Bürgersolarinitiative
- 2.1.2 Soziale Struktur der Bürgersolarinitiativen
- 2.2 Regionale Verteilung
- 2.3 Motivationen
- 2.4 Gründe für die Zunahme von Bürgersolarinitiativen
- 2.4.1 Wirtschaftliche Gründe
- 2.4.2 Gesellschaftlich-politische Gründe
- 2.5 Hemmnisse
- 2.5.1 Technologische Hemmnisse
- 2.5.2 Kommunikative Hemmnisse
- 2.5.3 Bürokratische Hemmnisse
- 2.6 Rolle der Kommune
- 3. Methodik und Vorgehen
- 3.1 Hypothesen
- 3.1.1 Annahmen aus des Ressourcen mobilisierungsansatzes
- 3.1.2 Energieversorgung mit Erneuerbaren Energien als Collective Action Problem
- 3.1.3 Gewonnene Hypothesen aus Experteninterviews
- 3.1.4 Abgleich mit Abfrage von einigen Initiativen
- 3.1.5 Arbeitshypothesen für die Fallstudien
- 3.2 Methode und Fallauswahl
- 3.3 Einschränkungen
- 4. Datenerhebung und -auswertung
- 4.1 Fallstudie 1 Beelitz
- 4.1.1 Zum Projekt der Fallstudie 1
- 4.1.2 Zur Person: Elke Seidel
- 4.1.3 Ergebnisse der Fallstudie 1
- 4.2 Fallstudie 2 Solarverein Berlin-Brandenburg e.V.
- 4.2.1 Zum Projekt der Fallstudie 2
- 4.2.2 Zur Person: Claudia Pirch-Masloch und Peter Masloch
- 4.2.3 Ergebnisse der Fallstudie 2
- 4.3 Weitere Erkenntnisse aus den Fallstudien
- 4.4 Zusammenfassungen der wichtigsten Ergebnisse
- 5. Diskussion der Ergebnisse und Ausblick
- 5.1 Handlungsempfehlungen
- 5.1.1 An aktive Bürger
- 5.1.2 An Kommunen
- 5.2 Ausblick und offene Forschungsfragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Erfolgsfaktoren von Bürgersolaranlagen und die Rolle der Kommunen bei deren Umsetzung. Ziel ist es, die wichtigsten Faktoren zu identifizieren, die den Aufbau solcher Anlagen fördern oder behindern. Die Arbeit basiert auf sozialwissenschaftlichen Theorien und empirischen Daten aus Experteninterviews und Fallstudien.
- Erfolgsfaktoren von Bürgersolarinitiativen
- Rolle der Kommunalverwaltung bei der Umsetzung von Bürgersolarprojekten
- Relevanz von sozialen Bewegungen und kollektivem Handeln für die Energiewende
- Analyse von Hemmnissen bei der Realisierung von Bürgersolaranlagen
- Wirtschaftliche und gesellschaftlich-politische Motivationen für Bürgersolarinitiativen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Energiewende in Deutschland ein und beschreibt die wachsende Bedeutung erneuerbarer Energien vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Ressourcenknappheit fossiler Brennstoffe. Sie benennt die zunehmende Bedeutung von Bürgersolaranlagen und formuliert die zentrale Forschungsfrage der Arbeit: Welche Faktoren fördern oder behindern den Aufbau von Bürgersolaranlagen? Der Forschungsstand wird skizziert, wobei bestehende Literatur zu Kompetenzverteilung, Akteuren der Energiewende und Erfolgsfaktoren von Solarinitiativen beleuchtet wird. Der Aufbau der Arbeit wird abschließend erläutert.
2. Bürgersolaranlagen: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung von Bürgersolaranlagen. Es beleuchtet die rechtlichen und sozialen Strukturen solcher Initiativen, analysiert deren regionale Verteilung und untersucht die unterschiedlichen Motivationen der Beteiligten. Ein wichtiger Teil dieses Kapitels ist die Diskussion der Gründe für die Zunahme von Bürgersolarinitiativen, sowohl wirtschaftlicher als auch gesellschaftlich-politischer Natur. Schließlich werden wichtige Hemmnisse für die Umsetzung von Projekten betrachtet, darunter technologische, kommunikative und bürokratische Herausforderungen. Die Rolle der Kommune als wichtiger Akteur wird hier bereits angesprochen.
3. Methodik und Vorgehen: Das Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es werden Hypothesen formuliert, die auf Theorien der Ressourcenmobilisierung und des Collective Action Problems basieren, sowie auf Erkenntnissen aus Experteninterviews. Die ausgewählte Methode, die Fallstudien, wird detailliert erläutert, ebenso wie die Auswahl der Fallstudienorte und die damit verbundenen Einschränkungen.
4. Datenerhebung und -auswertung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der beiden durchgeführten Fallstudien in Beelitz und mit dem Solarverein Berlin-Brandenburg e.V. Für jede Fallstudie werden das jeweilige Projekt, die befragten Personen und die wichtigsten Ergebnisse detailliert dargestellt und analysiert. Die gewonnenen Erkenntnisse werden miteinander verglichen und zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Energiewende, Bürgersolaranlagen, Bürgerbeteiligung, Kommunen, Ressourcenmobilisierung, Collective Action Problem, Fallstudien, Nachhaltigkeit, Erneuerbare Energien, Soziale Bewegungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Erfolgsfaktoren von Bürgersolaranlagen
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Erfolgsfaktoren von Bürgersolaranlagen und die Rolle der Kommunen bei deren Umsetzung. Das zentrale Ziel ist die Identifizierung von Faktoren, die den Aufbau solcher Anlagen fördern oder behindern. Die Arbeit stützt sich auf sozialwissenschaftliche Theorien und empirische Daten aus Experteninterviews und Fallstudien.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Erfolgsfaktoren von Bürgersolarinitiativen, die Rolle der Kommunalverwaltung, die Relevanz sozialer Bewegungen und kollektiven Handelns für die Energiewende, Hemmnisse bei der Realisierung von Bürgersolaranlagen sowie wirtschaftliche und gesellschaftlich-politische Motivationen für Bürgersolarinitiativen.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer Kombination aus sozialwissenschaftlichen Theorien (Ressourcenmobilisierung und Collective Action Problem), Experteninterviews und zwei Fallstudien. Die Fallstudien wurden in Beelitz und mit dem Solarverein Berlin-Brandenburg e.V. durchgeführt. Die Auswahl der Fallstudien und die damit verbundenen Einschränkungen werden detailliert beschrieben.
Welche Hypothesen wurden aufgestellt?
Die Arbeit formuliert Hypothesen basierend auf dem Ressourcenmobilisierungsansatz und dem Collective Action Problem. Zusätzlich werden Hypothesen aus Experteninterviews abgeleitet und mit Ergebnissen aus einer Abfrage von einigen Initiativen abgeglichen. Daraus werden schließlich Arbeitshypothesen für die Fallstudien entwickelt.
Welche Ergebnisse wurden in den Fallstudien erzielt?
Die Fallstudien in Beelitz und mit dem Solarverein Berlin-Brandenburg e.V. analysieren die jeweiligen Projekte, befragen beteiligte Personen (Elke Seidel, Claudia Pirch-Masloch und Peter Masloch) und präsentieren detaillierte Ergebnisse. Diese Ergebnisse werden verglichen und zusammengefasst, um zentrale Erkenntnisse zu gewinnen.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Arbeit formuliert Handlungsempfehlungen für aktive Bürger und Kommunen, die den Aufbau und die erfolgreiche Umsetzung von Bürgersolarprojekten fördern sollen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Energiewende, Bürgersolaranlagen, Bürgerbeteiligung, Kommunen, Ressourcenmobilisierung, Collective Action Problem, Fallstudien, Nachhaltigkeit, Erneuerbare Energien und Soziale Bewegungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Problemstellung, Fragestellung, Forschungsstand, Aufbau), Bürgersolaranlagen (Struktur, regionale Verteilung, Motivationen, Hemmnisse, Rolle der Kommune), Methodik und Vorgehen (Hypothesen, Methode, Fallauswahl, Einschränkungen), Datenerhebung und -auswertung (Fallstudien, Ergebnisse) und Diskussion der Ergebnisse und Ausblick (Handlungsempfehlungen, offene Forschungsfragen).
- Quote paper
- Julian Gröger (Author), 2011, Energiewende mit finanzieller Beteiligung der Bürger am Beispiel von Bürgersolaranlagen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205697