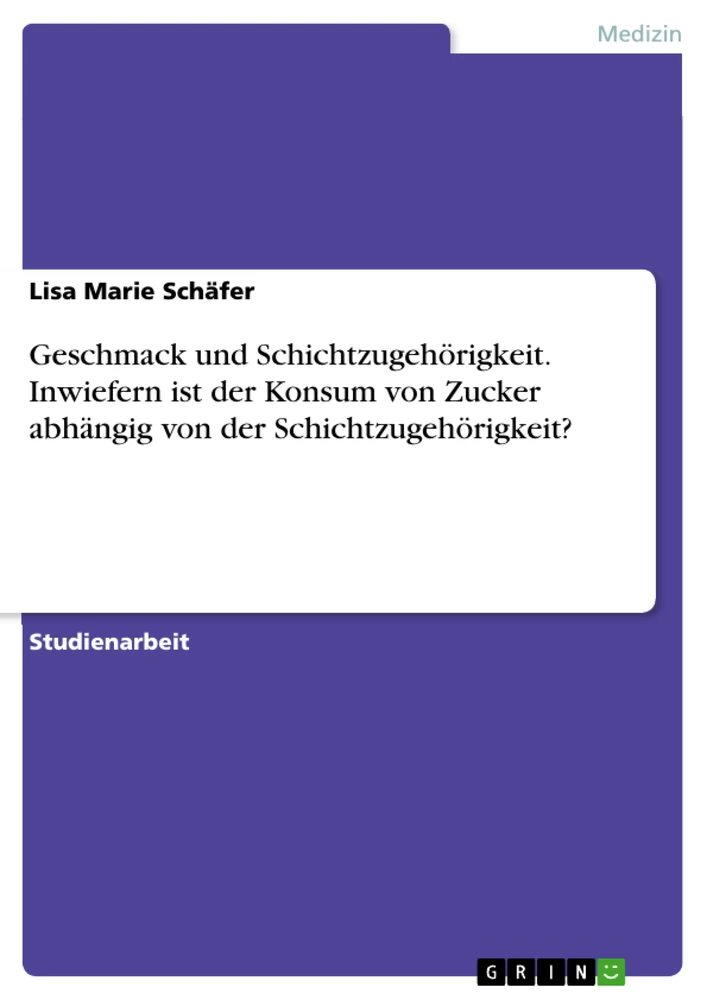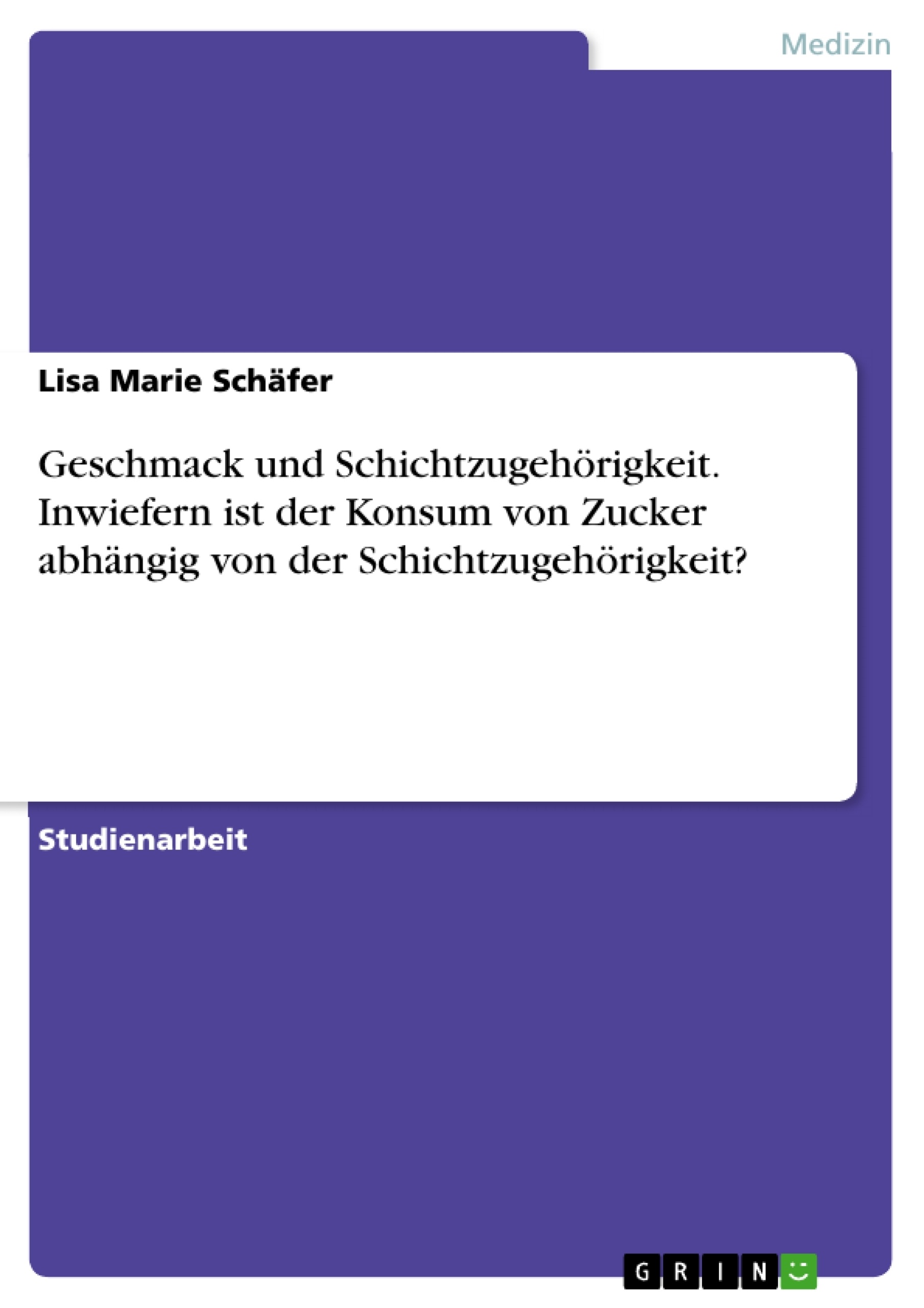Diskussionen über Zucker sind in aller Munde – die „Volksdroge“ soll indirekt jährlich bis zu 35 Millionen Todesfälle weltweit fordern. Gesundheitswissenschaftler und Ärzte warnen vor den Folgen von erhöhtem Zuckerkonsum und fordern ähnlich strenge Kontrollen wie für Alkohol und Tabak, da Saccharose Krankheiten wie Adipositas, Bauchspeicheldrüsenleiden und Zahnfäule fördere und zum Risiko von Herz-Kreislauf-Krankheiten und Autoimmunerkrankungen beitrage.
Angesichts dieser Tatsachen stellt sich die Frage, warum Zucker trotzdem eine so zentrale Rolle in unseren alltäglichen Essgewohnheiten einnimmt und vor allem wer vom erhöhten Konsum betroffen ist.
Ziel dieser Arbeit ist es, am Zuckerverzehr exemplarisch darzulegen, wie die Schichtzugehörigkeit den Konsum von ungesunden Lebensmitteln beeinflusst und welche Gründe es dafür geben kann. Der theoretische Hintergrund ist Pierre Bourdieus Untersuchung zum Geschmack: „Die feinen Unterscheide“.
Als Einstieg wird Bourdieus Theorie des Habitus und der Lebensstile zum klassenspezifischen Geschmack aus dem Jahr 1982 in ihren Grundzügen vorgestellt.
Daran anschließend wird der geschichtliche Hintergrund des Zuckerkonsums mit Hilfe der Texte „Die süße Macht. Kulturgeschichte des Zuckers“ von Sidney Mintz und „Kochende Leidenschaft. Soziologie vom Kochen und Essen“ von Jean-Claude Kaufmann dargelegt und Bourdieus Untersuchung zum Geschmack darauf angewendet.
Daraufhin wird im dritten Kapitel der aktuelle Zuckerkonsum zunächst auf Basis des Absatzes und der allgemeinen Verzehrgewohnheiten analysiert. Schließlich auf den Einfluss der sozioökonomischen Faktoren bzw. der Schichtzugehörigkeit untersucht und es werden denkbare Ursachen der Konsumunterschiede demonstriert.
Abschließend werden die Ergebnisse dieser Arbeit im Fazit prägnant zusammengefasst und mögliche Ansatzpunkte für Verbesserungen aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Bourdieus Theorie zu Geschmack und Schichtzugehörigkeit
2. Geschichtlicher Hintergrund des Zuckerverzehrs
3. Derzeitige Situation des Zuckerkonsums in Deutschland
3.1 Fakten zum Zuckerkonsum
3.1.1 Zuckerabsatz
3.1.2 Zuckerverzehr
3.2 Einflüsse des Zuckerkonsums
3.2.1 Sozioökonomische Faktoren
3.3.3 Ursachen des ungleichen Verzehrs
4. Fazit / Ausblick
Literaturverzeichnis
Einleitung
Diskussionen über Zucker sind in aller Munde - die „Volksdroge“ soll indirekt jährlich bis zu 35 Millionen Todesfälle weltweit fordern. Gesundheitswissenschaftler und Ärzte warnen vor den Folgen von erhöhtem Zuckerkonsum und fordern ähnlich strenge Kontrollen wie für Alkohol und Tabak, da Saccharose Krankheiten wie Adipositas, Bauchspeicheldrüsenleiden und Zahnfäule fördere und zum Risiko von Herz-Kreislauf- Krankheiten und Autoimmunerkrankungen beitrage1.
Angesichts dieser Tatsachen stellt sich die Frage, warum Zucker trotzdem eine so zentrale Rolle in unseren alltäglichen Essgewohnheiten einnimmt und vor allem wer vom erhöhten Konsum betroffen ist.
Ziel dieser Arbeit ist es, am Zuckerverzehr exemplarisch darzulegen, wie die Schichtzugehörigkeit2 den Konsum von ungesunden Lebensmitteln beeinflusst und welche Gründe es dafür geben kann. Der theoretische Hintergrund ist Pierre Bourdieus Untersuchung zum Geschmack: „Die feinen Unterscheide“.
Als Einstieg wird Bourdieus Theorie des Habitus und der Lebensstile zum klassenspezifischen Geschmack aus dem Jahr 1982 in ihren Grundzügen vorgestellt. Daran anschließend wird der geschichtliche Hintergrund des Zuckerkonsums mit Hilfe der Texte „Die süße Macht. Kulturgeschichte des Zuckers“ von Sidney Mintz und „Kochende Leidenschaft. Soziologie vom Kochen und Essen“ von Jean-Claude Kaufmann dargelegt und Bourdieus Untersuchung zum Geschmack darauf angewendet.
Daraufhin wird im dritten Kapitel der aktuelle Zuckerkonsum zunächst auf Basis des Absatzes und der allgemeinen Verzehrgewohnheiten analysiert. Schließlich auf den Einfluss der sozioökonomischen Faktoren bzw. der Schichtzugehörigkeit untersucht und es werden denkbare Ursachen der Konsumunterschiede demonstriert.
Abschließend werden die Ergebnisse dieser Arbeit im Fazit prägnant zusammengefasst und mögliche Ansatzpunkte für Verbesserungen aufgezeigt.
1. Bourdieus Theorie zu Geschmack und Schichtzugehörigkeit
Bourdieu ist der Auffassung, dass Geschmack nichts Individuelles, sondern etwas von der Gesellschaft und dem sozialen Umfeld Geprägtes ist. Dabei spielen Sozialisation und soziale Herkunft eine entscheidende Rolle, da sie den Habitus ausbilden (vgl. Joas/Knöbl 2004: 534).
Dieser ist als Wahrnehmungs- und Bewertungsschema zu verstehen (vgl. Joas 2007: 250), das sich beispielsweise neben Körpersprache, Kleidung und der Ausübung von Hobbies auch im Ess- und Trinkverhalten ausdrückt (vgl. Schilcher 2001: 16). Von Bedeutung ist, dass es sich dabei um ein unbewusstes Verhalten handelt, welches nur sehr langfristig und über Sozialisation veränderbar ist. So verhält es sich auch mit dem Geschmack: „Lebensstile die keineswegs bewusst gewählt sein müssen, offenbaren sich vor allem im klassenspezifischen Geschmack, den besonderen Vorlieben für oder gegen Musik-, Literatur-, Kunstrichtungen oder Moden und Essgewohnheiten, und in der „Distinktion“, also der Abgrenzung gegenüber anderen Lebensstilen.“ (Joas 2007: 250)
Bourdieu differenziert hierbei drei Arten des Geschmacks:
- den legitimen Geschmack
- den mittleren Geschmack
- den populären Geschmack
Der „legitime Geschmack“ ist größtenteils bei der herrschenden Klasse wiederzufinden. Diese grenzt sich durch den sogenannten „Luxusgeschmack“ von den unteren Klassen ab und reproduziert damit immer wieder Grenzen und Unterschiede zwischen diesen (vgl. Joas/Knöbl 2004: 552).
„Wer in die Oberschicht hineingeboren wird, dem wird ein Eßgeschmack und ein diesbezüglicher Habitus ansozialisiert, durch den er sich fast automatisch deutlich von Personen anderen Standes abgrenzt.“ (Joas/Knöbl 2004: 553)
Mit dem „mittleren Geschmack“ versucht die Mittelklasse laut Bourdieu dem Konsumverhalten der herrschenden Klasse nachzueifern. Dies allerdings ohne Erfolg, da es die Oberklasse immerzu versteht sich eindeutig abzugrenzen.
Der „populäre Geschmack“ ist die Geschmacksart der unteren Klassen. Er ist als „Notwendigkeitsgeschmack“ das Gegenstück zum „Luxusgeschmack“.
Das Existentielle, Machbare und Praktische steht im Vordergrund (vgl. Joas 2007: 250), wobei Bedürfnisse und Möglichkeiten so eng miteinander verbunden sind, dass auch nur das angestrebt wird, was auch zu erreichen ist (vgl. Schilcher 2001: 20).
2. Geschichtlicher Hintergrund des Zuckerverzehrs
Die Theorie des klassenspezifischen Geschmacks lässt sich an der Geschichte des Zuckerkonsums nachvollziehen.
Das Verlangen nach Zucker ist sehr alt. Entdeckt in Persien und Indien, ausgebreitet über den Mittleren Osten und die Mittelmeerregion und schließlich als Heilmittel im Mittelalter in Europa verwendet, gewann Zucker aus Zuckerrohr immer mehr an Bedeutung. Vor allem die Engländer begehrten das damals noch rare Gewürz. Aufgrund des hohen Preises und der Seltenheit wurde Zucker zum Kennzeichen des „guten Geschmacks“. Er wurde vorwiegend vom Großbürgertum konsumiert (vgl. Kaufmann 2005: 48f). Damit trat genau das ein, was Bourdieu in seiner klassenspezifischen Geschmackstheorie später formulierte: Zucker wurde als Rarität zum Symbol des „legitimen Geschmacks“, das Großbürgertum konnte sich mit dem Zuckerkonsum vom Gewöhnlichen absetzen - „Das erste entscheidende Element in der Geschichte des Zuckers entstammte dem Prozess der Herausbildung sozialer Unterschiede.“ (Kaufmann 2005: 49)
Im 17. Jahrhundert setzte sich England mit Hilfe von Sklaven an die Spitze des globalen Zuckerhandels. Produktion und Konsum bedingten sich damit von Beginn an gegenseitig, das Imperium vergrößerte sich und Zucker wurde wie Tee zum „Definitionsmerkmal des englischen ‚Charakters’“ (vgl. Mintz 1987: 68).
Aufgrund des steigenden Imports, wurde Zucker billiger und verbreitete sich in der Bevölkerung von den Adeligen über großbürgerliche Kaufleute, Unternehmern und Ladenbesitzern bis hin zur arbeitenden Stadtbevölkerung. Er lieferte Energie, bereitete wenig Arbeit in der Zubereitung und war für jedermann geschmacklich akzeptabel (vgl. Kaufmann 2005: 49f). Infolgedessen wurde der Zuckerkonsum in Bezug auf Bourdieus Theorie zum Bestandteil des „Notwendigkeitsgeschmacks“. Diese Tatsache und ihre Konsequenz formulierte Mintz folgendermaßen: „Die Abnahme der symbolischen Bedeutung des Zuckers und die Zunahme seiner ökonomischen und ernährungstechnischen Relevanz hielten sozusagen negativ miteinander Schritt. Als der Zucker billiger wurde und
[...]
1 http./Avww .sueddeutsche.de/gesundheitAis- forscher- fordcm-kontrollcn-zucker-so-schaedlich-wie-alkohol-1.1273197 - letzter Aufruf: 19.02.2012
2 Schichtzugehörigkeit wird in meiner Arbeit aufgrund von unzureichender Abgrenzung in Theorie und empirischen Studien ambivalent mit den Begriffen Klasse, Stand und sozialer Status verwendet.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Zuckerkonsum von der Schichtzugehörigkeit abhängig?
Ja, soziologische Studien und Bourdieus Theorie zeigen, dass Menschen in unteren sozialen Schichten tendenziell mehr Zucker konsumieren, was oft mit dem „Notwendigkeitsgeschmack“ und ökonomischen Faktoren zusammenhängt.
Was versteht Pierre Bourdieu unter „Habitus“ beim Essen?
Der Habitus ist ein unbewusstes Wahrnehmungs- und Bewertungsschema. Er prägt den Geschmack so, dass sich soziale Klassen durch ihre Essgewohnheiten voneinander abgrenzen (Distinktion).
Warum war Zucker früher ein Symbol der Oberschicht?
Im Mittelalter und der frühen Neuzeit war Zucker eine seltene, teure Rarität. Sein Konsum signalisierte Reichtum und „legitimen Geschmack“. Erst durch Massenproduktion wurde er zum billigen Energielieferanten für die Arbeiterschicht.
Was ist der „Notwendigkeitsgeschmack“?
Dies ist der Geschmack der unteren Klassen, bei dem das Praktische, Sättigende und Preiswerte im Vordergrund steht. Zucker bietet hier eine schnelle, billige Energiequelle.
Welche gesundheitlichen Folgen hat ein hoher Zuckerkonsum?
Erhöhter Zuckerkonsum fördert Krankheiten wie Adipositas, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Zahnfäule, weshalb Wissenschaftler oft strengere Kontrollen fordern.
- Citar trabajo
- Lisa Marie Schäfer (Autor), 2012, Geschmack und Schichtzugehörigkeit. Inwiefern ist der Konsum von Zucker abhängig von der Schichtzugehörigkeit?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206034