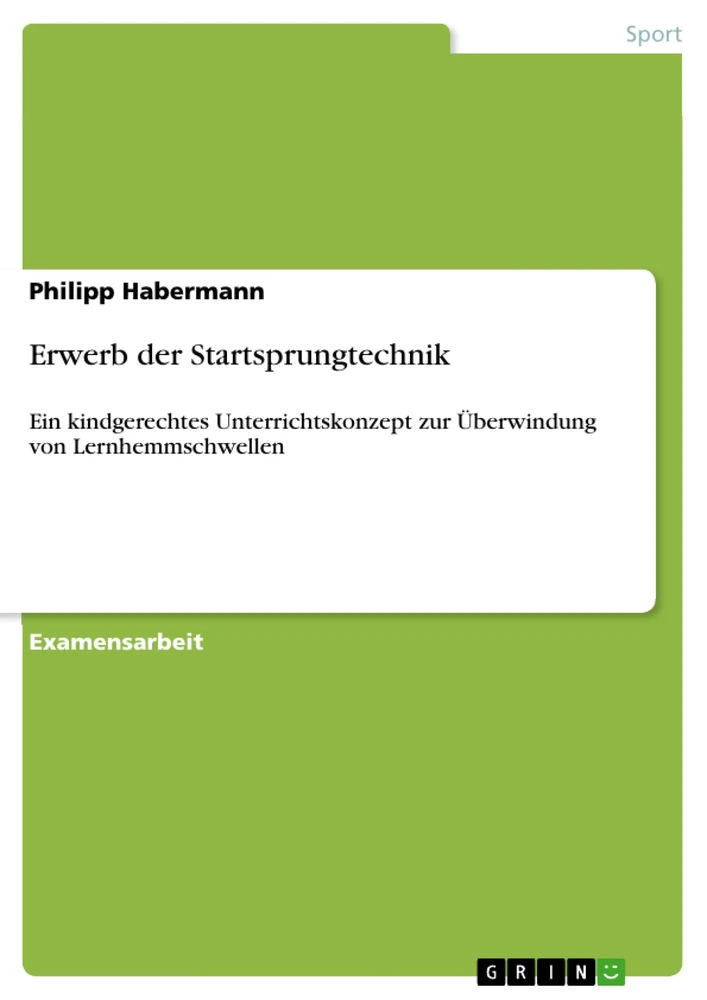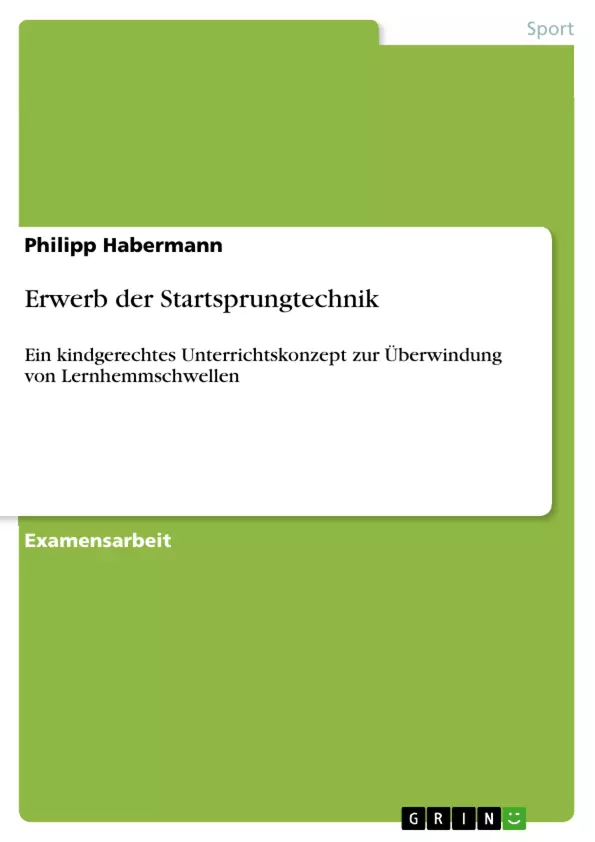Die vorliegende Arbeit „Erwerb der Startsprungtechnik – Ein kindgerechtes Unterrichtskonzept zur Überwindung von Lernhemmschwellen“ behandelt die pädagogische Arbeit mit Kindern des dritten Schuljahrs, die schrittweise unter Überwindung Hemmschwellen unterschiedlicher Art an die Technik des Startsprungs herangeführt werden.
Der Begriff der Schwelle leitet sich aus dem mittelhochdeutschen Wort „swelle“ ab und bedeutet „tragender Balken“. Schon daraus ergibt sich, dass das Wort „Schwelle“ zunächst positiv besetzt ist. Auch die Türschwelle, ein Brett oder ein flacher Stein zwischen den senkrechten Pfosten des Türrahmens, hat tragende Funktion. Im Begriff der Türschwelle wird sinnhaft deutlich, was es heißt, eine Schwelle zu überschreiten: sich aus einem Bereich in einen anderen, möglicherweise unbekannten, zu begeben.
Im Begriff der „Hemmschwelle“ wird deutlich, dass dieses Hinübertreten in einem unbekannten Bereich instinktiv als gefährlich erkannt wird. In der Psychologie beschreibt der Begriff der Hemmschwelle das Phänomen, „dass ein Mensch erst nach besonders intensiver Motivation bereit ist, eine bestimmte Aktion auszuüben, wenn diese gegen erlernte oder ererbte Verhaltensweisen verstößt.“ Diese Definition subsummiert unter den ererbten Verhaltensweisen alle natürlichen Ängste und Schutzmechanismen, die individuell unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. So wird etwa ein Mensch im Regelfall instinktiv vermeiden, kopfüber in ein unbekanntes Gewässer zu springen. Das bedeutet, dass etwaige Lernhemmschwellen beim Startsprung einem natürlichen Selbstschutzmechanismus entspringen. Hier ist es Aufgabe der Lehrkraft, die Schülerinnen und Schüler durch Vermittlung von Selbstvertrauen und technischem Können über diese Schwelle zu begleiten.
Nicht zufällig wird oft der „Sprung ins kalte Wasser“ zitiert. Die Redensart ist nahezu auf jeden Lebensbereich anwendbar. Auch in ihr spielt der plötzliche Wechsel von dem vertrauten Bereich des „festen Bodens“ in ein möglicherweise gefährliches oder sogar feindliches Element eine Rolle. Unsere Schülerinnen und Schüler werden bei der Vermittlung von Fertigkeiten zum Erwerb der Startsprungtechnik mit der Notwendigkeit zu diesem Sprung konfrontiert. Das kindgerechte Unterrichtskonzept zur Überwindung von Lernhemmschwellen erhält dadurch eine Bedeutung, die weit über das Erlernen der Technik des Startsprungs hinausgeht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Lernrelevante Bedingungen des Unterrichts
- 2.1 Institutionelle / situative Bedingungen und Voraussetzungen
- 2.2 Soziokulturelle Voraussetzungen
- 2.3 Anthropogen-psychologische Voraussetzungen
- 2.4 Lernausgangslage
- 3. Entscheidungsfelder des Unterrichts
- 3.1 Thematik
- 3.1.1 Begründung der Themenwahl
- 3.1.2 Legitimation des Themas
- 3.2 Sachstrukturanalyse
- 3.2.1 Allgemeines zum Startsprung
- 3.2.2 Greifstart
- 3.2.3 Ausgangslage
- 3.2.4 Absprung
- 3.2.5 Flugphase
- 3.2.6 Eintauchphase
- 3.3 Didaktische Analyse
- 3.3.1 Exemplarität, Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung
- 3.3.2 Didaktische Reduktion
- 3.3.2.1 Reduktion der Ausgangslage
- 3.3.2.2 Reduktion des Absprungs
- 3.3.2.3 Reduktion der Flugphase
- 3.3.2.4 Reduktion der Eintauchphase
- 3.1 Thematik
- 4. Erwartete Lernhemmschwellen
- 4.1 Kopfstellreflex
- 4.2 Physische Lernhemmschwellen
- 4.3 Psychische Lernhemmschwellen
- 5. Methodische Analyse
- 6. Zielgerichtete Übungsfolge
- 7. Unterrichtssequenz in vereinfachter Darstellung
- 7.1 Inhalte der 1. und 2. Stunde (0XXX)
- 7.1.1 Ausgleiten
- 7.1.2 Delfinsprünge
- 7.1.3 Sitzköpfer
- 7.2 Inhalte der 3. - 5. Stunde (XXX, XXX)
- 7.2.1 Knieköpfer
- 7.2.2 Hockköpfer
- 7.2.3 Startsprung vom Beckenrand
- 7.3 Inhalte der 6. Stunde (XXX)
- 7.1 Inhalte der 1. und 2. Stunde (0XXX)
- 8. Schlussreflexion
- 8.1 Die Themenwahl im Rückblick
- 8.2 Wahl der methodischen Vorgehensweise
- 8.3 Umgang mit Lernhemmschwellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der pädagogischen Arbeit mit Kindern der dritten Jahrgangsstufe, die schrittweise an die Technik des Startsprungs herangeführt werden. Die Arbeit zielt darauf ab, ein kindgerechtes Unterrichtskonzept zu entwickeln, das die Überwindung von Lernhemmschwellen unterstützt und somit den Erfolg der Schülerinnen und Schüler beim Erlernen der Startsprungtechnik fördert.
- Die Überwindung von Lernhemmschwellen beim Startsprung
- Die Entwicklung eines kindgerechten Unterrichtskonzepts
- Die Bedeutung von individueller Motivation und Selbstvertrauen
- Die schrittweise Annäherung an die Startsprungtechnik
- Die Berücksichtigung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Themenstellung und die Relevanz des Themas „Erwerb der Startsprungtechnik“ im Kontext von Lernhemmschwellen erläutert. Kapitel 2 beleuchtet die lernrelevanten Bedingungen des Unterrichts, unterteilt in institutionelle, soziokulturelle, anthropogen-psychologische und lernmethodische Voraussetzungen. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Entscheidungsfeldern des Unterrichts und analysiert die Sachstruktur des Startsprungs sowie die didaktischen Aspekte der Thematik.
Kapitel 4 widmet sich den erwarteten Lernhemmschwellen, wie dem Kopfstellreflex, physischen und psychischen Herausforderungen. Kapitel 5 betrachtet die methodische Analyse des Unterrichts, während Kapitel 6 eine zielgerichtete Übungsfolge für den Erwerb der Startsprungtechnik darstellt. Kapitel 7 präsentiert eine detaillierte Unterrichtssequenz, die die Inhalte der einzelnen Stunden des Unterrichtskonzepts aufzeigt. Abschließend reflektiert das 8. Kapitel die Themenwahl, die methodische Vorgehensweise und den Umgang mit Lernhemmschwellen im Kontext der durchgeführten Unterrichtseinheit.
Schlüsselwörter
Startsprungtechnik, Lernhemmschwellen, kindgerechtes Unterrichtskonzept, Schwelle, Motivation, Selbstvertrauen, Didaktische Analyse, Sachstrukturanalyse, Übungsfolge, Unterrichtssequenz, Lerngruppe, dritte Jahrgangsstufe, Grundschule.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Lernhemmschwellen beim Startsprung?
Lernhemmschwellen sind natürliche Ängste und Selbstschutzmechanismen, wie die Angst vor dem Eintauchen kopfüber oder der instinktive Kopfstellreflex, die den Sprung ins Wasser erschweren.
Wie sieht ein kindgerechtes Unterrichtskonzept für den Startsprung aus?
Es basiert auf einer schrittweisen Annäherung, beginnend mit Übungen wie Ausgleiten und Delfinsprüngen, gefolgt von „Sitzköpfern“ und „Knieköpfern“, um Vertrauen aufzubauen.
Was ist ein „Greifstart“?
Der Greifstart (Grab Start) ist eine moderne Technik des Startsprungs, bei der sich der Schwimmer mit den Händen am Startblock festhält, um beim Signal eine höhere Beschleunigung zu erzielen.
Welche Rolle spielt die didaktische Reduktion?
Die Technik wird in einfache Teilbewegungen zerlegt (Absprung, Flugphase, Eintauchen), damit Kinder nicht überfordert werden und schrittweise Erfolgserlebnisse haben.
Warum ist die psychische Lernausgangslage so wichtig?
Da jedes Kind unterschiedliche Vorerfahrungen und Angstniveaus hat, muss die Lehrkraft individuell motivieren und Selbstvertrauen vermitteln, um die Hemmschwelle zu überwinden.
- Quote paper
- Philipp Habermann (Author), 2012, Erwerb der Startsprungtechnik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206065