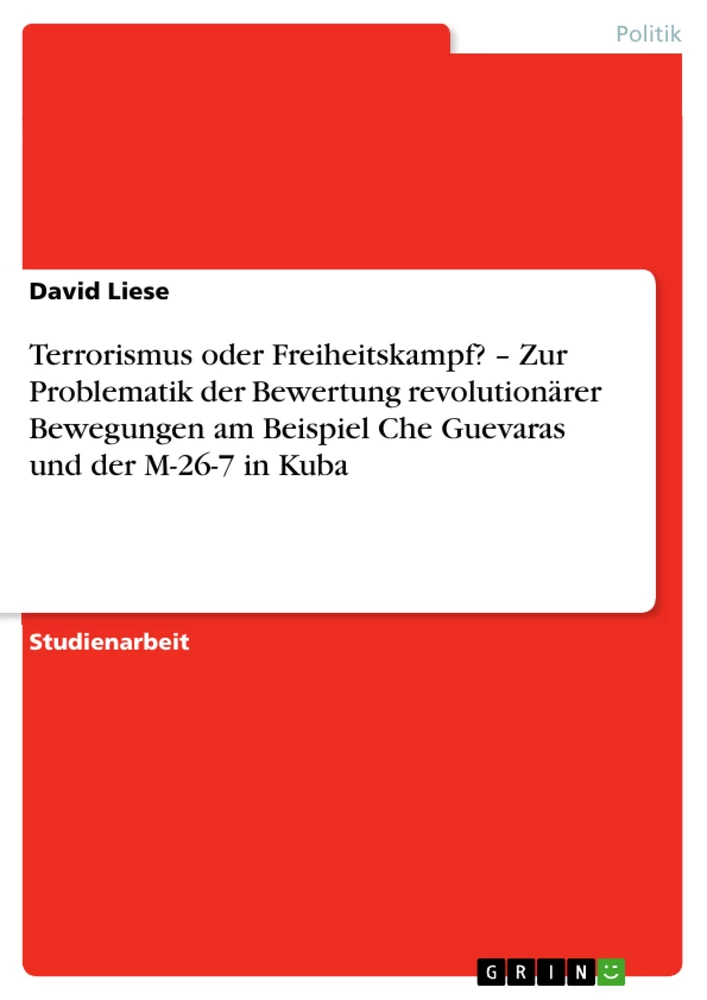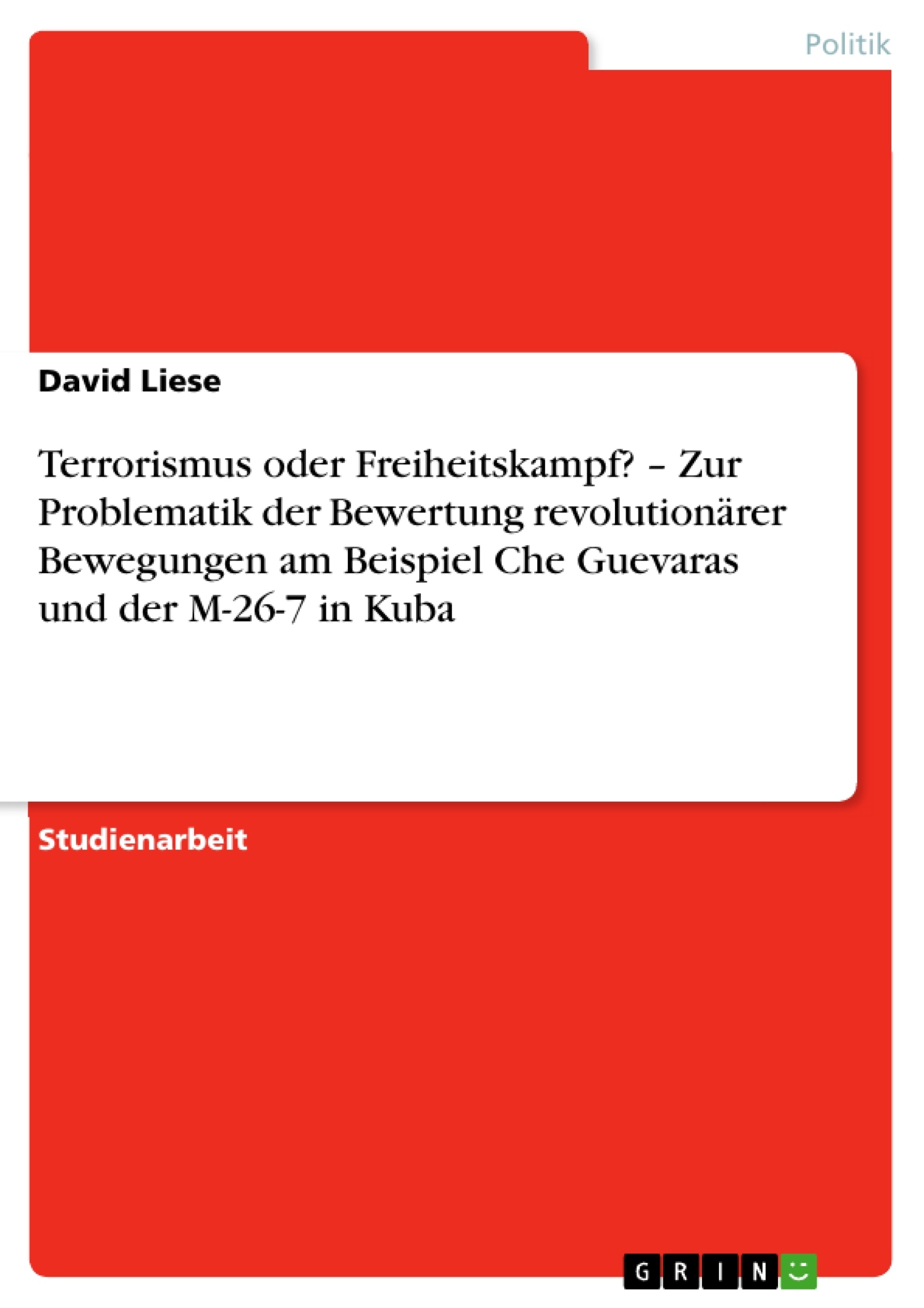Die Frage nach dem „Guten“ und „Bösen“, nach „Richtig“ und „Falsch“, kurz: die moralische Wertung spielt zweifelsohne eine große Rolle, wenn man den Menschen an sich und sein Verhalten untersuchen möchte. Große Philosophen von der Antike bis in die Neuzeit behandelten in ihrem Denken vor allem ethische Fragen nach der Moral; und immer schon liegt diesen Gedanken das Ziel zugrunde, eine möglichst objektive Regel für die Unterscheidung von Gutem und Bösen zu finden. Es scheint so, als würde der Mensch in seinem Innersten von dem tiefen Wunsch der Orientierung und der Bestätigung, dass das, was er tut, „richtig“ oder „gut“ ist, getrieben.
Es stellt sich auch diese jahrtausendealte Frage nach dem Guten und Richtigen, wenn das Handeln von politischen Akteuren betrachtet wird. Diesem normativen Charakter von Politikwissenschaft, der heute häufig von der deskriptiven Dimension in den Hintergrund gedrückt zu werden scheint, könnte man daher eigentlich sogar eine primäre Position zusprechen; nicht umsonst ist die moderne Politikwissenschaft schließlich direkt nach dem zweiten Weltkrieg entstanden, als der Schrecken und die Fassungslosigkeit über die Verbrechen der Nazi-Diktatur kaum eine sozialwissenschaftliche Disziplin unverändert ließ. Im Folgenden soll dieser Tradition nachgekommen werden und die Problematik der Bewertbarkeit von politischen Bewegungen anhand eines vieldiskutierten Beispiels untersucht werden: dem kubanischen Revolutionär Ernesto Che Guevara und der M-26-7. Ferner soll überprüft werden, ob eine solche Bewertung überhaupt durch eine objektive Methode erfolgen kann und was dies sowohl für die Politikwissenschaft als auch für die Politik selbst bedeutet.
Inhaltsverzeichnis
1. Warum bewerten? Die Bedeutung des Normativen für Politik und Politikwissenschaft
2. Methodische Annäherung an die Themenfrage: Der Kategorische Imperativ bei Kant und Marx
2.1 Grenzen wissenschaftlicher Begriffsdefinitionen
2.2 Sinnvoller: Findung eines Maßstabs für Moral – der Kategorische Imperativ
2.2.1 bei Kant: Formaler und intersubjektiver Weg zur Moral
2.2.2 bei Marx: Übertragung des Prinzips auf gesellschaftliche Veränderungen
3. Terrorismus oder Freiheitskampf? - Zur Problematik der Bewertung revolutionärer Bewegungen anhand des Beispiels Che Guevaras und der M-26-7 in Kuba
3.1 Öffentlich vorherrschende Rezeptionen der Kubanischen Revolution
3.1.1 Che Guevara als Person: Mythologisiertes Pop-Idol
3.1.2 Kubanische Revolution bzw. postrevolutionäres Kuba: „Umsturz statt Befreiung“
3.2 Schaffung des „neuen Menschen“: Die revolutionäre Theorie Che Guevaras
3.2.1 Warum Revolution? – Übertragung des marxistischen Klassenkampfes auf die Situation in Lateinamerika
3.2.2 Humanistischer Anspruch Guevaras
3.3 Die „praktische Seite“ der Revolution: Ausgangslage, Umsturz, postrevolutionäres Kuba
3.3.1 Die Ausgangslage: Der „Neokolonialismus“ der USA und das Batista- Regime
3.3.2 Der Verlauf der Revolution unter Anleitung Fidel Castros
3.3.3 Sozialismus als Entwicklungsmotor: Das postrevolutionäre Kuba
3.4 Versuch einer moralischen Bewertung gemäß der Ausgangsfrage: „Terrorismus oder Freiheitskampf?“
3.4.1 Handeln der Revolutionäre: Maxime für ein allgemeingültiges Gesetz?
3.4.2 Schaffung von freiheitlichen Verhältnissen? – Beurteilung gemäß des Marx'schen Kategorischen Imperatives
3.4.3 Zusammenfassung: Komparatistische Perspektive auf die kubanische Revolution
4. Konsequenzen für Politik und Politikwissenschaft
5. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wie lassen sich politische Bewegungen moralisch bewerten?
Die Arbeit nutzt den Kategorischen Imperativ von Kant und Marx als objektiven Maßstab, um zwischen "Gut" und "Böse" in der Politik zu unterscheiden.
War Che Guevara ein Freiheitskämpfer oder ein Terrorist?
Die Untersuchung analysiert Guevaras humanistischen Anspruch und seine Theorie des "neuen Menschen" im Kontrast zur praktischen Durchführung der kubanischen Revolution.
Was war die Ursache für die kubanische Revolution?
Zentrale Gründe waren der als "Neokolonialismus" wahrgenommene Einfluss der USA und die Unterdrückung durch das Batista-Regime.
Welche Rolle spielt das Normative in der Politikwissenschaft?
Trotz deskriptiver Trends bleibt die Frage nach der moralischen Richtigkeit politischen Handelns eine primäre Position der Disziplin.
Wie wird Che Guevara heute rezipiert?
Guevara wird oft als mythologisiertes Pop-Idol wahrgenommen, während die postrevolutionäre Realität Kubas kritisch als "Umsturz statt Befreiung" diskutiert wird.
- Quote paper
- B.A. David Liese (Author), 2011, Terrorismus oder Freiheitskampf? – Zur Problematik der Bewertung revolutionärer Bewegungen am Beispiel Che Guevaras und der M-26-7 in Kuba, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206178