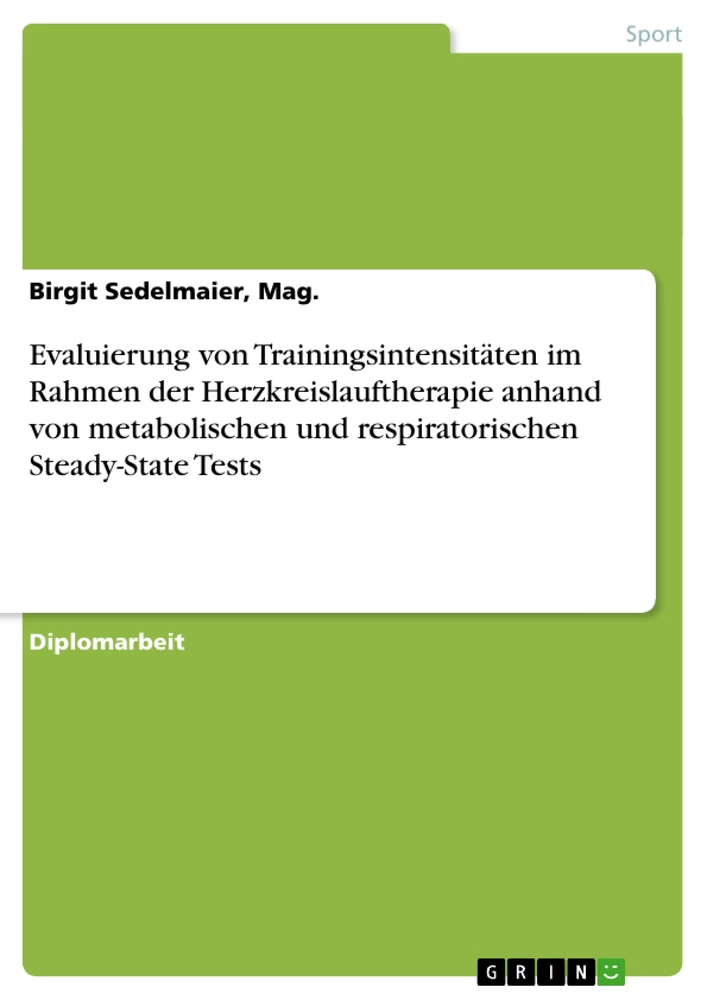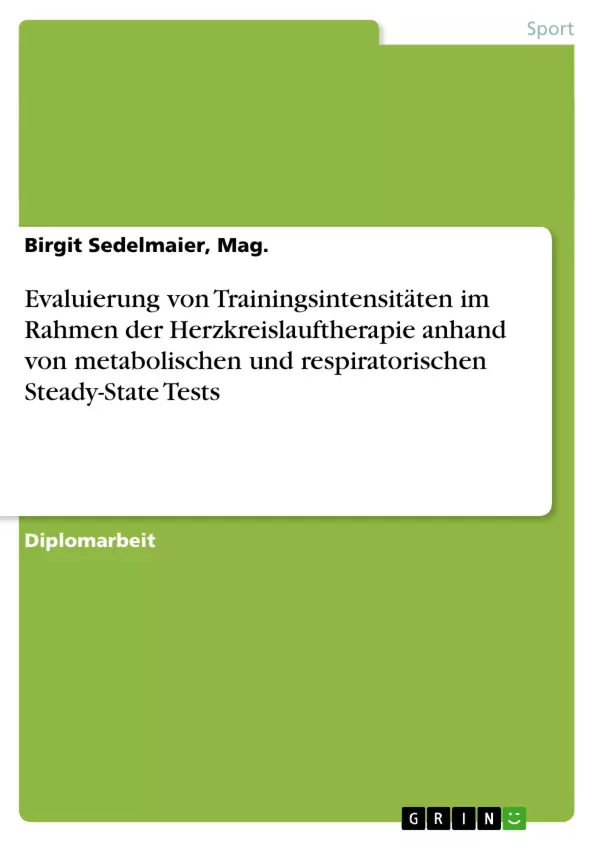“Physical activity and exercise training are designed to help patients
recover their age- and gender-appropriate exercise capacity following
an acute clinical episode or other circumstances that focus the need for
improving exercise tolerance.”
(Foster et al., 2001)
Dieses und viele andere Zitate bestätigen, welch wichtige Rolle körperliche
Aktivität und Training für gesunde und kranke Menschen zum Zwecke der
Aufrechterhaltung der körperlichen Leistungsfähigkeit und der
Gesundheitsvorsorge spielen. Kaum jemand wird den präventiven Effekt von exakt
dosierter und kontrollierter körperlicher Belastung, sowohl in der Primär-,
Sekundär- und Tertiärprävention, leugnen.
Körperliche Belastung, Training, Fitness usw. sind alle schmackhafte Stichwörter,
die uns von einem gesünderen Leben träumen lassen. Trotzdem sind es nur
Schlagwörter, die einem ein so großes Feld eröffnen, in dem man sich kaum
zurechtfindet, weil Exaktheit und Fassbarkeit fehlen. Der Laie, und vor allem der
kranke Laie, fühlt sich überfordert.
Jeder Organismus ist ein Einzelstück und auch der Trainingszustand und die
Trainingstoleranz verschiedener Personen sind sehr unterschiedlich. Die
Schwierigkeit liegt nun darin, individuelle Trainingsintensitäten einzugehen, bei
denen man nicht Gefahr läuft, sich selbst im Rahmen des Trainings zu überlasten,
die aber gleichzeitig ein Optimum an präventivmedizinischen Nutzen erwarten
lassen.
Mit dieser Arbeit stelle ich mich der Aufgabe, adäquate Trainingsintensitäten für
Herz-Kreislaufpatienten und Gesunde zu ermitteln.
Die Grundlage dazu ist ein 1-Minuten Stufentest bis zur Erschöpfung, der die
Daten für die Bestimmung der individuellen Ausdauerleistungsgrenze liefern soll. “The exercise prescription is ideally based on the results of a maximal
incremental exercise test.”
(FOSTER et al., 2001)
Mittels Laktatleistungskurve, Herzfrequenzleistungskurve und Atemgasanalyse
sollen Kennpunkte eruiert werden, die genau diese Ausdauergrenze anzeigen.
Durch eine quasi biologische Eichung mit zwei bis drei Steady-State Tests am
Probanden selbst, soll herausgefunden werden, ob Kennpunkte, die auf der
Laktat- und/oder Herzfrequenzleistungskurve basieren, zulässige Parameter zur
Bestimmung von geeigneten Trainingsbelastungen sind.
„MLSS is an excellent tool for assessing fitness level, predicting
endurance performance, and designing training programs.“
(BACON et KERN, 1999)
Inhaltsverzeichnis
- HERMENEUTISCHER EXKURS…………………………………….
- 1.1 DIE WIRKUNG VON AUSDAUERTRAINING AUF HERZKREISLAUFERKRANKUNGEN.
- 1.2 DIE WIRKUNG VON AUSDAUERTRAINING AUF BLUTHOCHDRUCK....
- 1.3 KONZEPTE ZUR BESTIMMUNG DER INDIVIDUELLEN ANAEROBEN SCHWELLE .....
- 1.3.1 Trainingsadaptationen bei Training im Bereich der Laktatschwellen .............
- 1.4 VENTILATORISCHE SCHWELLENKONZEPTE
- 1.5 HEARTRATETURNPOINT – HRTP.
- 1.6 DAS MAXIMALE LAKTATSTEADY-STATE...........
- 1.6.1 Abhängigkeit des MLSS von der Art der Übung….…….....
- 1.6.2 Vergleich verschiedener Steady-State Protokolle...
- 1.6.3 Training im MLSS im Zusammenhang mit körperlichen Auswirkungen...........
- METHODISCHE AUSFÜHRUNG..............
- 2.1 DAS UNTERSUCHUNGSKOLLEKTIV.
- 2.2 DIE TESTANORDNUNG.
- 2.2.1 1-Minuten Test ........
- 2.2.2 Der Steady-State Test..
- 2.3 LEISTUNGSDIAGNOSTISCHE PARAMETER
- 2.3.1 Die Herzfrequenzleistungskurve und der HRTP...
- 2.3.1.1 Der k-Wert.
- 2.3.2 Atemäquivalente von O2 und CO2 (VE/VO2 und VENCO2)
- 2.3.3 Die Laktatturnpoints – LTP1 und LTP2 .
- 2.3.4 Der Blutdruck
- STATISTISCHE AUSWERTUNGEN UND ERGEBNISSE ............
- 3.1 VERGLEICH DER WATTLEISTUNG.........
- 3.1.1 Mittelwertvergleich der Umstellpunkte.
- 3.1.1.1 Gesunde Männer.
- 3.1.1.2 Gesunde Frauen
- 3.1.1.3 Männer mit einer KHK
- 3.1.1.4 Frauen mit einer KHK
- 3.1.1.5 Männer mit arteriellem Hypertonus.....
- 3.1.1.6 Frauen mit arteriellem Hypertonus.
- 3.1.2 Lineare Regressionen und Korrelationskoeffzienten........
- 3.1.2.1 Gesunde Männer.
- 3.1.2.2 Gesunde Frauen
- 3.1.2.3 Männer mit einer KHK
- 3.1.2.4 Frauen mit einer KHK
- 3.1.2.5 Männer mit arteriellem Hypertonus....
- 3.1.2.6 Frauen mit arteriellem Hypertonus.
- 3.2 VERGLEICH DER HERZFREQUENZEN....
- 3.2.1 Mittelwertvergleich und Korrelationkoeffizienten der Herzfrequenzen.............
- 3.2.1.1 Gesunde Männer.
- 3.2.1.2 Gesunde Frauen
- 3.2.1.3 Männer mit einer KHK.
- 3.2.1.4 Frauen mit einer KHK
- 3.2.1.5 Männer mit arteriellem Hypertonus...
- 3.2.1.6 Frauen mit arteriellem Hypertonus...
- 3.2.2 Zusammenfassung der linearen Regressionen und Korrelationskoeffizienten der Herzfrequenzwerte......
- 3.3 VERGLEICH DER LAKTATWERTE
- 3.3.1 Mittelwertvergleich und Korrelationskoeffizienten der Laktatwerte ..........
- 3.3.1.1 Gesunde Männer.
- 3.3.1.2 Gesunde Frauen
- 3.3.1.3 Männer mit einer KHK
- 3.3.1.4 Frauen mit einer KHK
- 3.3.1.5 Männer mit arteriellem Hypertonus......
- 3.3.1.6 Frauen mit arteriellem Hypertonus.....
- 3.3.2 Zusammenfassung der linearen Regressionen und Korrelationskoeffizienten der Laktatwerte.
- 3.4 VERGLEICH DER RELATIVEN SAUERSTOFFAUFNAHME......
- 3.4.1 Mittelwertvergleich und Korrelationskoeffizienten der relativen Sauerstoffaufnahme.
- 3.4.1.1 Gesunde Männer.
- 3.4.1.2 Gesunde Frauen.
- 3.4.1.3 Männer mit einer KHK
- Die Bestimmung der optimalen Trainingsintensität für verschiedene Patientengruppen.
- Die Untersuchung der Unterschiede in den physiologischen Reaktionen auf Training zwischen gesunden Personen und Patienten mit Herzkreislauferkrankungen.
- Die Analyse der Zusammenhänge zwischen Trainingsintensität und Veränderungen in metabolischen und respiratorischen Parametern.
- Die Evaluation verschiedener Steady-State Testprotokolle zur Bestimmung der optimalen Trainingsintensität.
- Die Bedeutung von Trainingsadaptationen im Bereich der Laktatschwellen.
- Hermeneutischer Exkurs: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die wissenschaftlichen Grundlagen der Herzkreislauftherapie, insbesondere die Auswirkungen von Ausdauertraining auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blutdruck und die Bestimmung der individuellen anaeroben Schwelle. Es beleuchtet außerdem die verschiedenen Konzepte zur Bestimmung der anaeroben Schwelle, einschließlich der ventilatorischen Schwelle, des Heart Rate Turnpoint (HRTP) und des maximalen Laktat Steady-State (MLSS).
- Methodische Ausführung: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Aspekte der Studie, einschließlich des Untersuchungskollektivs, der Testanordnung und der verwendeten leistungsdiagnostischen Parameter. Es erklärt die verschiedenen Messmethoden, wie z.B. die Erfassung der Herzfrequenz, des Laktatwerts, der Atemäquivalente von O2 und CO2 sowie des Blutdrucks.
- Statistische Auswertungen und Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die statistischen Analysen der erhobenen Daten und die daraus gewonnenen Ergebnisse. Es untersucht die Unterschiede in den Leistungswerten, Herzfrequenzen, Laktatwerten und relativen Sauerstoffaufnahmen zwischen verschiedenen Patientengruppen, und beleuchtet die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Parametern.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Evaluation von Trainingsintensitäten im Rahmen der Herzkreislauftherapie. Sie untersucht die Auswirkungen verschiedener Trainingsintensitäten auf metabolische und respiratorische Parameter bei verschiedenen Patientengruppen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: Herzkreislauftherapie, Ausdauertraining, Trainingsintensität, metabolische Parameter, respiratorische Parameter, Laktatschwellen, Steady-State Tests, HRTP, MLSS, Patientengruppen, Gesundheitszustand, Leistungsdiagnostik.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Ausdauertraining bei Herzkreislauferkrankungen wichtig?
Es hilft Patienten, ihre Belastbarkeit nach akuten klinischen Episoden wiederherzustellen und dient der Sekundär- sowie Tertiärprävention.
Was ist das maximale Laktat-Steady-State (MLSS)?
Das MLSS ist die höchste Belastungsintensität, bei der Bildung und Abbau von Laktat im Blut gerade noch im Gleichgewicht stehen.
Wie wird die individuelle anaerobe Schwelle bestimmt?
Die Bestimmung erfolgt meist über einen Stufentest auf dem Ergometer unter Analyse von Laktatwerten, Herzfrequenz und Atemgasen.
Was bedeutet 'Heart Rate Turnpoint' (HRTP)?
Der HRTP ist ein Kennpunkt in der Herzfrequenzleistungskurve, der einen Übergangsbereich der Stoffwechselbelastung anzeigt und zur Trainingssteuerung genutzt wird.
Warum ist eine exakte Dosierung der körperlichen Belastung bei Kranken wichtig?
Um eine Überlastung des Herz-Kreislauf-Systems zu vermeiden und gleichzeitig ein Optimum an medizinischem Nutzen zu erzielen.
- Quote paper
- Birgit Sedelmaier, Mag. (Author), 2002, Evaluierung von Trainingsintensitäten im Rahmen der Herzkreislauftherapie anhand von metabolischen und respiratorischen Steady-State Tests, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20617