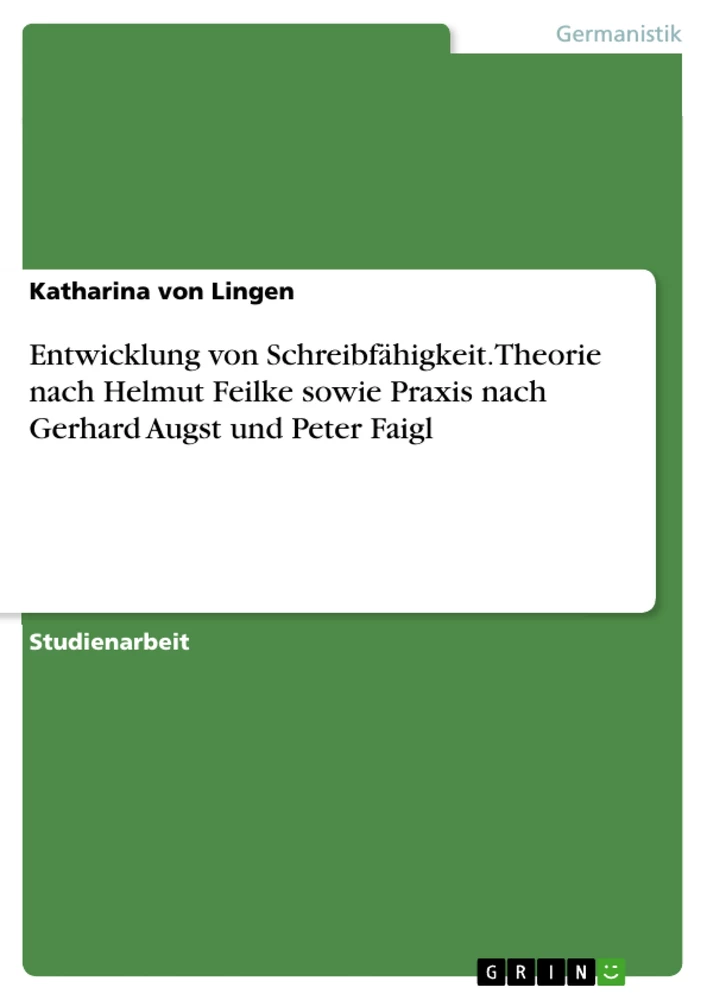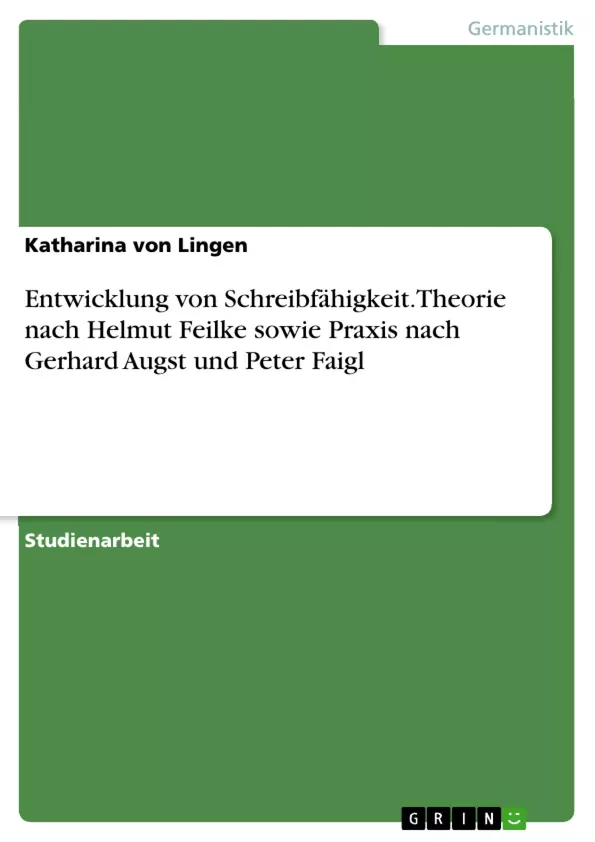Die Entwicklung der Schreibkompetenz ist eine Abfolge von Problemlöseschritten und eine durch das Medium geprägte kommunikative Problemlösefähigkeit. Sprachliche und kommunikative Kompetenzen, die bereits vor dem Beginn des Schreiberwerbs erlernt wurden, müssen vom Individuum nun reorganisiert, rekonstruiert und erweitert werden.
Im Prozess der Schreibentwicklung wird nicht einfach die zusätzliche Kompetenz des Schreibenkönnens erlernt und hinzugefügt, sondern es entsteht ein sprachliches und soziales Wissen ganz eigener Art: Der Schreiber muss lernen, die verschiedenen Ebenen und Möglichkeiten, die der direkten Kommunikation von Angesicht zu Angesicht eigen sind, im Schreiben durch andere Techniken und Strategien zu ersetzen.
Entscheidende Differenzen zwischen Schriftsprache und direkter mündlicher Kommunikation:
-Mimik und Gestik, Intonation, Sprechrhythmus und -geschwindigkeit (zumeist unbewusst genutzt) entfallen beim Schreiben als Übertragungsebenen und Kodierungsmöglichkeit. Der Schreiber muss lernen, seinen Ausdruck symbolisch durchzustrukturieren, die Syntax wird so komplexer und die Lexik vielschichtiger.
-Der beim Sprechen von den Kommunikationspartnern immer mit wahrgenommene Situationskontext fehlt beim Scheiben. Die räumlich-zeitlichen Verschiebungen müssen vom Schreiber durch Kontextualisierung, also durch den Aufbau einer in sich geschlossenen Textwelt ersetzt werden. Somit wird das textorientierte Schreibwissen zentral für die Entwicklung von Schreibfähigkeit.
-Beim Schreiben wird das Kurzzeitgedächtnis überlastet, da der Schreibvorgang langsamer vor sich geht als die Ideengenerierung, somit leiten Textpläne die Textproduktion. Zusätzlich bleiben die Schreiber mit ihrem eigenen Produkt konfrontiert und es muss eine ständige Anpassung des vorläufigen Resultats mit dem Kommunikationsziel vorgenommen werden, der Text wird also überarbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Theoretischer Hintergrund (Helmut Feilke)
- 1.1 Forschungsentwicklung
- 1.1.1 bis in die 70er Jahre
- 1.1.2 ab den 70er Jahren
- 1.1.3 ab 1985
- 1.1.4 Forschungsmethoden
- 1.2 Merkmale der Schreibentwicklung
- 1.3 Syntaktische Schreibfähigkeiten
- 1.3.1 Drei Entwicklungsstränge des Schreibfähigkeitserwerbs
- 1.4 Textbezogene Schreibkompetenz
- 1.4.1 Kategorien der Analyse
- 1.4.2 Kohärenzbegriff
- 1.4.3 Der Ausbau von Kohärenzstrategien
- 1.4.4 Vierstufenmodell für die Ausbildung der Kohärenzprinzipien
- 2 Praktische Untersuchung (Gerhard Augst und Peter Faigel)
- 2.1 Entwicklung schriftsprachlicher Teilfähigkeiten im Alter von 13 bis 23 Jahren
- 2.1.1 Erwerbsprozess schriftsprachlicher Kommunikationsfähigkeit
- 2.1.2 Die Untersuchung
- 2.1.2.1 Untersuchungsaufbau
- 2.1.3 Ergebnisse der Teilgebiete Lexik und Syntax
- 2.1.3.1 Adjektivgebrauch
- 2.1.3.2 Formulierungsfehler
- 2.1.3.3 Satzkomplexität
- 2.1.3.4 Grammatikfehler
- 2.1.3.5 Konjunktionen
- 2.1.4 Schlussbetrachtung
- 2.1.4.1 Konzeptionsebene
- 2.1.4.2 Realisierungsebene
- 3 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Schreibfähigkeit, sowohl aus theoretischer als auch aus empirischer Perspektive. Sie verfolgt das Ziel, den Wandel der Forschungsschwerpunkte und -methoden im Bereich der Schreibforschung aufzuzeigen und die Ergebnisse einer empirischen Studie zur Entwicklung schriftsprachlicher Teilfähigkeiten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu präsentieren.
- Entwicklung der Schreibforschung
- Wandel der Forschungsmethoden
- Schreibfähigkeit als kognitive und kommunikative Handlung
- Entwicklung schriftsprachlicher Teilfähigkeiten
- Zusammenhang zwischen Schreibfähigkeit und sozialer Kognition
Zusammenfassung der Kapitel
1 Theoretischer Hintergrund (Helmut Feilke): Dieser Abschnitt bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der Schreibforschung. Er beschreibt den Wandel vom Fokus auf rein syntaktische Aspekte bis hin zu einem ganzheitlicheren Verständnis von Schreibfähigkeit als kognitiv-kommunikative Handlung. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Forschungsansätze und -methoden, beginnend mit strukturell-deskriptiven Studien bis hin zu prozessorientierten experimentellen Ansätzen, die den Schreiber und seine Schreibprozesse in den Mittelpunkt stellen. Die Bedeutung des sozialen Kontextes beim Schreiben wird ebenfalls hervorgehoben, zusammen mit der Herausforderungen, die die methodologische Berücksichtigung dieser sozialen Aspekte mit sich bringt. Die Entwicklung der Schreibfähigkeit wird als ein Prozess des Problemlösens und der Reorganisation bereits vorhandener sprachlicher und kommunikativer Kompetenzen dargestellt.
2 Praktische Untersuchung (Gerhard Augst und Peter Faigel): Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Studie, die die Entwicklung schriftsprachlicher Teilfähigkeiten im Alter von 13 bis 23 Jahren untersucht. Der Fokus liegt auf der Analyse von Lexik und Syntax, wobei Aspekte wie Adjektivgebrauch, Formulierungsfehler, Satzkomplexität, Grammatikfehler und der Gebrauch von Konjunktionen betrachtet werden. Die Studie beleuchtet den Erwerbsprozess schriftsprachlicher Kommunikationsfähigkeit und analysiert die Ergebnisse auf der Konzeptionsebene (Planung und Organisation des Schreibprozesses) und der Realisierungsebene (sprachliche Umsetzung). Die Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und den Fortschritt der Schreibentwicklung während dieser Altersgruppe. Der methodologische Ansatz der Studie wird ebenfalls detailliert beschrieben, einschließlich des Untersuchungsaufbaus und der angewandten Methoden.
Häufig gestellte Fragen zu "Entwicklung der Schreibfähigkeit"
Was ist der Inhalt des Buches "Entwicklung der Schreibfähigkeit"?
Das Buch "Entwicklung der Schreibfähigkeit" bietet eine umfassende Betrachtung der Entwicklung von Schreibkompetenzen, sowohl aus theoretischer als auch aus empirischer Perspektive. Es beinhaltet einen Überblick über die Entwicklung der Schreibforschung, den Wandel der Forschungsmethoden und die Ergebnisse einer empirischen Studie zur Entwicklung schriftsprachlicher Teilfähigkeiten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen (13-23 Jahre).
Welche Themen werden im theoretischen Teil behandelt?
Der theoretische Teil, verfasst von Helmut Feilke, beschreibt die Entwicklung der Schreibforschung von den 1970er Jahren bis zur Gegenwart. Es werden verschiedene Forschungsansätze und -methoden beleuchtet, von struktural-deskriptiven bis hin zu prozessorientierten Ansätzen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Wandel vom Fokus auf rein syntaktische Aspekte hin zu einem ganzheitlicheren Verständnis von Schreibfähigkeit als kognitiv-kommunikative Handlung. Der Einfluss des sozialen Kontextes und die damit verbundenen methodologischen Herausforderungen werden ebenfalls diskutiert. Die Entwicklung der Schreibfähigkeit wird als Prozess des Problemlösens und der Reorganisation bereits vorhandener sprachlicher und kommunikativer Kompetenzen dargestellt.
Was beinhaltet die empirische Untersuchung?
Der empirische Teil, von Gerhard Augst und Peter Faigel verfasst, präsentiert die Ergebnisse einer Studie zur Entwicklung schriftsprachlicher Teilfähigkeiten bei 13- bis 23-Jährigen. Die Analyse konzentriert sich auf Lexik und Syntax, untersucht Aspekte wie Adjektivgebrauch, Formulierungsfehler, Satzkomplexität, Grammatikfehler und den Gebrauch von Konjunktionen. Die Ergebnisse werden auf der Konzeptionsebene (Planung) und der Realisierungsebene (sprachliche Umsetzung) analysiert. Der methodologische Ansatz der Studie, inklusive Untersuchungsaufbau und angewandte Methoden, wird detailliert beschrieben.
Welche Altersgruppe wird in der empirischen Studie untersucht?
Die empirische Studie untersucht die Entwicklung schriftsprachlicher Teilfähigkeiten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 13 bis 23 Jahren.
Welche Aspekte der Schreibfähigkeit werden in der empirischen Studie analysiert?
Die empirische Studie analysiert Aspekte der Lexik und Syntax, einschließlich Adjektivgebrauch, Formulierungsfehler, Satzkomplexität, Grammatikfehler und den Gebrauch von Konjunktionen.
Welche Zielsetzung verfolgt das Buch?
Das Buch verfolgt das Ziel, den Wandel der Forschungsschwerpunkte und -methoden im Bereich der Schreibforschung aufzuzeigen und die Ergebnisse einer empirischen Studie zur Entwicklung schriftsprachlicher Teilfähigkeiten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu präsentieren. Es untersucht die Entwicklung der Schreibfähigkeit aus theoretischer und empirischer Perspektive.
Welche Kapitel umfasst das Buch?
Das Buch umfasst drei Kapitel: 1. Theoretischer Hintergrund (Helmut Feilke), 2. Praktische Untersuchung (Gerhard Augst und Peter Faigel) und 3. Literaturverzeichnis.
- Quote paper
- Katharina von Lingen (Author), 2001, Entwicklung von Schreibfähigkeit. Theorie nach Helmut Feilke sowie Praxis nach Gerhard Augst und Peter Faigl, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20621