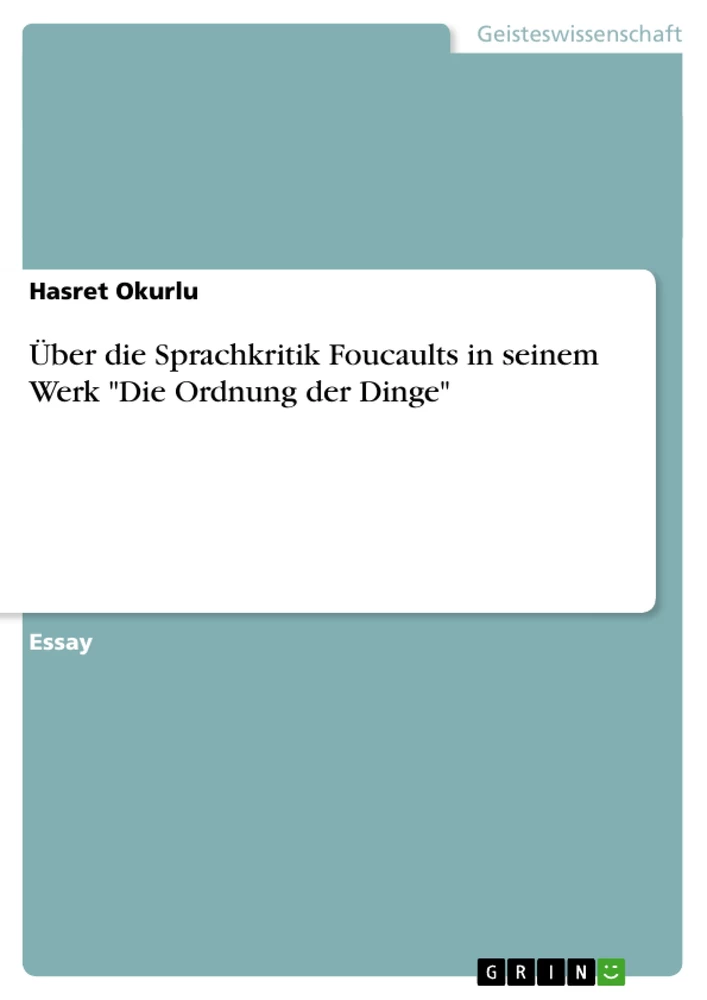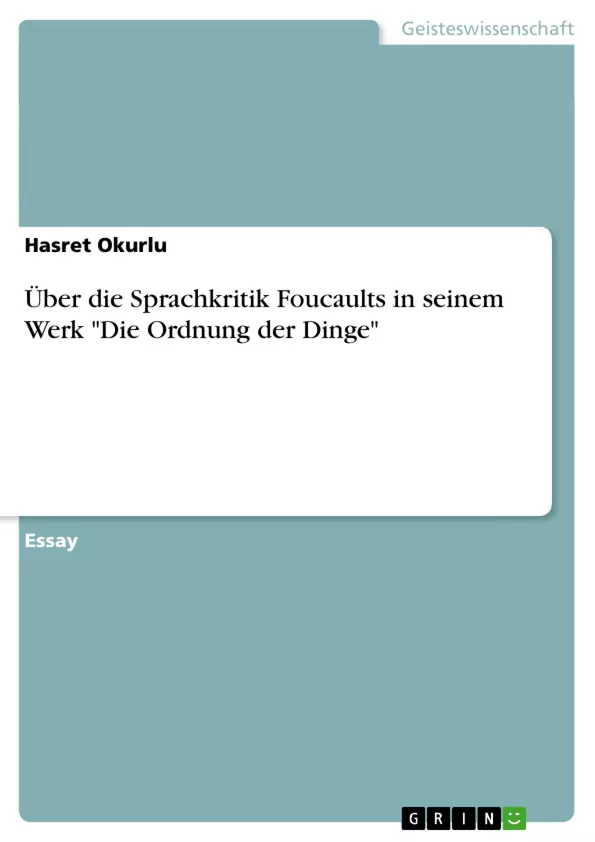Das bescheidene Ziel dieser Arbeit liegt darin, in seinem Werk Die Ordnung der Dinge, aber insbesondere in dem neunten Kapitel manche Stationen seiner Kritik der Repräsentation zu skizzieren, in der seine Ablehnungen an die Moderne, bzw. von der Ordnung der Dinge erzeugen. Die Ordnung der Dinge ist ein Werk, mit dem Foucault seine Absage an die Humanwissenschaften festgestellt hat. Zentrale Untersuchungsebene der Ordnung der Dinge ist eine Ordnung, die weder einfach den Dingen vorausliegt noch in Ihnen angelegt ist, sondern die erst mit den Dingen entsteht als ihr variables Arrangement. Das werk bezeichnet einen Sturmlauf gegen die normative Festlegung der Dinge
Apropos
Foucaults Denken ist mit seiner Kritik der Moderne über 40 Jahren in der westlichen Philosophie verwoben. Mit Foucault eröffnen sich neue Denkräume, die Möglichkeit des Anders-Denkens.[1] Wie Dreyfus und Rabinow zustimmen, nach der Foucault einer, jener Denker ist, deren Werk sowohl eine zugrunde liegende Kontinuität als auch eine wichtige Kehre aufweist – „nicht weil seine Bemühungen nutzlos waren, sondern weil er, in dem er eine Denkweise bis an Ihre Grenzen vorantrieb, diese Begrenzungen erkannt und überwunden hat.“[2]
Das bescheidene Ziel dieser Arbeit liegt darin, in seinem Werk Die Ordnung der Dinge, aber insbesondere in dem neunten Kapitel manche Stationen seiner Kritik der Repräsentation zu skizzieren, in der seine Ablehnungen an die Moderne, bzw. von der Ordnung der Dinge erzeugen. Die Ordnung der Dinge ist ein Werk, mit dem Foucault seine Absage an die Humanwissenschaften festgestellt hat. Zentrale Untersuchungsebene der Ordnung der Dinge ist eine Ordnung, die weder einfach den Dingen vorausliegt noch in Ihnen angelegt ist, sondern die erst mit den Dingen entsteht als ihr variables Arrangement. Das werk bezeichnet einen Sturmlauf gegen die normative Festlegung der Dinge.
In dieser Arbeit soll insbesondere auf das neunte Kapitel „Der Mensch und seine Doppel“ eingegangen werden. Dieses Kapitel besteht aus 8 Untertiteln, sich mit denen einen Hintergrund seiner Philosophie verraten, dass Seine kritischen Ansätze in Bezug auf die Sprache situiert werden können. Ein linguistisch-kritischer Bezug auf Foucaults Philosophieren ist im Kern in einem ihm selber unverzichtbaren Zustand verankert. Er versucht mit seiner linguistisch-kritisch Position die Strukturen der modernen Philosophie analysieren. Auch wenn sich die vorliegende Arbeit mit Fragen beschäftigt, die sich um die Kritik der Sprache zentrieren lassen, so heißt das nicht, Foucault einzig und als einen Philosoph, der die Rückkehr der Sprache anweist, zu präsentieren. „Linguistic Turn“ bzw. die Rückkehr der Sprache bezeichnet seit 19. Jahrhundert eine große Tradition der Philosophie. Diese Arbeit will der Frage nachgehen, inwiefern man Foucaults Philosophie als eine Rückkehr der Linguistik gelesen werden kann.
Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, möglichst frei von Foucaults politischen Ansichten zu schreiben. Er will auf Distanz zur Politik des Frankreichs der mittlere sechziger Jahre und möchte seine Kultur von Außen betrachten. Eine neue Exegese um die Sprache hervorzubringen, mit der Foucault die verdüsternde Struktur der Moderne verwischte, diese Auslegung, die von Foucault zu Wort gekommen wurde, der Sprache lässt ihm einen Ausgangspunkt zur seiner Aufgabe gewinnen: die Rekonstruierung der Moderne, bzw. aller unterworfenen Ordnungen der Moderne. Die Hauptaugenmerke liegen hierbei auf manche Leitbegriffe, die in dem neunten Kapitel des Werks verwendet werden, bzw. die Wiederkehr der Sprache, mit der sich die Rolle der Sprache an die moderne Philosophie nähert wird, und der Platz des Königs, mit dem die Sprache in Bezug auf den Mensch eingegangen wird.
1. Die Wiederkehr der Sprache
Wie in der Einleitung kurz erwähnt wird, die Wiederkehr der Sprache entwickelt sich seit 19. Jahrhundert in einer großen Tradition, die sich mit den Fragen beschäftigt:
- Was ist Sprache?
- Was ist ein Zeichen?
- Was in der Welt, in unseren Gesten und dem ganzen rätselhaften Wappen unseres Verhaltens, in unseren Träumen und Krankheiten stumm ist?
- Welche Sprache spricht es, mit welcher Grammatik?
- Ist alles bezeichnend, oder für wen und nach welchen Regeln ist was bezeichnend? …usw.[3]
Im 19. Jahrhundert brach Nietzsche mit der Tradition und stellte den Begriff „Sprache“ radikal in Frage. Er, und später auch Philosophen der Moderne und Postmoderne, betonten die Unterworfenheit der Sprache, als Produkt von Ideologien, als Spielball von unbewussten, libidinösen Impulsen, als Opfer von Diskontinuität und Kontingenz. Aus diesem Zusammenhang heraus gibt Foucault dazu, dass Nietzsche in seiner Philosophie eine Hauptfigur sei.
„ 1953 oder 1952, ich erinnere mich nicht mehr, habe ich Nietzsche gelesen. (…) Meine ganze philosophische Entwicklung war durch meine Lektüre von Heidegger bestimmt. Ich gebe aber zu, dass es Nietzsche war, mit dem sie dann durchgegangenen ist“[4]
Auch der Begriff Kritik der Sprache nimmt bei Foucault eine zentrale Rolle ein, denn durch ihn Foucault zerstört den Erbfehler der traditionellen Philosophie. Allgemein werden zwei Rezeptionsweisen mit Blick auf das Werk von Foucault unterscheiden. Einerseits wird betont, dass die Sprache bei Foucault als ein Produkt des Menschen kritisiert werde, andererseits die Sprache in Bezug auf die Wirklichkeit Problematik sei.
Es soll am Anfang, nämlich kurz vor der Erklärungen den zwei Rezeptionen, erwähnt werden, wenn mit der Genealogie nach der Herkunft von der Sprache gefragt wird, geht es nicht um die Aufdeckung eines Ursprungs, sondern um die Veränderung der Form der Sprache von der Zeit der „Renaissance“ zum „Klassischen Zeitalter“ und zur Schwelle der „Moderne“. Es liefert kein Fundament bei Foucault. Die Tatsache, zum Beispiel, dass der Mensch nicht Herr über seine Sprache ist, gehört im Blick auf die Foucaultschen Definitionen nicht zum Untergang des Menschen, sondern zu den Bedingungen seiner Möglichkeit.[5] Die Sprache ist ein wichtiges Thema in Bezug auf den Mensch, weil der Mensch sich nach Foucault durch die Sprache in die Wirklichkeit transportiert.[6] Dieser Bezug ist aber abgebrochen worden. Die Sprache wird bei Foucault kritisiert, als eine unterworfene Ordnung, die mit ihrer Struktur den Mensch nicht repräsentieren kann auf der einen und als eine Figur, die den Mensch nicht in seiner Wirklichkeit beschreibt auf der anderen. Aus Foucaultscher Perspektive bezeichnet die Sprache nicht mehr ihr Objekt, im Sinne den Mensch, sondern sie wiederspiegelt sich. Der Mensch, wie ihn der Archäologie Foucault beschreibt, ist bereits im Moment seiner Geburt zu Beginn des 19. Jahrhunderts am Ende.[7] Der Mensch im Kapitel über „den Mensch und seine Doppel“ als eine empirisch-transzendentale Doppelstruktur des klassischen Denkens beschreibt.
[...]
[1] Markus S. Kleiner: Eine Einführung in sein Denken; Apropos Foucault, Campus Verlag, GmbH, Frankfurt/Main, 2001, S. 17
[2] Huber L. Dreyfus und Paul Rabinow: M. Foucault, Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik, Frankfurt am Main, 1987, S.127
[3] Die Fragen, die von Foucault verwendet wurden, werden hier auf die allgemeine Sprachphilosophie generalisiert. Foucault, M., Die Ordnung der Dinge, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1971, S. 370.
[4] Marcus S. Kleiner, Michel Foucault: Eine Einführung in sein Denken, S. 205
[5] Stefan Wunderlich, M. Foucault und die Frage der Literatur, Frankfurt am Main, 2000, S. 220
[6] Die Ordnung der Dinge, S. 367-376
[7] Stefan Wunderlich, M. Foucault und die Frage der Literatur, S. 220
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Foucaults "Die Ordnung der Dinge"?
Das Werk untersucht die Ordnungsstrukturen, die den Dingen zugrunde liegen, und stellt eine Absage an die klassischen Humanwissenschaften dar, indem es die Rolle der Sprache und Repräsentation kritisch hinterfragt.
Was versteht Foucault unter der "Wiederkehr der Sprache"?
Es beschreibt eine philosophische Tradition seit dem 19. Jahrhundert, in der die Sprache nicht mehr nur als Werkzeug zur Beschreibung der Welt, sondern als eigenständiges, kritisches Untersuchungsobjekt wahrgenommen wird.
Welchen Einfluss hatte Nietzsche auf Foucault?
Nietzsche gilt als Hauptfigur für Foucault, da er den Begriff der Sprache radikal in Frage stellte und die Unterworfenheit der Sprache unter Ideologien und Impulse betonte.
Was kritisiert Foucault an der modernen Repräsentation?
Er kritisiert, dass die Sprache in der Moderne den Menschen nicht mehr wahrhaftig repräsentiert oder in seiner Wirklichkeit beschreibt, sondern lediglich sich selbst widerspiegelt.
Was bedeutet "Linguistic Turn" im Kontext dieser Arbeit?
Der Linguistic Turn bezeichnet die Hinwendung der Philosophie zur Sprache als zentralem Element der Erkenntnis und Strukturierung von Welt und Denken.
- Citation du texte
- Hasret Okurlu (Auteur), 2011, Über die Sprachkritik Foucaults in seinem Werk "Die Ordnung der Dinge", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206317