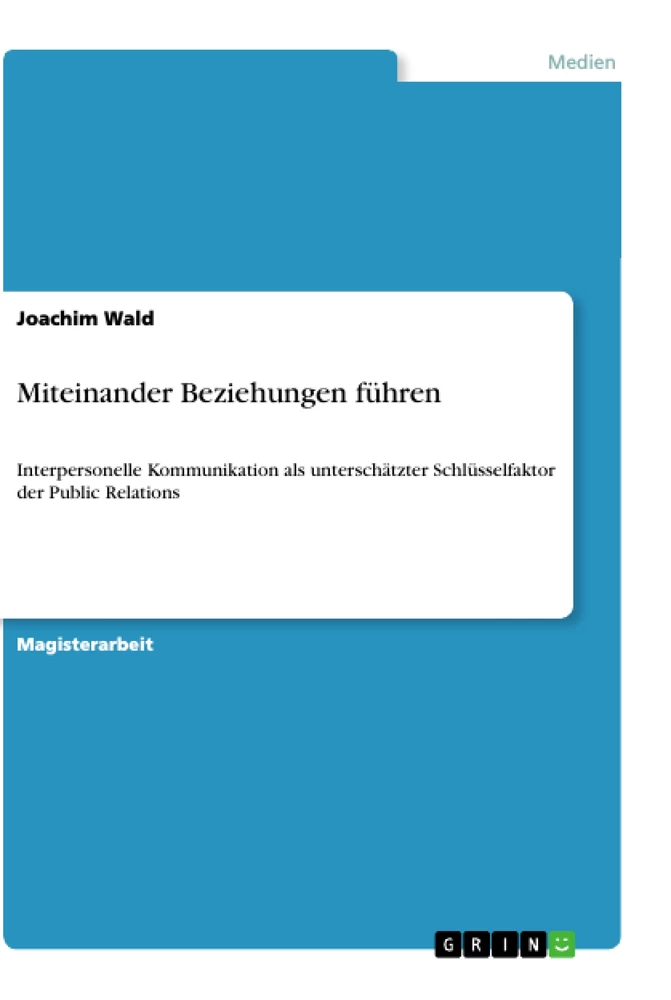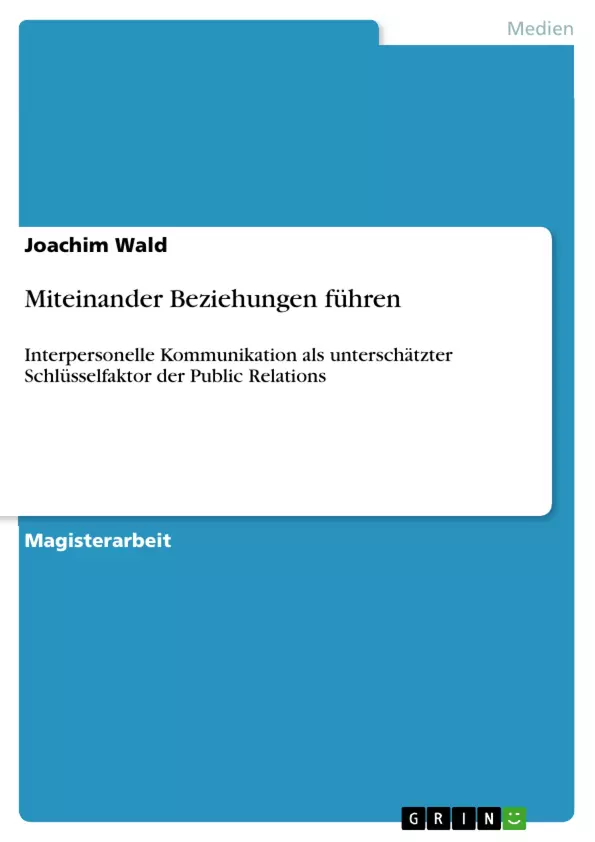Inhaltsverzeichnis
A. Einleitung
1. Einführung
2. Ziele und Methode
3. Inhalt und Aufbau
B. Theorieteil
1. Interpersonelle Kommunikation
1.1 Definitionsversuche
1.2 Theorien zur Interpersonellen Kommunikation
1.2.1 Symbolischer Interaktionismus
1.2.2 Theorie des kommunikativen Handelns
1.2.3 Uncertainty Reduction Theory
1.3 Prozessmodelle zur Interpersonellen Kommunikation
1.3.1 Prozessmodell von Hartley
1.3.2 Prozessmodell von Baker
1.3.3 Prozessmodell von Hargie und Dickson
1.3.4 Prozessmodell von Kunczik und Zipfel
1.4 Erklärungsmodelle zur Interpersonellen Kommunikation
1.4.1 Axiome der Interpersonellen Kommunikation
1.4.2 Sach- und Beziehungsebene
1.4.3 Transaktionale Analyse
1.4.4 Nachrichtenquadrat
1.5 Interpersonelle Kommunikation in Training und Beratung
1.6 Zusammenfassende Betrachtung
2. Public Relations
2.1 Definitionsversuche im Wandel der Zeit
2.2 Funktionen von Public Relations
2.3 Sichtweisen zu Public Relations
2.4 Modelle und Theorien zu Public Relations
2.4.1 Vier Modelle der Public Relations - Grunig und Hunt
2.4.2 Das Modell exzellenter Public Relations - Grunig, Grunig und Dozier
2.4.3 Open System Model of Public Relations - Cutlip, Center und Broom
2.4.4 Public Relations as Relationship Management - Ledingham
2.4.5 Verständigungsorientierte Öffentlichkeitsarbeit - Burkart
2.4.6 Theorie des öffentlichen Vertrauens - Bentele
2.5 Stakeholderansatz
2.6 Beruf Public Relations: Ausbildung und Professionalisierung
2.7 Zusammenfassende Betrachtung
C. Theorie trifft Praxis
1. Theoretischer Entwurf nach Payer
2. PR-Projektphasen und ihr Anteil an IPK
3. Medientraining für PR-Beauftragte und CEOs
D. Empirischer Teil
1. Forschungsfragen
2. Ablauf und Methode
3. Auswertung und Interpretation der Experteninterviews
3.1 Themenschwerpunkt: Interpersonelle Kommunikation
3.2 Themenschwerpunkt: Beziehung
3.3 Themenschwerpunkt: Ausbildung in Interpersoneller Kommunikation
4. Empirische Ergebnisse im Theorie-Kontext
5. Modell: Öffentlichkeitsarbeiter vs. Public Relations-Manager
E. Resümee
1. Zusammenfassung
2. Fazit
3. Ausblick
F. Quellenverzeichnis
1. Literaturangaben
2. Angaben zu den Experteninterviews
G. Anhang
1. Leitfaden für die Experteninterviews
2. Experteninterview 1.7: Paraphrasen und Überschriften
3. Experteninterviews: Soziologische Konzeptualisierung
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- 1. Einführung
- 2. Ziele und Methode
- 3. Inhalt und Aufbau
- B. Theorieteil
- 1. Interpersonelle Kommunikation
- 1.1 Definitionsversuche
- 1.2 Theorien zur Interpersonellen Kommunikation
- 1.2.1 Symbolischer Interaktionismus
- 1.2.2 Theorie des kommunikativen Handelns
- 1.2.3 Uncertainty Reduction Theory
- 1.3 Prozessmodelle zur Interpersonellen Kommunikation
- 1.3.1 Prozessmodell von Hartley
- 1.3.2 Prozessmodell von Baker
- 1.3.3 Prozessmodell von Hargie und Dickson
- 1.3.4 Prozessmodell von Kunczik und Zipfel
- 1.4 Erklärungsmodelle zur Interpersonellen Kommunikation
- 1.4.1 Axiome der Interpersonellen Kommunikation
- 1.4.2 Sach- und Beziehungsebene
- 1.4.3 Transaktionale Analyse
- 1.4.4 Nachrichtenquadrat
- 1.5 Interpersonelle Kommunikation in Training und Beratung
- 1.6 Zusammenfassende Betrachtung
- 2. Public Relations
- 2.1 Definitionsversuche im Wandel der Zeit
- 2.2 Funktionen von Public Relations
- 2.3 Sichtweisen zu Public Relations
- 2.4 Modelle und Theorien zu Public Relations
- 2.4.1 Vier Modelle der Public Relations - Grunig und Hunt
- 2.4.2 Das Modell exzellenter Public Relations - Grunig, Grunig und Dozier
- 2.4.3 Open System Model of Public Relations - Cutlip, Center und Broom
- 2.4.4 Public Relations as Relationship Management - Ledingham
- 2.4.5 Verständigungsorientierte Öffentlichkeitsarbeit - Burkart
- 2.4.6 Theorie des öffentlichen Vertrauens - Bentele
- 2.5 Stakeholderansatz
- 2.6 Beruf Public Relations: Ausbildung und Professionalisierung
- 2.7 Zusammenfassende Betrachtung
- C. Theorie trifft Praxis
- 1. Theoretischer Entwurf nach Payer
- 2. PR-Projektphasen und ihr Anteil an IPK
- 3. Medientraining für PR-Beauftragte und CEOs
- D. Empirischer Teil
- 1. Forschungsfragen
- 2. Ablauf und Methode
- 3. Auswertung und Interpretation der Experteninterviews
- 3.1 Themenschwerpunkt: Interpersonelle Kommunikation
- 3.2 Themenschwerpunkt: Beziehung
- 3.3 Themenschwerpunkt: Ausbildung in Interpersoneller Kommunikation
- 4. Empirische Ergebnisse im Theorie-Kontext
- 5. Modell: Öffentlichkeitsarbeiter vs. Public Relations-Manager
- E. Resümee
- 1. Zusammenfassung
- 2. Fazit
- 3. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Rolle der interpersonellen Kommunikation in der Public Relations. Ziel ist es, den Stellenwert der interpersonellen Kommunikation in der Praxis zu ermitteln und zu analysieren, wie sie als Instrument eingesetzt wird. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss der interpersonellen Kommunikation auf den Beziehungsaufbau und die -pflege zwischen PR-Beratern, Kunden und deren Zielgruppen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage nach der Notwendigkeit einer spezifischen Ausbildung in interpersoneller Kommunikation für PR-Praktiker.
- Der Stellenwert der interpersonellen Kommunikation in der täglichen Arbeit von PR-Beratern
- Der bewusste Einsatz von Instrumenten und Methoden der interpersonellen Kommunikation in der PR-Praxis
- Die Bedeutung von Beziehungen im Kontext der Public Relations
- Der Aufbau, die Pflege und die Analyse von Beziehungen zwischen PR-Beratern, Kunden und deren Zielgruppen
- Der Nutzen einer Ausbildung im Bereich der interpersonellen Kommunikation für PR-Praktiker
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Dieses einleitende Kapitel stellt die Grundüberlegungen und die Zielsetzung der Magisterarbeit vor. Es bietet eine Einführung in die Themen Interpersonelle Kommunikation und Public Relations und begründet die Relevanz ihrer gemeinsamen Betrachtung.
B. Theorieteil: Dieser Abschnitt liefert die theoretischen Grundlagen zu Interpersoneller Kommunikation und Public Relations. Er umfasst Definitionsversuche, Theorien, Prozess- und Erklärungsmodelle, sowie eine Auseinandersetzung mit dem Stakeholder-Ansatz und der Professionalisierung der Public Relations.
C. Theorie trifft Praxis: Dieser Teil verbindet Theorie und Praxis. Er präsentiert den theoretischen Entwurf von Payer zur Interpersonellen Kommunikation in der Public Relations und analysiert den Anteil der Interpersonellen Kommunikation in PR-Projekten und Medientrainings.
D. Empirischer Teil: Das Herzstück der Arbeit umfasst die Auswertung von Experteninterviews und die Gegenüberstellung der empirischen Ergebnisse mit der Theorie. Die Ergebnisse werden nach den Themenschwerpunkten Interpersonelle Kommunikation, Beziehung und Ausbildung strukturiert und interpretiert.
Schlüsselwörter
Interpersonelle Kommunikation, Public Relations, Beziehung, Beziehungsmanagement, Stakeholder, Dialog, Kommunikationskompetenz, Ausbildung, Professionalisierung, PR-Praxis, Medienarbeit, Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Methoden, Instrumente.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Interpersonelle Kommunikation in der Public Relations
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Rolle der interpersonellen Kommunikation in der Public Relations. Sie analysiert den Stellenwert der interpersonellen Kommunikation in der Praxis, ihren Einsatz als Instrument, ihren Einfluss auf den Beziehungsaufbau und die -pflege zwischen PR-Beratern, Kunden und Zielgruppen und die Notwendigkeit spezifischer Ausbildungen in diesem Bereich für PR-Praktiker.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf folgende Schwerpunkte: den Stellenwert interpersoneller Kommunikation in der täglichen Arbeit von PR-Beratern; den bewussten Einsatz von Instrumenten und Methoden der interpersonellen Kommunikation in der PR-Praxis; die Bedeutung von Beziehungen im Kontext der Public Relations; den Aufbau, die Pflege und Analyse von Beziehungen zwischen PR-Beratern, Kunden und deren Zielgruppen; und den Nutzen einer Ausbildung im Bereich der interpersonellen Kommunikation für PR-Praktiker.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Hauptkapitel: Einleitung (Einführung, Ziele und Methode, Inhalt und Aufbau); Theorieteil (Interpersonelle Kommunikation und Public Relations, inklusive verschiedener Theorien und Modelle); Theorie trifft Praxis (Verbindung von Theorie und Praxis, Analyse von PR-Projekten und Medientrainings); Empirischer Teil (Auswertung von Experteninterviews zu Interpersoneller Kommunikation, Beziehung und Ausbildung); und Resümee (Zusammenfassung, Fazit, Ausblick).
Welche Theorien und Modelle werden im Theorieteil behandelt?
Der Theorieteil behandelt verschiedene Theorien und Modelle der interpersonellen Kommunikation (z.B. Symbolischer Interaktionismus, Theorie des kommunikativen Handelns, Uncertainty Reduction Theory, diverse Prozessmodelle) und der Public Relations (z.B. die vier Modelle von Grunig und Hunt, das Modell exzellenter Public Relations, Stakeholder-Ansatz). Es wird auch auf den theoretischen Entwurf von Payer eingegangen.
Wie sieht der empirische Teil der Arbeit aus?
Der empirische Teil basiert auf Experteninterviews. Die Auswertung und Interpretation der Interviews konzentriert sich auf die Themenschwerpunkte Interpersonelle Kommunikation, Beziehung und Ausbildung in Interpersoneller Kommunikation. Die Ergebnisse werden im Kontext der vorgestellten Theorien diskutiert und in einem Modell "Öffentlichkeitsarbeiter vs. Public Relations-Manager" zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Interpersonelle Kommunikation, Public Relations, Beziehung, Beziehungsmanagement, Stakeholder, Dialog, Kommunikationskompetenz, Ausbildung, Professionalisierung, PR-Praxis, Medienarbeit, Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Methoden, Instrumente.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel der Arbeit ist es, den Stellenwert der interpersonellen Kommunikation in der Public Relations-Praxis zu ermitteln und zu analysieren, wie sie als Instrument eingesetzt wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Untersuchung der Bedeutung von Beziehungen und die Frage nach der Notwendigkeit einer spezifischen Ausbildung in interpersoneller Kommunikation für PR-Praktiker.
- Citation du texte
- Joachim Wald (Auteur), 2012, Miteinander Beziehungen führen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206519