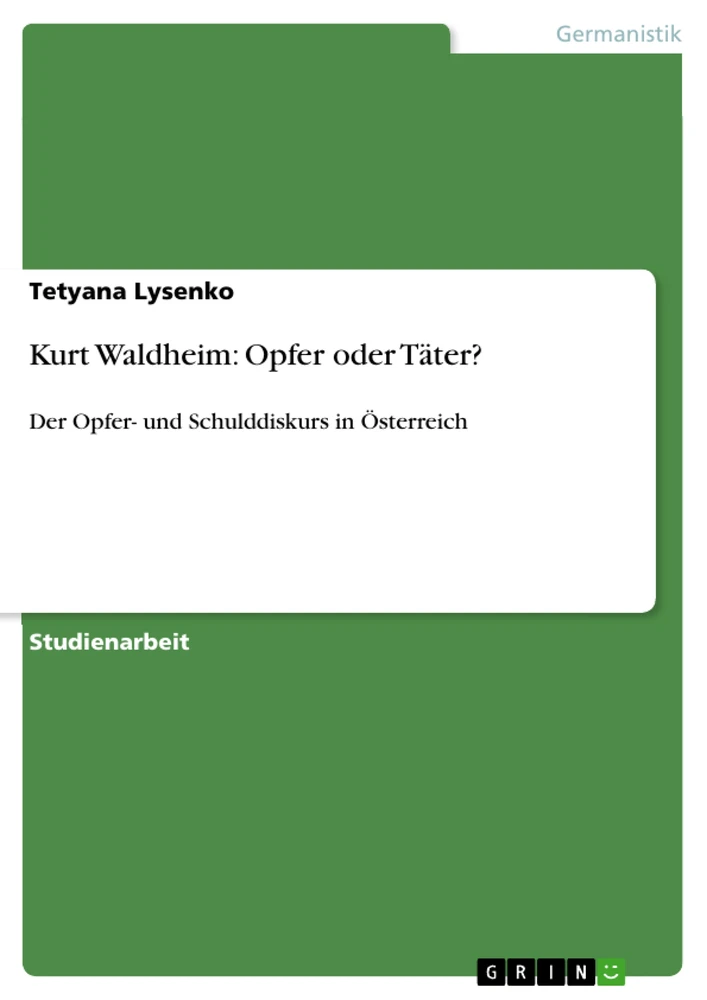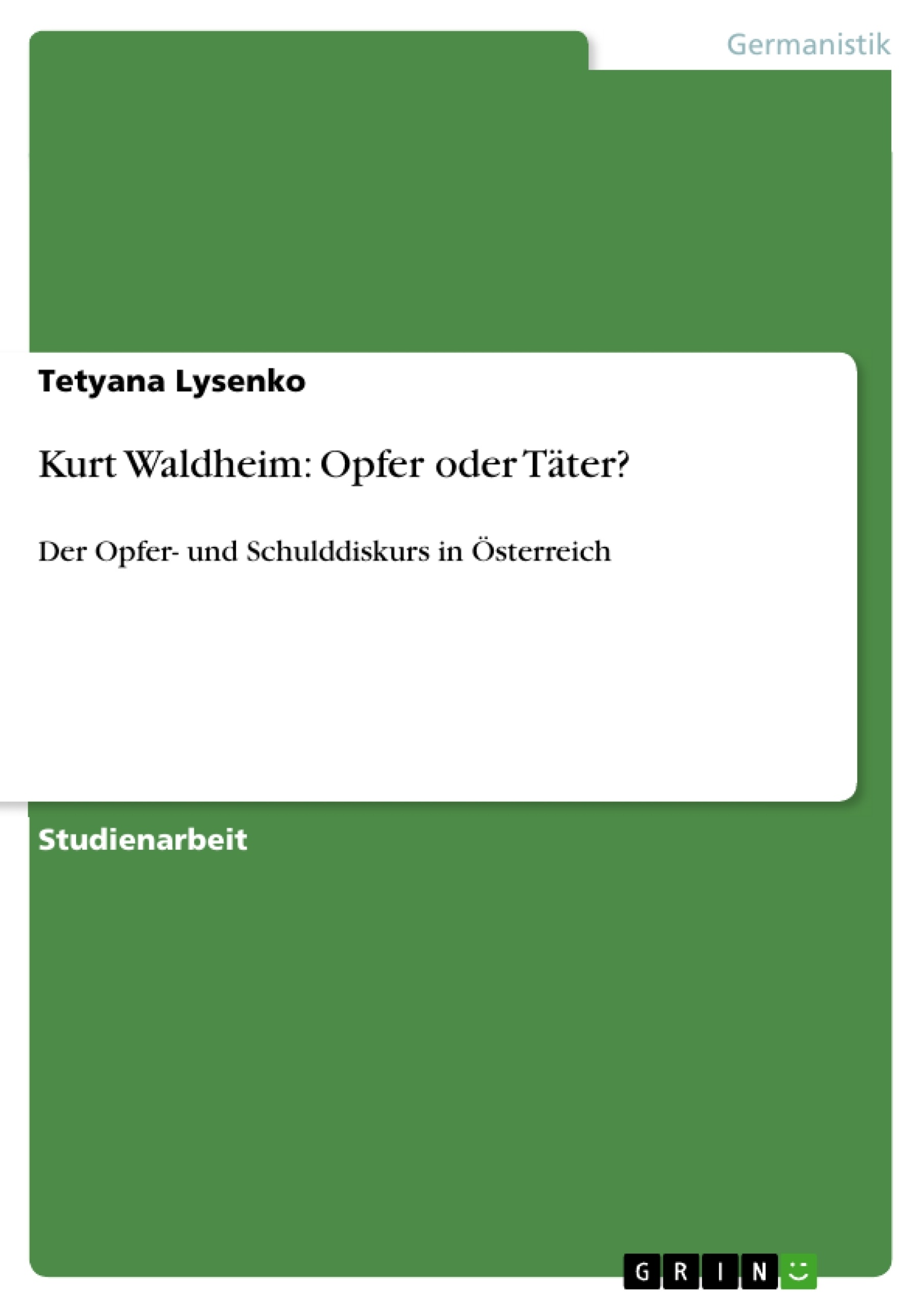0 Einleitung
Die Kandidatur Kurt Waldheims für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten war Anlass für eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, von deren Heftigkeit nicht nur seine Unterstützer, sondern auch seine Gegner überrascht waren. Im Laufe der gesellschaftlichen Diskussion wurde immer deutlicher, dass es nicht ausschließlich und vielleicht noch nicht einmal vordergründig um die Person Waldheims ging, sondern um die Frage des Selbstverständnis des Landes selbst. Diese Arbeit betrachtet in ihrem Hauptteil (2. Kapitel) diese Entwicklung aus diskursanalytischer
Sicht, sie geht der Frage nach, wie – aus Sicht der Diskursanalyse – gesellschaftliche Entwicklungen in Gang kommen und wie sich im Wandel des Diskurses der gesellschaftliche Wandel widerspiegelt.
Zunächst (1. Kapitel) ist jedoch zu klären, was unter Diskurs, und vor allem: was unter Diskurslinguistik zu verstehen ist. Seit Foucault haben diskursanalytische Verfahren weite Verbreitung gefunden, wobei die große Bandbreite der Auslegungen des Diskursbegriffs kein Zufall ist. Plumpe spricht in diesem Zusammenhang von der „semantischen Offenherzigkeit“ des Begriffs.1 Im Kern der Diskurstheorie steht der Gedanke,dass sprachliche Gegenstände nichts Abgeschlossenes sind: An die Stelle der Abgeschlossenheit
tritt der Prozess, an die Stelle des klar definierten Begriffs tritt der Diskurs,der sich ständig verändert. Es ist verständlich, dass eine Theorie der Uneindeutigkeit die Eindeutigkeit zu vermeiden sucht, und so ist eine gewisse Unschärfe der Theorie durchaus gewollt.2
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Was ist Diskurslinguistik? – Erläuterung der Untersuchungsmethode
- 1.1 Abgrenzung von anderen Disziplinen
- 1.1.1 Die vier methodische Grundprinzipien der Diskursanalyse nach Foucault
- 1.1.2 Dialektik von Sprechen und Schweigen
- 2. Der,,Fall Waldheim“ – Vorstellung des Untersuchungsgegenstands
- 2.1 Frühe Gerüchte ohne Folgen
- 2.2 Der Opfer-Diskurs: Österreich als erstes Opfer der Hitlerschen Aggression
- 2.3 Der Wir-Diskurs – Waldheim als Spiegelbild des Landes
- 2.3.1 Der Wir-Diskurs der Waldheim-Anhänger
- 2.3.2 Der Wir-Diskurs der Waldheim-Gegner am Beispiel Milo Dors
- 2.4 Waldheims Umgang mit autobiografischen Daten
- 3. Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den gesellschaftlichen Diskurs in Österreich rund um die Kandidatur Kurt Waldheims zum österreichischen Bundespräsidenten. Sie untersucht, wie der Diskurs um Waldheims Vergangenheit die Debatte über das Selbstverständnis Österreichs prägte und welche sprachlichen Strategien dabei eingesetzt wurden.
- Diskurslinguistik als Methode der Analyse
- Die Konstruktion des „Opfer“-Diskurses in Bezug auf Österreich und Waldheim
- Der „Wir“-Diskurs und die Identitätsbildung im Kontext der Waldheim-Kontroverse
- Die Rolle von Sprachstrategien und Rhetorik in der öffentlichen Debatte
- Die Auswirkungen des Diskurses auf das Selbstverständnis Österreichs
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Methode der Diskurslinguistik und grenzt sie von anderen Disziplinen ab. Es werden die vier methodischen Grundprinzipien der Diskursanalyse nach Foucault sowie die Dialektik von Sprechen und Schweigen im Diskurs behandelt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem „Fall Waldheim“ und analysiert die verschiedenen Diskurse, die im Zusammenhang mit seiner Kandidatur entstanden sind. Dazu gehören der „Opfer“-Diskurs, der Österreich als Opfer der Hitlerschen Aggression darstellt, sowie der „Wir“-Diskurs, der Waldheim als Spiegelbild des Landes interpretiert.
Schlüsselwörter
Diskurslinguistik, Diskursanalyse, Waldheim-Kontroverse, Opfer-Diskurs, Wir-Diskurs, Selbstverständnis Österreichs, Identitätsbildung, Sprachstrategien, Rhetorik.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Waldheim-Kontroverse?
Es handelt sich um die gesellschaftliche Auseinandersetzung während der Präsidentschaftskandidatur von Kurt Waldheim 1986, bei der seine verschwiegene NS-Vergangenheit im Fokus stand.
Was ist Diskurslinguistik?
Diese Methode untersucht, wie gesellschaftliche Themen sprachlich verhandelt werden, wie sich Begriffe verändern und wie Sprache gesellschaftlichen Wandel widerspiegelt.
Was bedeutet der „Opfer-Diskurs“ in Österreich?
Lange Zeit sah sich Österreich als „erstes Opfer“ der Hitlerschen Aggression. Der Fall Waldheim forderte dieses Selbstverständnis heraus und zwang das Land zur Konfrontation mit der Mitläuferrolle.
Was versteht man unter dem „Wir-Diskurs“?
Der Wir-Diskurs beschreibt, wie Waldheim von seinen Anhängern als Spiegelbild der eigenen Generation („Wir haben nur unsere Pflicht getan“) instrumentalisiert wurde.
Welche Rolle spielt Foucault in dieser Analyse?
Die Arbeit nutzt Foucaults methodische Grundprinzipien der Diskursanalyse, um die Dialektik von Sprechen und Schweigen in der öffentlichen Debatte zu untersuchen.
Wie ging Waldheim mit seinen autobiografischen Daten um?
Waldheim lückte seine Biografie hinsichtlich seiner Zeit als Ordonnanzoffizier auf dem Balkan, was den Kern der internationalen Kritik und der diskursiven Auseinandersetzung bildete.
- Quote paper
- Tetyana Lysenko (Author), 2010, Kurt Waldheim: Opfer oder Täter? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206723