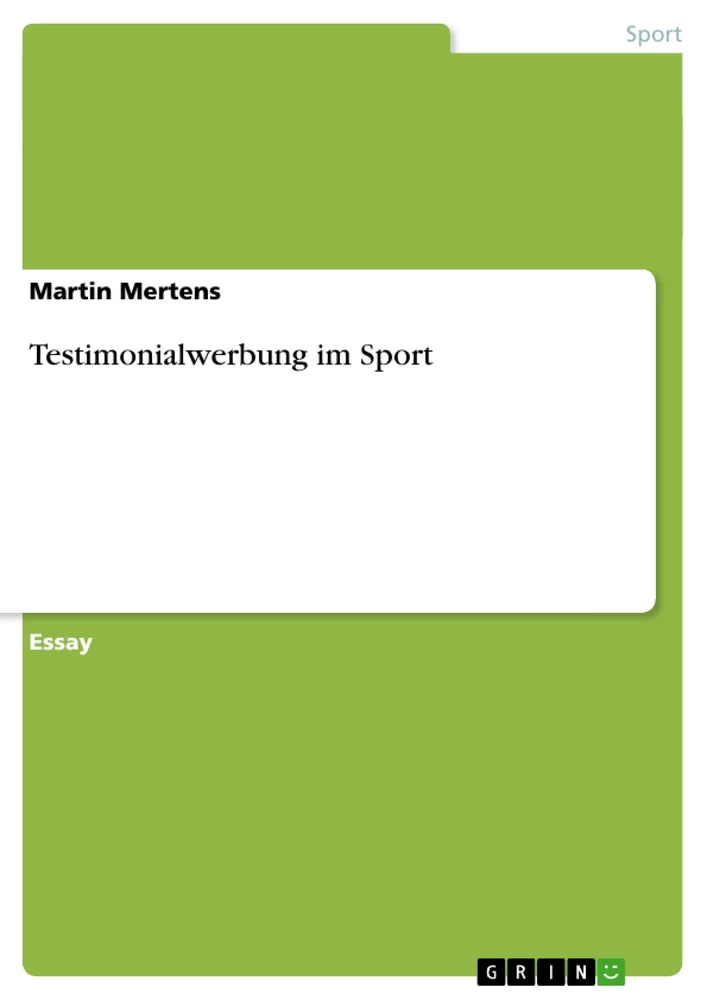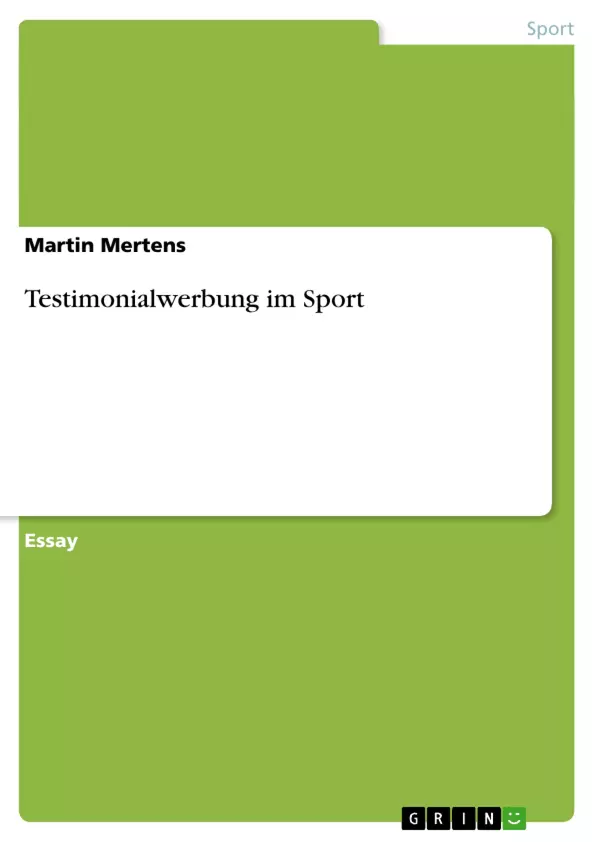Welcher Konsument, insbesondere im Fernsehen, kennt dieses Phänomen nicht:
Es gibt kaum einen Werbespot für dessen Produkte ein Star aus dem Sportsektor nicht wirbt. Sei es Boris Becker für eine Internet-Pokerplattform, Jogi Löw für Tui, Roger Federer für Gillette, Zinedine Zidane für ein Deo von Addidas, Dirk Nowitzki für eine Versicherung, Jürgen Klopp für Seat, Michael Greis und Magdalena Neuner für Erdinger, Sebastian Vettel für eine Haarpflegemarke, Thomas Müller für Bifi und viele Beispiele mehr.
Die gesamte Bandbreite der Testimonialwerbung mit Sportlern ist riesig und umfasst das komplette Produktsortiment – von der Automobilbranche über Gesundheitsartikel und Telekommunikationsbranche bis hin zu Produkten, die eine direkte Affinität zum Sportsektor aufweisen.
Dieser Einsatz von so genannten Testimonials in der Werbung hat sich in den letzten Jahren enorm ausgeprägt. Testimonialwerbung erlebt quasi einen Boom und ist aktueller denn je, da Unternehmen im Rahmen ihrer Kommunikationspolitik vermehrt auf Testimonialwerbung setzen.
Sport-Testimonialwerbung
Welcher Konsument, insbesondere im Fernsehen, kennt dieses Phänomen nicht: Es gibt kaum einen Werbespot für dessen Produkte ein Star aus dem Sportsektor nicht wirbt. Sei es Boris Becker für eine Internet-Pokerplattform, Jogi Löw für Tui, Roger Federer für Gillette, Zinedine Zidane für ein Deo von Addidas, Dirk Nowitzki für eine Versicherung, Jürgen Klopp für Seat, Michael Greis und Magdalena Neuner für Erdinger, Sebastian Vettel für eine Haarpflegemarke, Thomas Müller für Bifi und viele Beispiele mehr. Die gesamte Bandbreite der Testimonialwerbung mit Sportlern ist riesig und umfasst das komplette Produktsortiment - von der Automobilbranche über Gesundheitsartikel und Telekommunikationsbranche bis hin zu Produkten, die eine direkte Affinität zum Sportsektor aufweisen. Dieser Einsatz von so genannten Testimonials in der Werbung hat sich in den letzten Jahren enorm ausgeprägt. Testimonialwerbung erlebt quasi einen Boom und ist aktueller denn je, da Unternehmen im Rahmen ihrer Kommunikationspolitik vermehrt auf Testimonialwerbung setzen.
Aufgrund der Aktualität von Testimonialwerbung stellt sich an dieser Stelle berechtigterweise die Frage, warum die (Sport-)Testimonialwerbung als Instrument der Kommunikationspolitik von Unternehmen vermehrt in ihrem Kommunikationsmixes zum Einsatz kommt. Bevor jedoch speziell auf das Phänomen der Sportler/innen als Werbträger eingegangen wird, erfolgt vorab ein Perspektivwechsel auf theoretischer Ebene, indem dieses Phänomen zunächst einmal aus soziologischer Perspektive betrachtet und analysiert wird. Durch diesen Perspektivwechsel lässt sich bereits erkennen, warum gerade Sportler besonders gut als Werbefiguren geeignet sind.
Laut dem Soziologen Karl-Heinrich Bette (2007) ist in einer funktional differenzierten Gesellschaft der Spitzensport der einzige Sozialbereich, der real existierende Helden noch in einer ungefährlichen und größtenteils akzeptierten Weise produzieren kann (vgl. Bette, 2007, S. 243). Dies liegt einerseits an der generellen Bedeutungsverschiebung in der Bewertung politischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und militärischer Führungspersonen und andererseits an verschiedenen sportinternen Bedingungen, die den Spitzensport zum zentralen Heldensystem der modernen Gesellschaft gemacht haben. Diese sportinternen Bedingungen werden im folgenden näher beschrieben und erläutert:
Die Heldenfähigkeit des System Spitzensport ist das Resultat spezifischer Arrangements, die sich im Gefolge seiner Ausdifferenzierung in zeitlicher, sachlicher, sozialer und räumlicher Hinsicht ergeben haben, so dass sich der Spitzensport quasi ein „Opportunitätsmilieu für die Epiphanie und Apotheose von Helden" geschaffen hat, das es in dieser Art weder in den Systemen Wissenschaft, Politik und Erziehung noch in Wirtschaft, Kunst oder Religion in vergleichbarer Weise existiert (vgl. ebd., S. 247). So finden erstens sportliche Wettkämpfe in Sonderräumen statt wie beispielsweise in Sporthallen, Arenen, Schwimmbecken und Stadien, die ganz bewusst auf Beobachtungen hin ausgerichtet sind. Helden müssen nämlich nicht nur besondere heroische Leistungen erbringen, sondern brauchen vielmehr auch Beobachter, die die sportliche Leistung mitbekommen und diese als außergewöhnlich empfinden bzw. erleben. In diesem Zusammenhang wurde die Karriere des Spitzensports als zentrales Heldensystem durch die Expansion der Massenmedien enorm erleichtert, so dass nichtanwesende Zuschauer trotzdem die sportlichen Wettkämpfe live oder in einer zeitlich verzögerten Zusammenfassung verfolgen können. Somit wurde in Form dieser Verfügbarmachung der öffentlichkeitsorientierten Sporträume eine wesentliche Voraussetzung für eine breite Heldenverehrung und soziale Prominenz erfüllt (vgl. ebd., S. 247), denn durch die Beobachtung und Bewertung der sportlichen Leistung durch Zuschauer können die Spitzensportler zu Helden aufsteigen und sind aus diesem Grund deutlich interessanter für mögliche Werbekampagnen von Unternehmen.
Des Weiteren profitiert die Heldenfähigkeit des Spitzensports zweitens von dem relativ voraussetzungslosen Inklusionsmodus, mit dem der Spitzensport per se auf die Zuschauer zugreift. In diesem Kontext reichen Wahrnehmung und organische Empathie bereits aus, um an sportlichen Wettkämpfen als Zuschauer/Beobachter partizipieren zu können. Da sämtliche Wettkämpfe nonverbale Sportentscheidungen sind, können sie von Menschen aus der ganzen Welt trotz vorhandener Sprachbarrieren angesprochen und verstanden werden. Zudem können die Zuschauer beim Sport direkt an dem Prozess der Entscheidungsfindung teilhaben und auf diesem Weg Authentizitätsgefühle wie Emotionen und Spannung erleben bzw. entwickeln. Außerdem besitzt der Sport eine gewisse Eindeutigkeit und Nachvollziehbarkeit, die bereits über einfache Wahrnehmungsprozesse und Empathie zu erzielen ist (vgl. ebd., S. 248f.).
Die dritte sportinterne Bedingung für die Heldenfähigkeit des Spitzensports profitiert davon, dass das Agieren der Athleten einer einfachen zu verstehenden Logik unterliegt, genauer gesagt geht es um den Code Sieg und Niederlage. Ein weiterer Umstand besteht darin, dass die im Sieg/Niederlage-Code eingespeicherten Rekord- und Steigerungslogik das Streben der Athleten nach besonderen Leistungen strukturell auf Dauer stellt. Durch diese Rekord- und Steigerungslogik wird vom Sportler quasi erwartet, dass er sich nicht auf seine bisher erbrachten sportlichen Leistungen ausruht, sondern bestehende Rekordmarken überbietet und sein Ansehen immer wieder auf neue bestätigen muss (vgl. ebd., S. 249).
Die Heldenfähigkeit des Spitzensports besteht viertens in der Spannungsträchtigkeit und Harmlosigkeit sportlicher Wettkämpfe (vgl. Bette, 1989, S. 174ff.). Spannung entsteht einerseits durch die nicht Planbarkeit und Ergebnisoffenheit sportlicher Wettkämpfe sowie andererseits durch den systeminternen, binären Code Sieg/Niederlage. Eine weitere Spannungs- und Erlebnissteigerung resultiert durch den Umstand, dass sportliche Wettkämpfe für die Zuschauer eine ganz andere Bedeutung aufweist als zum Beispiel politische, wirtschaftliche oder gesundheitliche Auseinandersetzungen. Bei dem Sport geht es generell um ein für sich unwichtiges Gut, sprich um einen Sieg bzw. um eine Niederlage. Anders als in anderen Sozialbereichen, wo es um den wirtschaftlichen Ruin oder um Leben und Tod geht. Folglich greifen sportliche Wettkämpfe bei Weitem nicht so enorm in die Lebensumstände der Zuschauer ein als es andere Sozialbereiche tun.
Die letzte und fünfte sportinterne Bedingung für die Heldenfähigkeit des Spitzensports liegt in der Leistungsindividualisierung und Selbstheroisierung. Der sportliche Erfolg und die Selbstprofilierung wird nicht durch Determinanten wie beispielsweise Alter, Geschlecht, Rasse, Religionszugehörigkeit oder Herkunft erzielt, sondern erfolgt vielmehr auf der Basis physischer, psychischer, sozialer und technisch-taktischer Kompetenzen. Diesen auf Eigenleistung begründeten Status des Einzelnen verspricht auf Seiten der Zuschauerschaft Akzeptanz, Plausibilität und Eindeutigkeit (vgl. Bette, 2007, S. 250).
[...]
Häufig gestellte Fragen zur Testimonialwerbung
Was ist Testimonialwerbung im Sport?
Hierbei werben bekannte Sportstars als „Testimonials“ für Produkte, um deren Glaubwürdigkeit und Attraktivität durch ihre eigene Prominenz und ihr Image zu steigern.
Warum sind gerade Sportler so gute Werbefiguren?
Sportler gelten in der modernen Gesellschaft als „reale Helden“. Sie vermitteln Emotionen, Authentizität und Erfolg, was sie für Unternehmen im Kommunikationsmix äußerst wertvoll macht.
Welche Rolle spielt der „Code Sieg und Niederlage“?
Der Sport unterliegt einer einfachen, weltweit verständlichen Logik von Sieg und Niederlage. Diese Eindeutigkeit macht sportliche Leistungen leicht nachvollziehbar und bewertbar.
Warum ist der Spitzensport ein „Heldensystem“?
Laut Soziologe Karl-Heinrich Bette produziert der Sport Helden in einer akzeptierten Weise, da Leistungen in öffentlichen Räumen (Stadien) erbracht werden, die medial weltweit verbreitet werden.
Was bedeutet „Leistungsindividualisierung“ im Sport?
Erfolg im Sport wird primär der Eigenleistung (physisch, psychisch) des Athleten zugeschrieben, unabhängig von Herkunft oder Religion, was eine hohe Akzeptanz beim Zuschauer schafft.
- Citar trabajo
- B.A. Martin Mertens (Autor), 2011, Testimonialwerbung im Sport, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206831