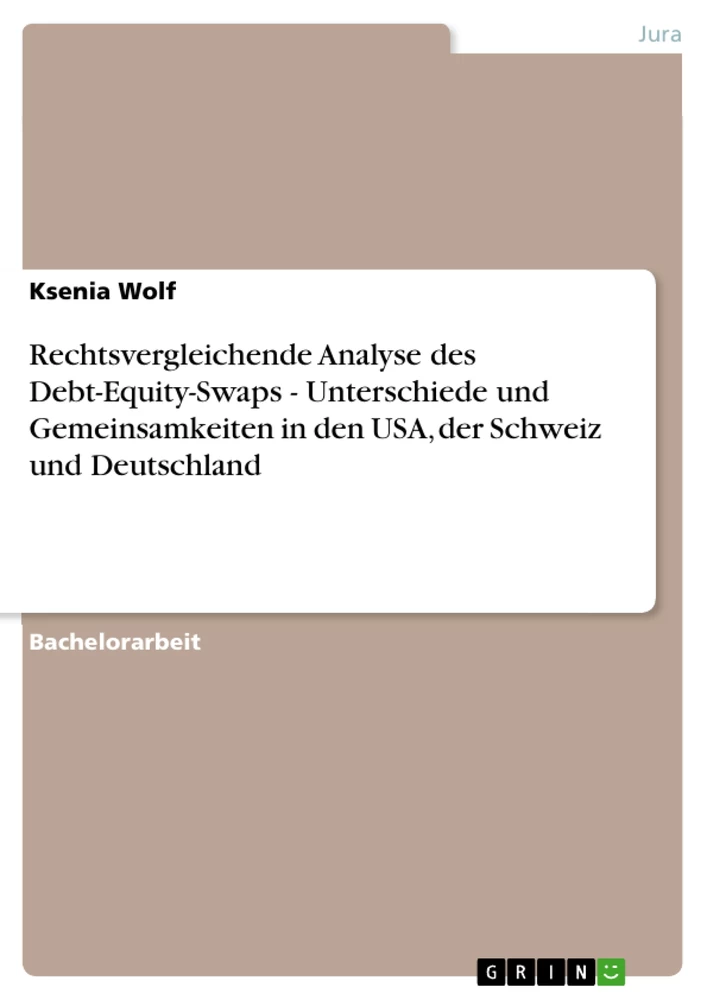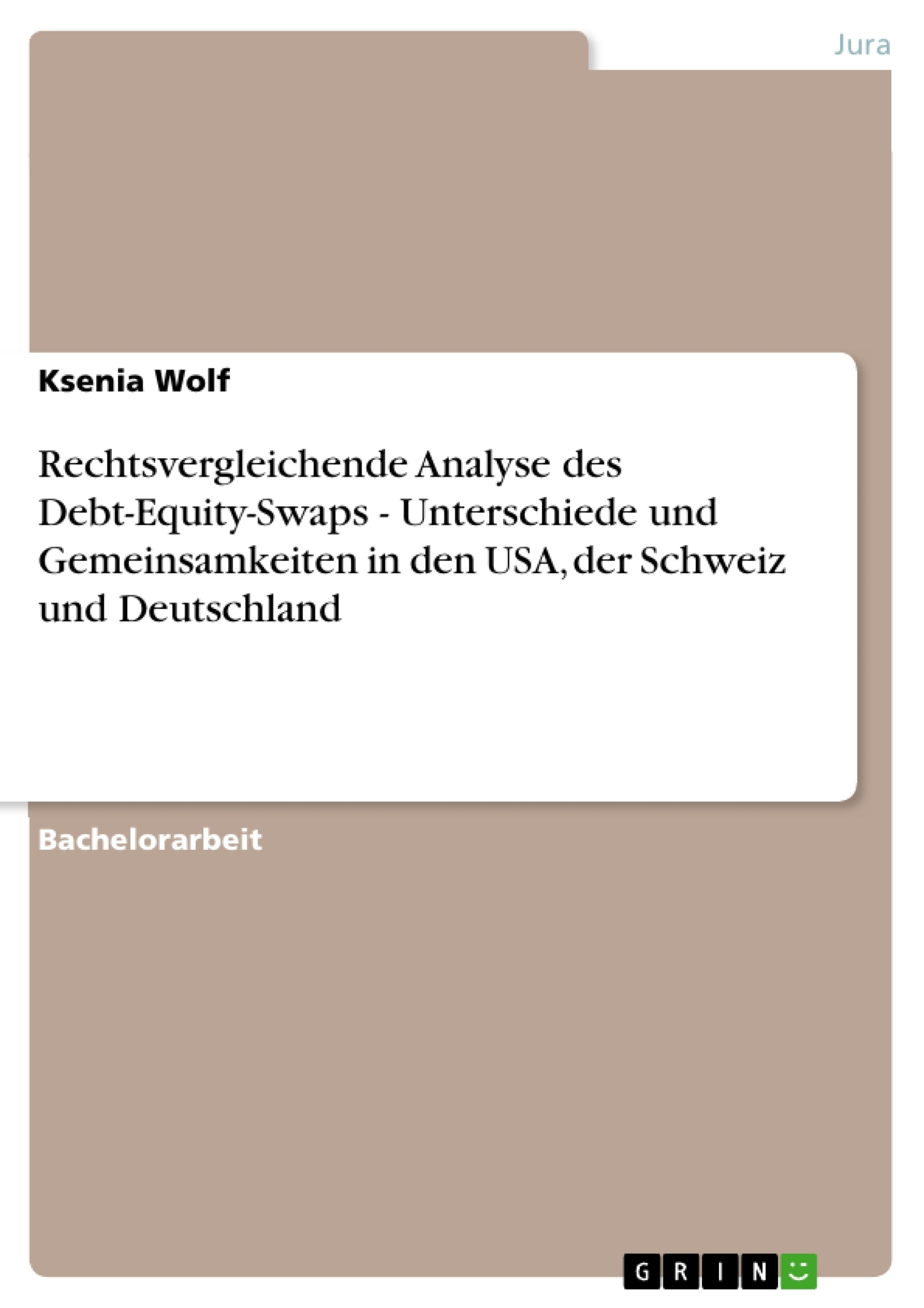Im theoretischen Teil der vorliegenden Bachelorarbeit werden Ziele und Methoden der Rechtsvergleichung (unter besonderer Berücksichtigung des Gesellschaftsrechts)dargestellt. Der Hauptteil – der Debt-Equity-Swap (DES), also die Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital – bezieht sich auf die rechtsvergleichende Untersuchung dieses Sanierungsinstruments. Dabei werden bei jeder der untersuchten Rechtsordnung zunächst die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Modalitäten aufgezeigt, um dann in den anschließenden Zwischenfazits funktionale Analysen vorzunehmen.
Im Fokus der Durchführung einer DES-Transaktion steht regelmäßig eine sanierungsbedürftige Gesellschaft. Als Instrument der Unternehmensfinanzierung und bilanziellen Restrukturierung kann der DES für die Krisenbewältigung eines Unternehmens eine große Bedeutung erlangen. Mit unterschiedlich hohen Hürden ist der DES in jeder der hier betrachteten Rechtsordnungen durchführbar. Um beurteilen zu können, inwiefern durch die Transaktion tatsächlich eine Sanierung bewirkt bzw. zu einer solchen beigetragen werden kann, befasst sich die vorliegende Arbeit mit deren einzelnen Voraussetzungen in den jeweiligen Rechtsordnungen und zwar in der Gesamtheit ihrer gesellschafts- und insolvenzrechtlichen Vorschriften.
So galt es in Deutschland bis vor kurzem mit Blick unter anderem auf das US-amerikanische Reorganisationsverfahren nach Chapter 11 die gesetzliche Grundlage für erfolgreiche Sanierungen zu verbessern. Nun ist mit dem Inkrafttreten des ESUG am 01.03.2012 die Durchführung von Debt-Equity-Swap im Insolvenzplanverfahren ausdrücklich vorgesehen. Daher wird auch in der vorliegenden Arbeit konsequent zwischen dem gesellschaftsrechtlichen und dem DES im Insolvenzplan unterschieden. Die Möglichkeit der DES-Durchführung in der Schweiz im Rahmen des sog. Harmonika-Verfahrens ist hingegen mit der Rechtslage in Deutschland vor dem Inkrafttreten des ESUG, also mit einem gesellschaftsrechtlichen DES, vergleichbar. Die gegenwärtige Praxis sowie der schweizerische Gesetzgeber bedienen sich jedoch zur Lösung der einzelnen, mit der Transaktion einhergehen Probleme – wie Fragen der Forderungsbewertung und des Minderheitenschutzes - anderer, sich von vom deutschen Recht unterscheidenden Ansätze. Das US- amerikanische Recht kann schließlich vor allem durch die Einbindung der Gesellschafter in den Reorganisationsplan eine Vorbildstellung für die Regelung des 225a Abs. II InsO n. F. beanspruchen.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Frage 1: Ziele und Methoden der Rechtsvergleichung,
insbesondere im Gesellschaftsrecht
A. Einleitung
B. Ziele der Rechtsvergleichung
I. Material für den Gesetzgeber
1. Vorzüge
2. Beispiele aus dem deutschen Rechtskreis
3. Beispiel aus Osteuropa
II. Rechtsharmonisierung und Rechtsvereinheitlichung
III. Rechtsprechung und Lückenfüllung
1. Lage in Deutschland
2. Länderbeispiele
3. EuGH
IV. Weitere Ziele
C. Methoden der Rechtsvergleichung
I. Makro- und Mikrovergleich
II. Funktionaler Ansatz
1. Grundzüge der funktionalen Methode
2. Beispiel 1: Gläubigerschutz im Gesellschaftsrecht
3. Beispiel 2: Business Judgement Rule
III. Auswahl der Vergleichsrechtsordnungen
IV. Der Vergleich
D. Fazit
Frage 2: Debt- Equity-Swap: Funktionen, Voraussetzungen,
Minderheitenschutz und Bewertungsfragen in der deutschen,
schweizerischen sowie US-amerikanischen Rechtsordnung
A. Ausgangssituation
B. Debt-Equity-Swap: Begriffsbestimmung und Funktionen
C. Rechtslage in Deutschland
I. Voraussetzungen
1. Gesetzliche Rahmenbedingungen
2. Die Durchführung der DES-Transaktion
a) Erforderliche Kapitalmaßnahmen
b) Zustimmungserfordernis
aa) Gesellschaftsrechtlicher DES
bb) DES im Insolvenzplan
c) Bezugsrecht der Alt-Gesellschafter
aa) Gesellschaftsrechtlicher DES
bb) DES im Insolvenzplan
d) Nachrangigkeit der Forderungen
e) Differenzhaftung
II. Minderheitenschutz
1. Obstruktionsverbot
2. Entschädigung bei Schlechterstellung
3. Sofortige Beschwerde
III. Bewertungsfragen
1. Gesetzlicher Rahmen
2. Bewertung zum Vollwert
3. Bewertung zum Nominalwert
4. Lösung im Insolvenzplan
a) Werthaltigkeitsprüfung
b) Going-concern vs. Zerschlagungswert
IV. Fazit
D. Rechtslage in der Schweiz
I. Voraussetzungen des DES
1. Gesetzliche Rahmenbedingungen
2. Ablauf der DES-Transaktion
a) Ablauf nach der geltenden Rechtslage
aa) Kapitalmaßnahmen
bb) Verrechnungsliberierung
b) Ablauf nach der Aktienrechtsrevision
3. Zwischenfazit
II. Minderheitenschutz
1. Stimmrecht
2. Bezugsrecht
3. Zwischenfazit
III. Bewertungsfragen
1. Diskussion de lege lata: Nennwert vs. Verkehrswert
a) Verrechnung zum Verkehrswert
b) Verrechnung zum Nennwert
2. Rechtslage de lege ferenda
3. Zwischenfazit
IV. Fazit
E. Rechtslage in den USA
I. Voraussetzungen des DES
1. Gesetzliche Rahmenbedingungen
2. Voraussetzungen im Einzelnen
a) Reorganisationsplan
b) DES im Reorganisationsplan
c) Folgen des bestätigten Reorganisationsplanes
3. Zwischenfazit
II. Minderheitenschutz
1. Cram-down
2. Gesicherte Gläubiger
3. Ungesicherte Gläubiger und Anteilsinhaber
4. Handhabung in der Praxis
5. Zwischenfazit
III. Bewertungsfragen
1. Interessenskollision
2. Ansätze der Unternehmensbewertung
3. Market approach
4. Zwischenfazit
F. Conclusio
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Debt-Equity-Swap (DES)?
Ein Sanierungsinstrument, bei dem Gläubigerforderungen in Eigenkapital (Gesellschaftsanteile) umgewandelt werden, um die Bilanz eines Unternehmens zu entlasten.
Wie unterscheidet sich die Rechtslage in Deutschland seit dem ESUG?
Seit 2012 ist der DES ausdrücklich im Insolvenzplanverfahren vorgesehen, was die Durchführung gegen den Widerstand von Altgesellschaftern erleichtert.
Was ist das „Harmonika-Verfahren“ in der Schweiz?
Ein Sanierungsverfahren, bei dem das Kapital herabgesetzt und gleichzeitig wieder erhöht wird, um Verluste zu beseitigen und neue Mittel zuzuführen.
Welche Vorbildfunktion hat das US-Recht (Chapter 11)?
Das US-Recht diente als Vorbild für die Einbindung von Gesellschaftern in Reorganisationspläne und das Überwinden von Blockaden (Cram-down).
Welche Probleme treten bei der Forderungsbewertung auf?
Die zentrale Frage ist, ob Forderungen zum Nennwert oder zum oft deutlich geringeren Verkehrswert in Eigenkapital umgewandelt werden sollen.
- Quote paper
- LLB Ksenia Wolf (Author), 2012, Rechtsvergleichende Analyse des Debt-Equity-Swaps - Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den USA, der Schweiz und Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206832