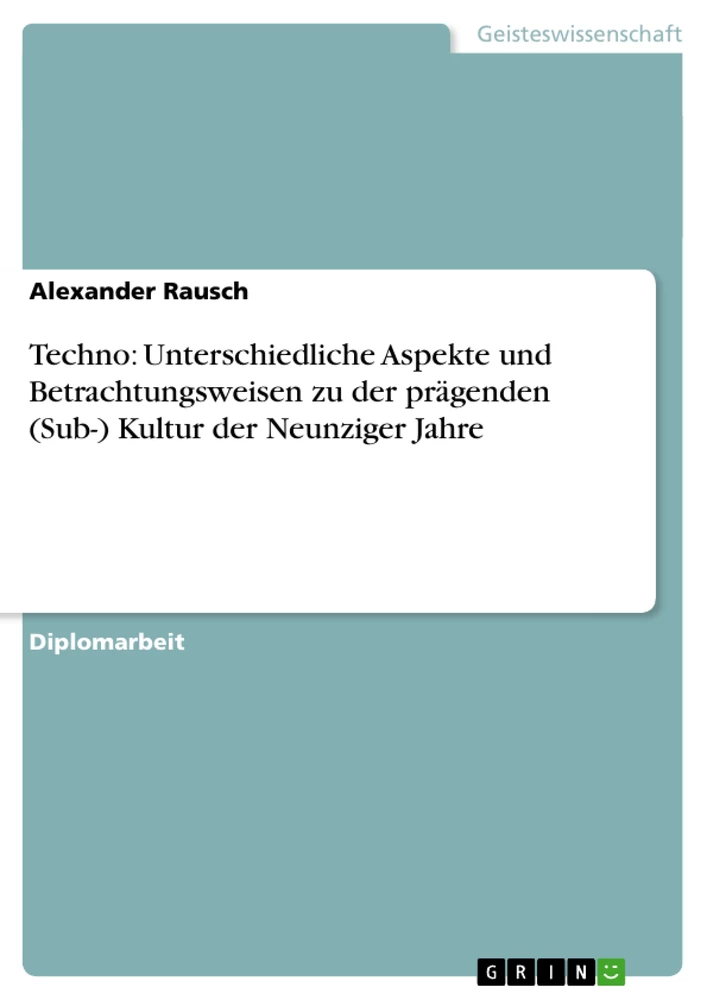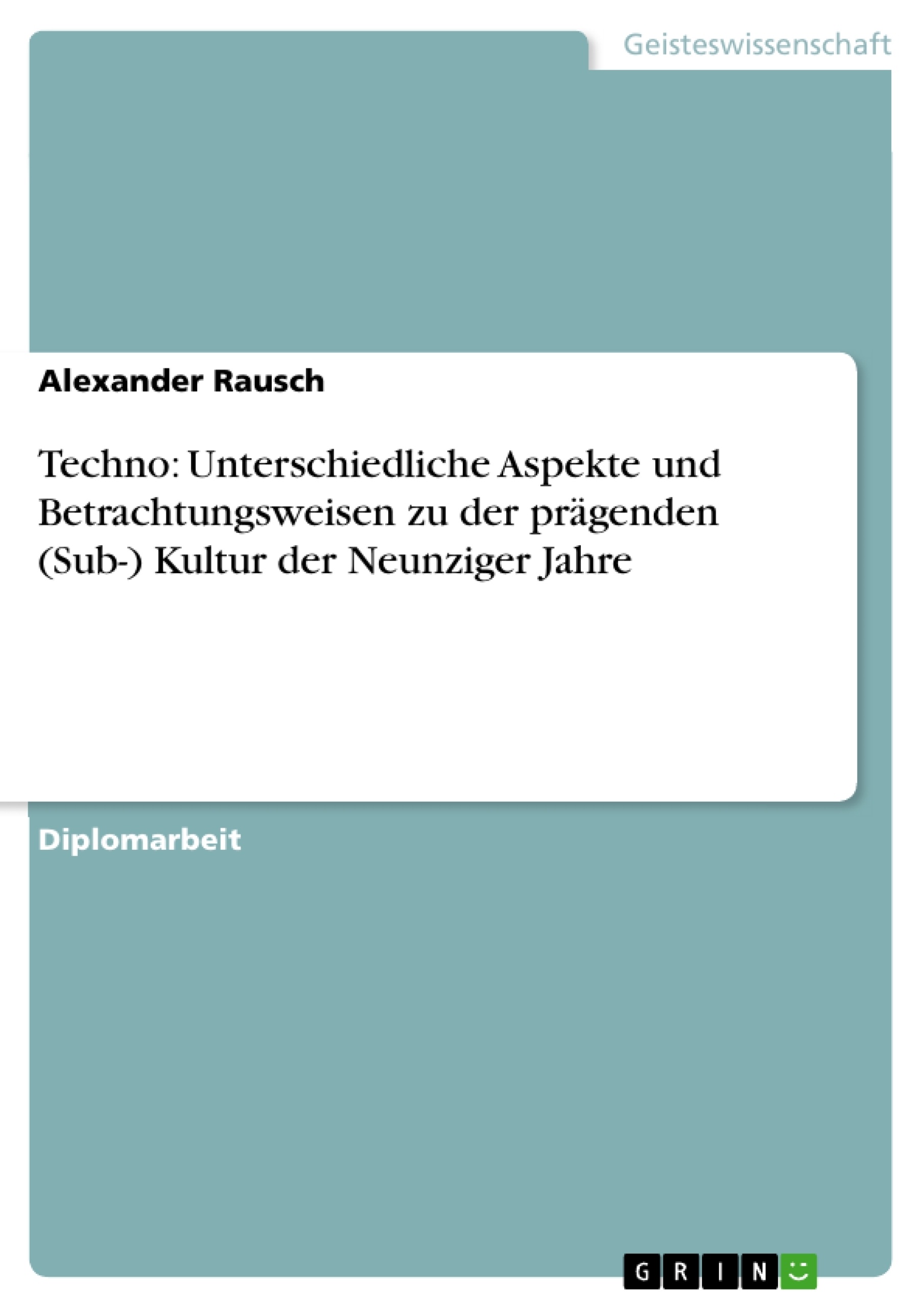Mein Interesse, dieses Thema als Abschlussarbeit meines Studiums zu wählen, liegt zum einen im persönlichen Lebensalltag, dem Leben und Arbeiten in subkulturellen Teilbereichen der Techno-Kultur und dem Praktizieren verschiedener (Techno-) Kulturpraktiken, zum anderen darin - hier liegt die Hauptmotivation - die Techno-Bewegung nicht nur unter den Aspekten Party- und Drogenkultur darzustellen, wie bei der meisten (Techno-) Literatur geschehen, sondern vielmehr auf die Auswirkungen der Bewegung in verschiedene Bereiche des Lebensalltages der Menschen in den 90er Jahren bis heute einzugehen.
Für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist dieses Wissen um die Kulturpraktiken in heutiger Zeit sehr wichtig, um die Lebenswelt derjenigen zu begreifen, mit deren Problemen "wir uns" auseinandersetzen.
Im ersten Teil werde ich über den Kulturbegriff und die Betrachtung früherer Musikbewegungen den Weg zur heutigen Technokultur beschreiben.
Teil 2 befasst sich ausführlich mit der Geschichte elektronischer Musik (1900-Heute), beschreibt die Technokultur in all den verschiedenen Facetten (u.a. Partykultur, ästhetische Kultur, Kommunikation) und nach der Klärung der Begriffe Kunst, Kultur, Kommerz und Konsum wird der Stellenwert von Drogen in der Technokultur abschließend beleuchtet.
In Teil 3 werde ich verschiedene (Präventions-) Modelle in der Drogenarbeit in (Sub-) Kulturen vorstellen. An dieser Stelle wird die Entwicklung der alternativen Drogen-Projektarbeit von den 1970er Jahren bis Heute erläutert und die daraus folgenden, möglichen Konsequenzen diskutiert.
Teil 4 beschäftigt sich mit den kreativen Auswirkungen und innovativen Kulturpraktiken der Technobewegung. Innovation, Kunst und Kultur aus der Techno (Sub-) Kultur finden wir immer mehr im "normalen Alltag" wieder (...).
Das Ende der Arbeit bildet das Kapitel "Sichtweisen". Kultur, Subkultur, Musik, Drogen (...). Was passiert in der Entwicklung einer Gesellschaft, dass sich zu bestimmten Zeiten bestimmte Subkulturen bilden? Was bedeutet das Entstehen der Techno-Kultur für uns in heutiger Zeit? Warum jetzt? Warum Techno? Was hat das mit unserer Gesellschaft zu tun?
Ich hoffe, dass Sie sich nach dem Lesen des Buches einige der Fragen beantworten können bzw. neue Aspekte oder Sichtweisen zum Thema erlangen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Vorüberlegungen zur Technokultur
- Der Kulturbegriff
- Jugendkultur
- Subkultur
- Kulturindustrie
- Die Masse
- Ästhetische Kultur
- Betrachtung früherer Musikbewegungen
- Die Rock ´n´ Roll Ära
- Die Beat Ära
- Die Psychedelische Ära
- Die Punk Ära
- Technokultur
- (Elektronische-) Musikgeschichte
- Entwicklung der Technomusik
- Chicago
- Detroit
- Ibiza
- Goa
- London
- Manchester
- Frankfurt am Main
- Berlin
- Techno-Musik
- Technosound und Technoproduktion
- Plattenlabel
- Tonträger / Musik als Ware
- Ton - Träger / Die Discjockeys (DJ´s)
- Technokultur / Partykultur
- The Raving Society
- Altersspezifische Zuordnung
- Club – Kultur
- Rave-Kultur
- Klasse / Schicht / Ethnizität
- Geschlecht
- Techno – Eine ästhetische Kultur
- Hören
- Sehen
- Fühlen
- Kommunikation
- Flyer
- Fanzines und Magazine
- Radio
- TV
- Internet
- Kleidung / Sprache
- Kleidungsstil
- Sprache
- Massenphänomen
- Paraden und Großveranstaltungen
- Kunst / Kultur / Kommerz / Konsum
- Drogen
- Über ein Jahrzehnt Technokultur
- (Elektronische-) Musikgeschichte
- Sozialarbeit in der (Sub-) Kultur
- Vorstellung des Projekts Eve & Rave e.V.
- Vereinskonzept und Tätigkeitbeschreibung (Eve & Rave e.V. Berlin)
- „Rave, pure Rave“
- Vorstellung einzelner Projekte
- Das Safer House Konzept: Die Idee vom gesunden Feiern
- Druckchecking und Healthservice
- Monitoring (Trendüberwachung)
- Party- und Chill Out Konzept
- Europaweite Vernetzung / Zusammenarbeit
- Auswirkungen in der Sozialarbeit
- Neue Wege- oder: Der alte Kampf um die Freiheit
- RELEASE:Verein zur Bekämpfung der Rauschgiftgfahr
- Selbstverständnis akzeptierender Drogenarbeit in den 80ern
- Harm - reduction - Strategien im Strafvollzug
- Ecstasy als Unterrichtsthema
- INDRO e.V.
- Zusammenfassung
- Technokultur als Tummelplatz für kreative Menschen und innovative Projekte
- Drogen mal ganz anders (über MDMA)
- Professionelle Therapie
- Private „Reisen“
- Mindmachines - Techno-Meditation
- Mindmachines – Meditationsmaschinen
- Kommunizieren im Geist
- Techno unter Wasser
- Klangkunst - „Kunst macht hörbar“
- Goa-Trancebewegung - Techno-Hippies
- Die Cybertribes
- Spiral Tribe UK
- Psychonautisches Techno-Zeitalter
- Techno + Japan
- Liveact im Citröen
- Drogen mal ganz anders (über MDMA)
- Sichtweisen
- Einblick
- Ausblick
- Glossar
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Technokultur der 1990er Jahre aus soziologischer und sozialpädagogischer Perspektive. Sie geht über die gängigen Darstellungen von Technokultur als reine Party- und Drogenkultur hinaus und analysiert deren Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche. Ein Schwerpunkt liegt auf der Auseinandersetzung mit den kritischen Argumenten der Technokultur-Gegner.
- Der Kulturbegriff im Kontext der Technokultur
- Analyse der kulturellen Praktiken der Technoszene
- Der Umgang mit Drogen und Drogenpolitik innerhalb der Szene
- Innovative und kreative Projekte in der Technokultur
- Möglichkeiten und Grenzen der Sozialarbeit in der Technoszene
Zusammenfassung der Kapitel
Vorüberlegungen zur Technokultur: Dieses Kapitel untersucht den Kulturbegriff in seinen verschiedenen Facetten und beleuchtet kritische Stimmen, die Technokultur als inhaltslos abtun. Durch einen Vergleich mit früheren Musikbewegungen (Rock'n'Roll, Beat, Hippie, Punk) werden Parallelen und Unterschiede aufgezeigt, um die Einwände der Kritiker zu kontextualisieren und die Eigenständigkeit der Technokultur zu betonen. Der Fokus liegt auf der Klärung des Kulturbegriffs und der Auseinandersetzung mit Theorien der Kulturindustrie, um den komplexen Charakter der Technokultur zu verstehen.
Technokultur: Dieses Kapitel beschreibt die Technokultur als ein vielschichtiges Phänomen, das Musik, Bewegung, Sozialisation, Partykultur und Subkultur umfasst. Es verfolgt die Entwicklung der elektronischen Musik und deren Einfluss auf die Technoszene, beleuchtet die Besonderheiten des Technosounds und der Musikproduktion sowie die Rolle von Plattenlabels und DJs. Die Kapitel beschreiben den multikulturellen Charakter der Szene und diskutieren die komplexen Beziehungen von Klasse, Schicht, Ethnizität und Geschlecht. Die ästhetischen Aspekte der Technokultur, insbesondere die Bedeutung von Hören, Sehen und Fühlen im Kontext der Techno-Party, werden analysiert.
Sozialarbeit in der (Sub-) Kultur: Dieses Kapitel präsentiert das Projekt Eve & Rave als Beispiel für akzeptierende Drogenarbeit in der Technoszene. Es beschreibt das Vereinskonzept, die Tätigkeitsschwerpunkte und verschiedene Projekte wie das Safer House Konzept, Drugchecking und Monitoring. Der Kapitel vergleicht Eve & Rave mit anderen Initiativen wie Release und INDRO, um die Entwicklung der akzeptierenden Drogenarbeit und die damit verbundenen Herausforderungen darzustellen. Der Fokus liegt auf den Möglichkeiten und Grenzen der Sozialarbeit im Kontext einer schnelllebigen und sich verändernden Subkultur.
Technokultur: Tummelplatz für kreative Menschen und innovative Projekte: Dieses Kapitel untersucht innovative Projekte und Aktivitäten innerhalb der Technokultur, die über den rein kommerziellen Aspekt hinausgehen. Es beleuchtet den therapeutischen Einsatz von MDMA, die Verwendung von Mindmachines zur Meditation, die Klangkunst von Wolfram der Spyra, die Goa-Trancebewegung als Verbindung von Techno und Hippie-Kultur, sowie die Entwicklungen der Technokultur in Japan. Der Kapitel zeigt die Vielseitigkeit der Szene und das kreative Potential ihrer Akteure.
Sichtweisen: Das abschließende Kapitel reflektiert die Arbeit und fasst die Ergebnisse zusammen. Es setzt sich kritisch mit dem oft unreflektierten Umgang der Medien und der Gesellschaft mit Technokultur auseinander und betont die Notwendigkeit eines differenzierten Verständnisses der Szene. Der Autor argumentiert für eine sozialpädagogische Praxis, die die Lebenswelten der betroffenen Menschen berücksichtigt und Akzeptanz in den Vordergrund stellt.
Schlüsselwörter
Technokultur, elektronische Musik, House, Techno, Rave, Clubkultur, Drogen, Ecstasy, MDMA, Sozialarbeit, akzeptierende Drogenarbeit, Kulturindustrie, Subkultur, Jugendkultur, Kommerz, Konsum, Bricolage, Cybertribes, Mindmachines, Klangkunst, Globalisierung, Identität, Sozialisation, Kommunikation, Medien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Technokultur der 1990er Jahre"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Technokultur der 1990er Jahre aus soziologischer und sozialpädagogischer Perspektive. Sie geht über die gängigen Darstellungen von Technokultur als reine Party- und Drogenkultur hinaus und analysiert deren Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche. Ein Schwerpunkt liegt auf der Auseinandersetzung mit den kritischen Argumenten der Technokultur-Gegner. Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Kulturbegriff im Kontext der Technokultur; die Analyse der kulturellen Praktiken der Technoszene; den Umgang mit Drogen und Drogenpolitik innerhalb der Szene; innovative und kreative Projekte in der Technokultur; Möglichkeiten und Grenzen der Sozialarbeit in der Technoszene; die Entwicklung der elektronischen Musik; die Rolle von Plattenlabels und DJs; den multikulturellen Charakter der Szene; die ästhetischen Aspekte der Technokultur; verschiedene Projekte der akzeptierenden Drogenarbeit; therapeutischer Einsatz von MDMA; Verwendung von Mindmachines; Klangkunst; Goa-Trancebewegung; und die Entwicklungen der Technokultur in Japan.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Vorwort, Einleitung, Vorüberlegungen zur Technokultur, Technokultur, Sozialarbeit in der (Sub-) Kultur, Technokultur als Tummelplatz für kreative Menschen und innovative Projekte, Sichtweisen und Glossar. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Technokultur, beginnend mit theoretischen Überlegungen zum Kulturbegriff und der Entwicklung der elektronischen Musik, über die Analyse der Sozialarbeit in der Szene bis hin zu innovativen Projekten und einem Ausblick.
Wie wird der Kulturbegriff in der Arbeit behandelt?
Der Kulturbegriff wird umfassend behandelt und im Kontext der Technokultur kritisch hinterfragt. Es werden verschiedene Facetten des Begriffs beleuchtet und kritische Stimmen, die Technokultur als inhaltslos abtun, berücksichtigt. Ein Vergleich mit früheren Musikbewegungen (Rock'n'Roll, Beat, Hippie, Punk) verdeutlicht Parallelen und Unterschiede und betont die Eigenständigkeit der Technokultur. Theorien der Kulturindustrie werden herangezogen, um den komplexen Charakter der Technokultur zu verstehen.
Welche Rolle spielen Drogen in der Arbeit?
Der Umgang mit Drogen und die Drogenpolitik innerhalb der Technoszene werden ausführlich analysiert. Die Arbeit thematisiert kritische Aspekte des Drogenkonsums, aber auch akzeptierende Drogenarbeit und Strategien zur Schadensminderung (Harm Reduction). Beispiele wie das Projekt Eve & Rave und Initiativen wie Release und INDRO werden vorgestellt, um verschiedene Ansätze der Drogenarbeit zu beleuchten. Auch der therapeutische Einsatz von MDMA und der Zusammenhang mit der Technokultur werden diskutiert.
Welche Rolle spielt die Sozialarbeit in der Technokultur?
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Sozialarbeit in der Technoszene. Das Projekt Eve & Rave e.V. dient als Beispiel für akzeptierende Drogenarbeit. Das Vereinskonzept, die Tätigkeitsschwerpunkte und verschiedene Projekte wie das Safer House Konzept, Drugchecking und Monitoring werden detailliert beschrieben. Ein Vergleich mit anderen Initiativen wie Release und INDRO zeigt die Entwicklung der akzeptierenden Drogenarbeit und die damit verbundenen Herausforderungen in einer schnelllebigen und sich verändernden Subkultur.
Welche innovativen Projekte werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene innovative Projekte und Aktivitäten innerhalb der Technokultur vor, die über den rein kommerziellen Aspekt hinausgehen. Beispiele hierfür sind der therapeutische Einsatz von MDMA, die Verwendung von Mindmachines zur Meditation, die Klangkunst von Wolfram der Spyra, die Goa-Trancebewegung als Verbindung von Techno und Hippie-Kultur, sowie die Entwicklungen der Technokultur in Japan. Diese Beispiele zeigen die Vielseitigkeit der Szene und das kreative Potential ihrer Akteure.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter, die die Arbeit charakterisieren, sind: Technokultur, elektronische Musik, House, Techno, Rave, Clubkultur, Drogen, Ecstasy, MDMA, Sozialarbeit, akzeptierende Drogenarbeit, Kulturindustrie, Subkultur, Jugendkultur, Kommerz, Konsum, Bricolage, Cybertribes, Mindmachines, Klangkunst, Globalisierung, Identität, Sozialisation, Kommunikation, Medien.
- Citation du texte
- Diplom Sozialpädagoge / System Coach / Trainer Alexander Rausch (Auteur), 2000, Techno: Unterschiedliche Aspekte und Betrachtungsweisen zu der prägenden (Sub-) Kultur der Neunziger Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20686