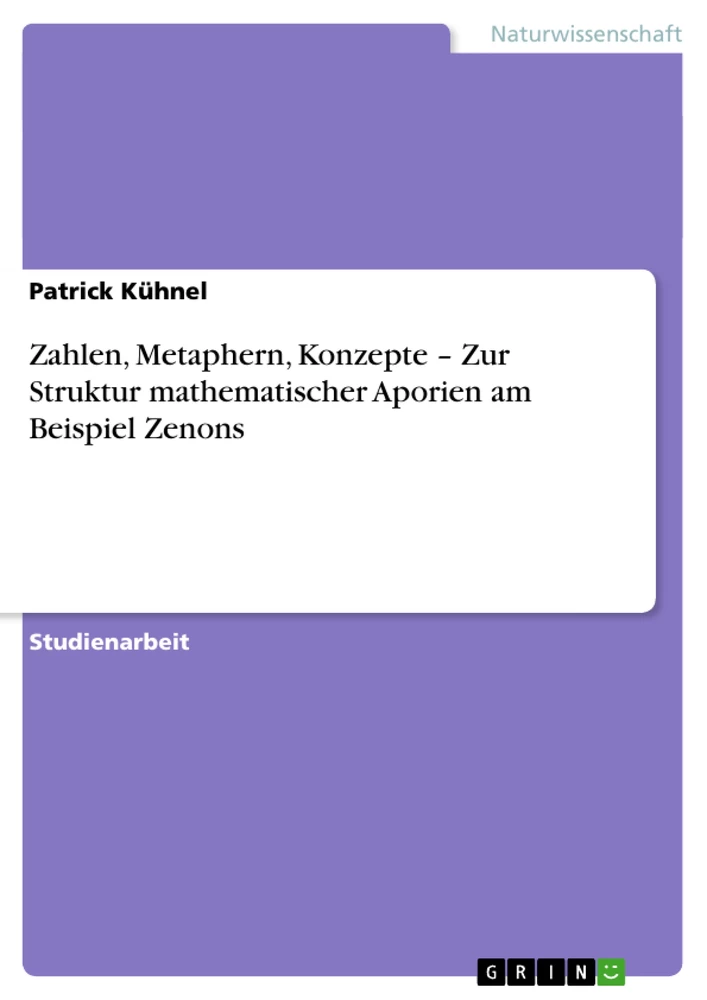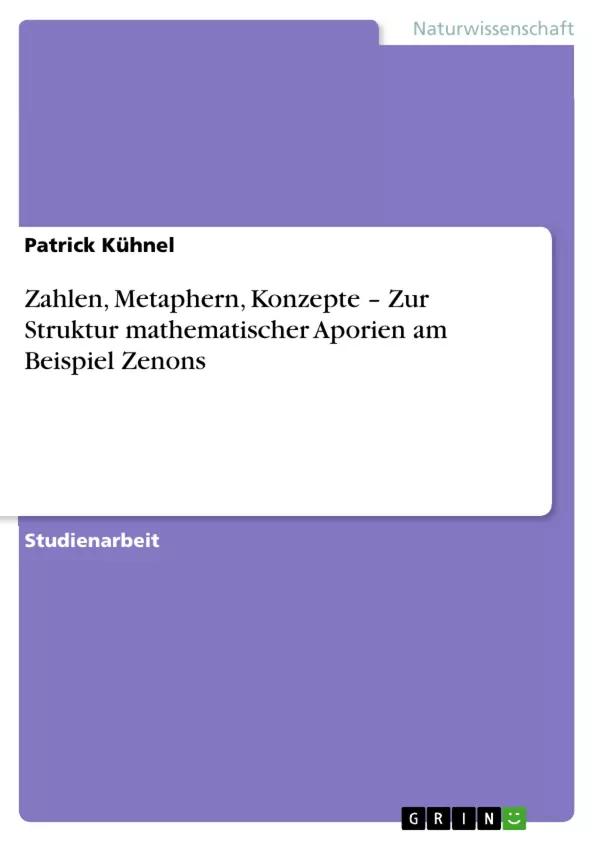Betrachtet man das zentrale Konzept der Analysis, das Infinitesimal, so fällt einem ein eigentümlicher Widerspruch in dessen Konzeption und Geschichte auf: Zum einen bemerkte schon Aristoteles den Widerspruch zwischen der Notwendigkeit der Existenz eines Begriffes von Unendlichkeit (der für die Konstruierbarkeit eines unendlich Kleinen Voraussetzung ist) zum anderen widerspricht das Konzept des Unendlichen jeder empirischen Plausibilität und Operationalisierbarkeit durch den Alltagsverstand. Aristoteles, dessen von Pythagoras inspirierten Betrachtungen zu Zeit und Raum die philosophischen Konzeptionen bis weit in die Neuzeit hinein prägten, versucht diesen Widerspruch durch die Feststellung zu lösen, dass es sich bei dem Unendlichen um reine Potentialität handele, dass also ein aktual Unendliches nicht existieren könne worauf er mehrfach im dritten Buch der Physik hinweist. Diese Erklärung ist oft kritisiert worden, da das eigentliche Problem nur verschoben wird: Von der Frage nach dem Unendlichen auf die Frage nach dem Wesen, d.h. der Frage, ob die Dinge eine Essenz haben, die jenseits deren Erkennbarkeit postulierbar wäre. Da das griechische mathematische Denken seinen Anker in der geometrischen Anschauung hatte ist es nicht verwunderlich, dass das Konzept unendlicher Teilbarkeit zu einem Konflikt mit dem Grundverständnis über das Wesen mathematischer Aussagen führen musste.
Dies jedoch für zu der grundsätzlichen Frage, inwieweit diejenigen Konzepte, die analytischem Denken zugrunde liegen und damit Erkenntnisse - insbesondere mathematische - erst ermöglichen gleichzeitig auch deren Reichweite und Tiefe begrenzen. Zu Klärung dieser Frage ist es freilich notwendig, einen Blick in die Genese mathematischer Konzepte zu werfen und speziell deren metaphorische Ebene zu beleuchten. Dies soll im vorliegenden Beitrag exemplarisch an den Zenonschen Paradoxien bzw. deren Lösungsansätzen versucht werden. Es wird mit Hilfe metapherntheoretischer und elementarmathematischer Überlegungen versucht nachzuzeichnen, wie die scheinbaren Paradoxien sich als Folge eines undifferenzierten Unendlichkeitsbegriffs ergeben, wobei letzterer sich wiederum direkt auf ein unzureichend abstraktes Zahlkonzept zurückführen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegende Konzepte
- Das Problem des Kontinuums
- Zenons Paradoxien
- Achilles und die Schildkröte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Beitrag untersucht die Struktur mathematischer Aporien am Beispiel der Zenonschen Paradoxien. Ziel ist es, die Grenzen des analytischen Denkens aufzuzeigen, die durch die zugrundeliegenden Konzepte gesetzt werden. Hierbei wird die Rolle metaphorischen Denkens und die Genese mathematischer Konzepte beleuchtet.
- Die Rolle von Metaphern im mathematischen Denken
- Der unzulängliche Unendlichkeitsbegriff in der Antike
- Das Problem der Kontinuität und die Grenzen des diskreten Zahlenverständnisses
- Analyse der Zenonschen Paradoxien im Kontext der griechischen Mathematik
- Die Grenzen der Gegenstandsmetaphorik für abstrakte Objekte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Problematik des Infinitesimals in der Analysis ein und stellt den Widerspruch zwischen der Notwendigkeit des Unendlichkeitsbegriffs und seiner empirischen Unplausibilität heraus. Aristoteles' Versuch, diesen Widerspruch durch die Unterscheidung von Potentialität und Aktualität zu lösen, wird kritisch beleuchtet. Der Beitrag kündigt die Analyse der Zenonschen Paradoxien als exemplarische Fallstudie an, um die Grenzen mathematischer Konzepte aufgrund unzureichender Abstraktion aufzuzeigen. Die Untersuchung soll metapherntheoretische und elementarmathematische Überlegungen vereinen.
Grundlegende Konzepte: Dieses Kapitel erläutert das grundlegende Zahlenverständnis der Antike, welches stark an den diskreten Anschauungsraum gebunden war. Die Herleitung der binomischen Formel (a+b)²=a²+2ab+b² wird als Beispiel verwendet, um die Rolle konzeptueller Metaphern zu verdeutlichen. Euklids geometrische Interpretation algebraischer Probleme wird analysiert, wobei die Metaphern „Strecken sind aus Grundbestandteilen zusammengesetzte Gegenstände“ und „Das Maß der Länge/Fläche ist die Anzahl von Grundbestandteilen“ im Mittelpunkt stehen. Die Isomorphie zwischen diskreten physikalischen Objekten und den algebraischen Strukturen wird hervorgehoben, um die Möglichkeit der Addition, Gruppierung und Multiplikation von Längen und Flächen zu erklären, wobei die Grenzen des Verfahrens auf die praktische Ebene beschränkt bleiben.
Das Problem des Kontinuums: Dieses Kapitel befasst sich mit der Schwierigkeit, die Grenze der Teilbarkeit konzeptuell zu überwinden. Aristoteles' Kritik an den Atomisten und seine eigene, eher intuitive Erklärung des Kontinuums werden dargestellt. Seine Argumentation, dass ein Kontinuum nicht aus unteilbaren Einheiten aufgebaut sein kann, da diese sich nicht berühren könnten, wird analysiert. Der Text zeigt auf, wie Aristoteles durch die starke Verhaftung an die Gegenstandsmetaphorik der Zahl in eine Tautologie gerät, da er das Kontinuum nur als Einheit definieren kann. Die Diskussion um die Raumvorstellung Aristoteles' wird beleuchtet, die ähnliche Paradoxien aufwirft, und die Grenzen seiner konzeptuellen Metaphorik, die auf diskreten Entitäten basiert, verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Zenons Paradoxien, Infinitesimal, Unendlichkeitsbegriff, Metapherntheorie, mathematische Aporien, Kontinuum, diskretes Zahlenverständnis, geometrische Anschauung, Aristoteles, analytisches Denken, konzeptuelle Metaphern, Gegenstandsmetaphorik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Zenonschen Paradoxien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Struktur mathematischer Aporien, insbesondere die Zenonschen Paradoxien. Sie untersucht die Grenzen des analytischen Denkens, die durch die zugrundeliegenden Konzepte gesetzt werden, und beleuchtet dabei die Rolle metaphorischen Denkens und die Genese mathematischer Konzepte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle von Metaphern im mathematischen Denken, den unzulänglichen Unendlichkeitsbegriff in der Antike, das Problem der Kontinuität und die Grenzen des diskreten Zahlenverständnisses, eine Analyse der Zenonschen Paradoxien im Kontext der griechischen Mathematik und die Grenzen der Gegenstandsmetaphorik für abstrakte Objekte. Es wird insbesondere auf Aristoteles' Philosophie und seine Versuche eingegangen, das Problem des Kontinuums zu lösen.
Welche Zenonschen Paradoxien werden betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich zwar nicht explizit auf alle Paradoxien, aber das Paradoxon von Achilles und der Schildkröte wird als Beispiel genannt. Die Analyse dient als exemplarische Fallstudie für die Grenzen mathematischer Konzepte.
Wie wird Aristoteles in der Arbeit behandelt?
Aristoteles' Versuche, den Widerspruch zwischen dem Unendlichkeitsbegriff und seiner empirischen Unplausibilität zu lösen (durch die Unterscheidung von Potentialität und Aktualität), sowie seine Kritik an den Atomisten und seine eigene Erklärung des Kontinuums werden kritisch beleuchtet. Seine starke Verhaftung an die Gegenstandsmetaphorik der Zahl und die daraus resultierenden Tautologien werden analysiert.
Welche Rolle spielen Metaphern in der Arbeit?
Die Arbeit betont die Rolle konzeptueller und Gegenstandsmetaphern im mathematischen Denken. Die Herleitung der binomischen Formel und Euklids geometrische Interpretation algebraischer Probleme dienen als Beispiele, um die Bedeutung von Metaphern für das Verständnis mathematischer Konzepte aufzuzeigen und deren Grenzen zu diskutieren.
Welche Schlüsselkonzepte werden erklärt?
Die Arbeit erklärt grundlegende Konzepte des antiken Zahlenverständnisses, das Problem des Kontinuums, den Unterschied zwischen diskreten und kontinuierlichen Größen und die Bedeutung des Unendlichkeitsbegriffs in der Mathematik. Die Grenzen des diskreten Zahlenverständnisses und die Herausforderungen, die sich aus der Konzeptualisierung des Kontinuums ergeben, werden ausführlich diskutiert.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, die sich mit der Einleitung, grundlegenden Konzepten, dem Problem des Kontinuums und einer Zusammenfassung der Zenonschen Paradoxien befassen. Die Einleitung führt in die Problematik ein. Das Kapitel zu den Grundkonzepten erläutert das antike Zahlenverständnis. Das Kapitel zum Kontinuum befasst sich mit der Schwierigkeit, die Grenze der Teilbarkeit zu überwinden. Die Zusammenfassung der Kapitel fasst die Kernaussagen jedes Kapitels zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zenons Paradoxien, Infinitesimal, Unendlichkeitsbegriff, Metapherntheorie, mathematische Aporien, Kontinuum, diskretes Zahlenverständnis, geometrische Anschauung, Aristoteles, analytisches Denken, konzeptuelle Metaphern, Gegenstandsmetaphorik.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Die Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit der Geschichte der Mathematik, der Philosophie der Mathematik und der Metapherntheorie auseinandersetzt. Die Arbeit erfordert ein gewisses Vorwissen in diesen Bereichen.
- Quote paper
- Patrick Kühnel (Author), 2012, Zahlen, Metaphern, Konzepte – Zur Struktur mathematischer Aporien am Beispiel Zenons, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206872