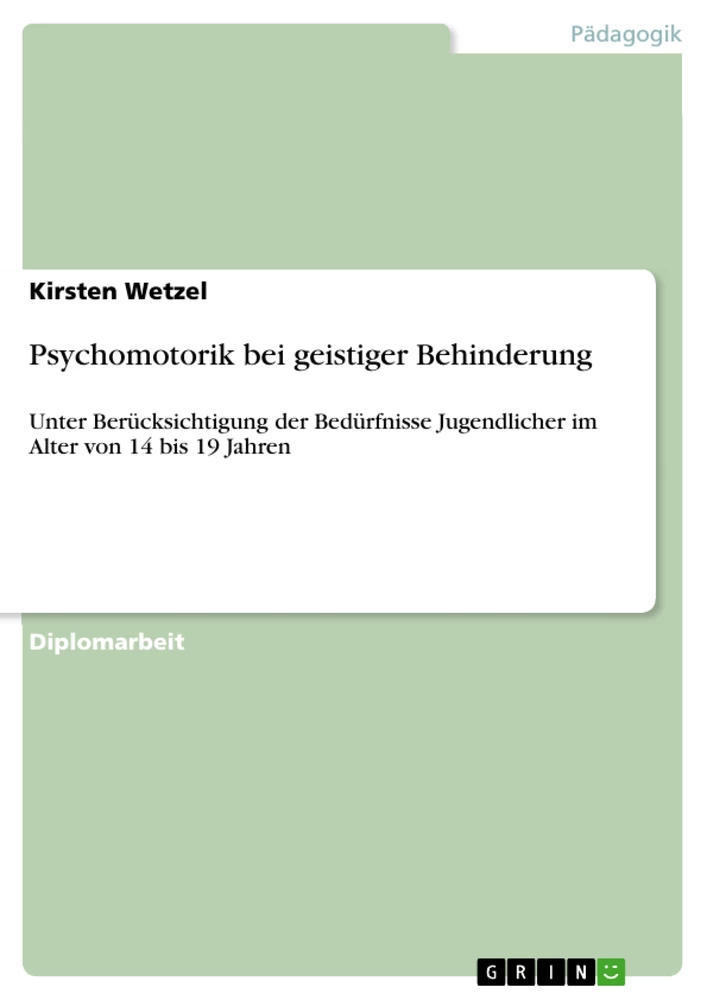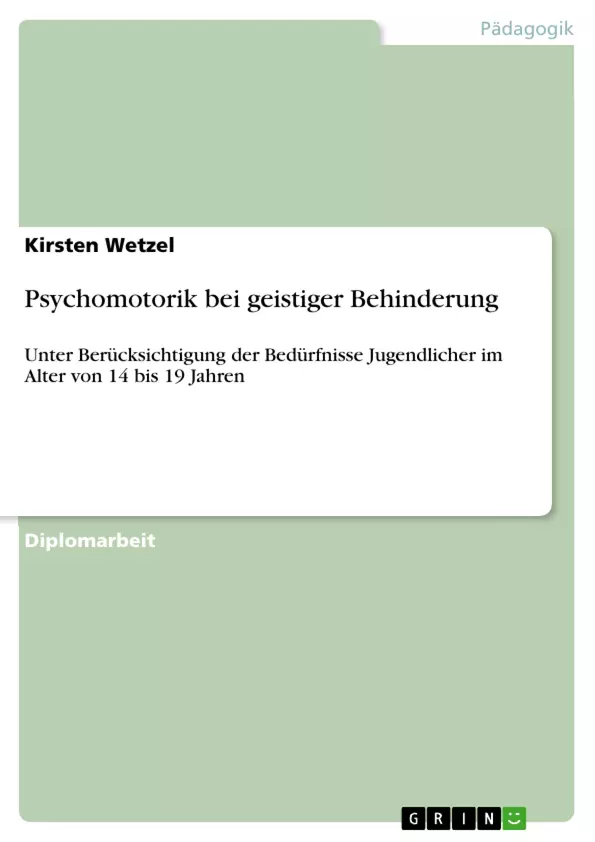Das Thema „Psychomotorik bei geistiger Behinderung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse Jugendlicher im Alter von 15-19 Jahren“ habe ich gewählt, da ich im universitären Rahmen ein Jahr lang mit Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung im schulischen Sportunterricht psychomotorisch gearbeitet habe. Ich werde im Verlauf der Diplomarbeit verschiedene Beispiele und Beobachtungen aus diesen Praxiserfahrungen anführen, wobei ich von „wir“ schreiben werde, da das studentische Team aus Kathrin Bünting, Martina Scheer und mir bestand.
Das Interesse an Psychomotorik bestand bei uns, da wir uns während des Studiums bereits mit anderen Konzepten, die den Körper und die Psyche betreffen, auseinandergesetzt haben, z.B. mit dem Psychodrama nach MORENO, dem „Konzentrativen Bewegungshandeln“ nach GOLDBERG und der „Kreativen Bewegungspädagogik auf der Grundlage heilpädagogischen Tanzes“ in einem Seminar von KUZNIK. Außerdem gibt es seit alters her in Religionsgemeinschaften und damit in der Gesellschaft die Elemente des Theaters, des Tanzes, der Bewegung und der Pantomime als Ausdrucks- und Kommunikationsformen.
Ursprünglich wollten wir jüngere Schüler und Schülerinnen betreuen, was aus organisatorischen Gründen scheiterte. In den theoretischen und praxisbegleitenden Seminaren zu diesem Praktikum wurden ausschließlich Inhalte behandelt, die sich auf Psychomotorik mit Kindern im Vor- oder Grundschulalter befaßten. So stellte sich uns während des Praktikums stetig die Frage nach den Zielen und Perspektiven einer psychomotorischen Förderung bei Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung; eine Beantwortung unter Bearbeitung bestehender Literatur stand aber noch aus.
Der Vorwurf vieler Autoren, daß praktizierende Psychomotoriker/ -innen sich wenig auf fundierte Theorien der Entwicklung stützen (vgl. Kap 2.2.), wurde also von uns bestätigt, jedoch nur insofern, als wir uns nicht explizit auf eine Theorie oder ein Konzept konzentrierten, sondern versuchten, unser gesammeltes Wissen aus vier bis fünf Studienjahren in die Praxis umzusetzen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Psychomotorik
- Was ist Psychomotorik?
- Konzeptionelle Ansätze zur psychomotorischen Förderung
- Bedeutung und Ziele der Psychomotorik
- Zur Begründung einer psychomotorischen Arbeitsweise
- Ziele der psychomotorischen Förderung
- Zielgruppen psychomotorischer Förderung
- Begründung der psychomotorischen Förderung bei geistiger Behinderung aus den Ergebnissen der Forschung
- Intelligenz und Motorik
- Beispiele zu Untersuchungen zur Effizienz psychomotorischer Förderung
- Förderdiagnostik auf psychomotorischer Grundlage
- Förderdiagnostische Methoden und Prinzipien in der Handlungspraxis
- Beispiele für Diagnoseverfahren in der psychomotorischen Förderung
- Geistige Behinderung
- Zur Terminologie
- Verschiedene Ursachen geistiger Behinderung
- Kennzeichen der geistigen Behinderung
- Definitionsansätze
- Zur gesellschaftlichen Situation von Menschen mit einer geistigen Behinderung
- Die Entwicklung vom Grundschulalter bis zur Adoleszenz
- Das Grundschulalter
- Veränderungen im körperlich-biologischen, emotionalen, kognitiven und sozialen Bereich
- Kinder mit einer geistigen Behinderung im Grundschulalter
- Pubertät und Adoleszenz
- Veränderungen im körperlich-biologischen, emotionalen, kognitiven und sozialen Bereich
- Die Pubertät bei Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung
- Der körperliche Bereich
- Der emotionale Bereich
- Der kognitive Bereich
- Der soziale Bereich
- Der sexuelle Bereich
- Zusammenfassung und Betrachtung der Konsequenzen für den pädagogischen Umgang mit behinderten Jugendlichen
- Das Grundschulalter
- Die Entwicklung der Wahrnehmung und Motorik
- Der interaktional-strukturale Erklärungsansatz nach PIAGET
- Wahrnehmung
- Motorische Entwicklung
- Ursachen motorischer Beeinträchtigungen
- Motorische Beeinträchtigungen bei geistiger Behinderung
- Motorik und Kommunikation
- Zur Bedeutung der Erziehung mit und durch Bewegung
- Sportliche Betätigungen
- Ein pädagogisches Leistungsverständnis
- Besondere Aspekte der Psychomotorik im Sportunterricht bei geistiger Behinderung
- Beispiele aus der Praxis
- Kontext des Praktikums
- Allgemeine Prinzipien unserer psychomotorischen Förderung
- Fördermittel und -ziele in der Sporthalle
- Das Medium „Ball”
- Förderdiagnostische Sequenzen und deren Auswertung
- Massage
- Fördermittel und -ziele im Schwimmbad
- Strukturierung der Psychomotorikstunden im Stadionbad
- Beschreibung praktischer Sequenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Bedeutung und den Zielen der Psychomotorik bei Jugendlichen mit geistiger Behinderung im Alter von 15-19 Jahren. Sie untersucht die Auswirkungen von psychomotorischer Förderung auf die körperliche, geistige und soziale Entwicklung dieser Jugendlichen und analysiert die spezifischen Bedürfnisse dieser Altersgruppe in Bezug auf Bewegung und Wahrnehmung.
- Die Bedeutung der Psychomotorik für die Entwicklung von Jugendlichen mit geistiger Behinderung
- Die Herausforderungen und Chancen der psychomotorischen Förderung in der Adoleszenz
- Die Relevanz von Bewegung, Wahrnehmung und sozialer Interaktion für das Wohlbefinden und die Selbstständigkeit von Jugendlichen mit geistiger Behinderung
- Die Entwicklung und Anwendung von Förderdiagnostik und Fördermaßnahmen im Kontext der psychomotorischen Förderung
- Die Einbindung von Sport und Spiel in den psychomotorischen Förderprozess
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und erläutert die Relevanz von Psychomotorik bei geistiger Behinderung, insbesondere im Hinblick auf die Bedürfnisse von Jugendlichen.
- Psychomotorik: Dieses Kapitel definiert den Begriff Psychomotorik und beleuchtet konzeptionelle Ansätze zur psychomotorischen Förderung. Es werden die Bedeutung und Ziele der Psychomotorik sowie deren Relevanz für verschiedene Zielgruppen, insbesondere für Menschen mit geistiger Behinderung, erläutert. Darüber hinaus werden Forschungsbefunde zu den Auswirkungen und der Effizienz psychomotorischer Förderung beleuchtet.
- Geistige Behinderung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von geistiger Behinderung, deren verschiedenen Ursachen und Kennzeichen. Es betrachtet die gesellschaftliche Situation von Menschen mit einer geistigen Behinderung und analysiert die Herausforderungen, die sie im Alltag meistern müssen.
- Die Entwicklung vom Grundschulalter bis zur Adoleszenz: Dieses Kapitel befasst sich mit den Entwicklungsphasen von Kindern und Jugendlichen, insbesondere den Veränderungen im körperlich-biologischen, emotionalen, kognitiven und sozialen Bereich. Es beleuchtet die besonderen Herausforderungen der Pubertät und Adoleszenz für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung und analysiert die Auswirkungen auf ihre Entwicklung.
- Die Entwicklung der Wahrnehmung und Motorik: Dieses Kapitel widmet sich der Entwicklung der Wahrnehmung und Motorik im Zusammenhang mit der geistigen Behinderung. Es beleuchtet den interaktional-strukturalen Erklärungsansatz nach Piaget und analysiert die Ursachen und Auswirkungen motorischer Beeinträchtigungen. Darüber hinaus werden die Bedeutung von Motorik und Kommunikation sowie die Bedeutung der Erziehung mit und durch Bewegung im Kontext der psychomotorischen Förderung betrachtet.
- Beispiele aus der Praxis: Dieses Kapitel präsentiert konkrete Beispiele aus dem Praktikum der Autorin und zeigt, wie psychomotorische Förderung in der Praxis umgesetzt werden kann. Es beschreibt Fördermittel und -ziele in der Sporthalle und im Schwimmbad und erläutert die Anwendung von Förderdiagnostik und Fördermaßnahmen im Detail.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Psychomotorik, geistige Behinderung, Adoleszenz, Entwicklung, Wahrnehmung, Motorik, Förderung, Diagnostik, Sport, Spiel und Inklusion. Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung und den Zielen der psychomotorischen Förderung von Jugendlichen mit geistiger Behinderung, beleuchtet die spezifischen Bedürfnisse dieser Altersgruppe und zeigt, wie Bewegung, Wahrnehmung und soziale Interaktion zu einem selbstständigen und erfüllten Leben beitragen können.
- Arbeit zitieren
- Kirsten Wetzel (Autor:in), 2000, Psychomotorik bei geistiger Behinderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207