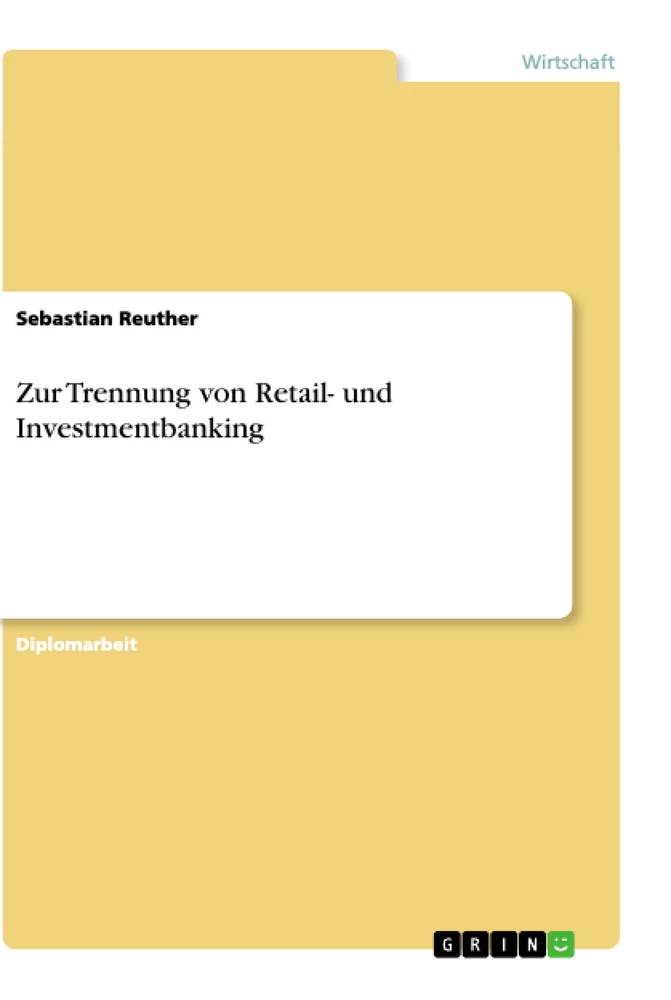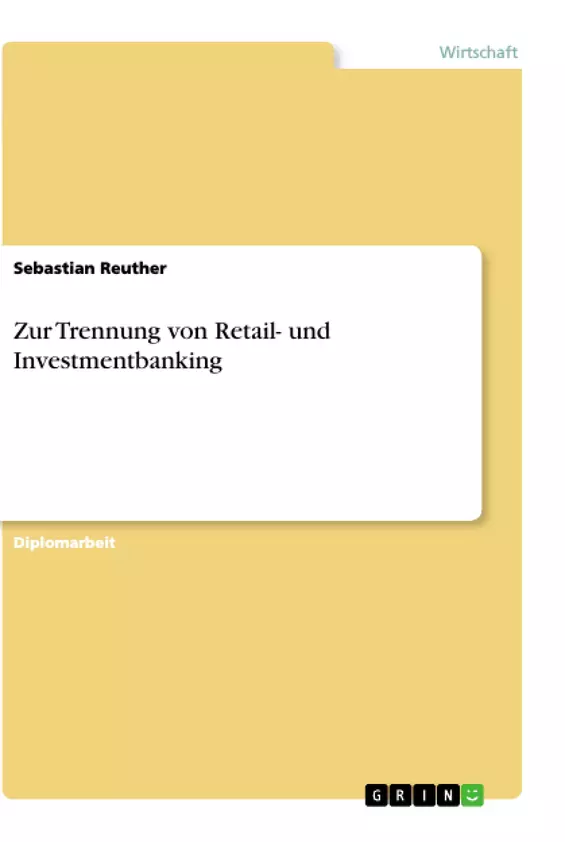Die vorliegende Arbeit untersucht die institutionelle Ausgestaltung von Bankensystemen. Mit Bezug auf die politische Diskussion, hinsichtlich der Trennung des klassischen Einlagen- und Kreditgeschäftes von den peripheren Geschäftsbereichen der Banken, wird versucht darzustellen, ob aus einer derartigen Trennung positive Effekte, hinsichtlich der Finanzmarktstabilität, abgeleitet werden können. Dazu werden zunächst die theoretischen Grundlagen erläutert, aus diesen Hypothesen formuliert und abschließend empirisch überprüft. Anhaltspunkte dafür, dass über eine gesetzliche Restriktion der Geschäftstätigkeit von Geschäftsbanken auf nationaler Ebene eine Stabilisierung oder Haftungsbeschränkung erreicht würde, konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht gefunden werden.
In Abschnitt 1 werden zunächst die notwendigen theoretischen Grundlagen erarbeitet. Der neoklassischen Effizienzmarkthypothese werden der Transaktionskostenansatz sowie der Prinzipal-Agent-Ansatz der Neuen Institutionenökonomik gegenübergestellt. Daran soll verdeutlicht werden, welche Bedeutung Banken allgemein unter der Annahme unvollkommener Märkte und unvollständiger Information zukommt. Ebenso wird gezeigt, wie aus der Interaktion der Marktakteure aufgrund von Informationsasymmetrie Negativanreize resultieren können, die Anomalien begünstigen und das Finanzsystem tendenziell destabilisieren.
Abschnitt 2 stellt, vor dem Hintergrund der im vorhergehenden Abschnitt gewonnenen Erkenntnisse über Finanzsysteme an sich, die möglichen Ausgestaltungsformen von Bank- und Finanzsystemen dar. Aus der theoretischen Konstruktion von Universal- und Trennbankensystemen werden abschließend Hypothesen formuliert, anhand deren Prüfung im weiteren Verlauf Erkenntnisse zur Beantwortung der Ausgangsfrage gewonnen werden sollen.
In Abschnitt 3 wird zunächst, in Form eines Exkurses, die internationale Finanzmarktarchitektur vorgestellt und die Eigenschaft der Finanzmarktstabilität als öffentliches Gut hervorgehoben. In Abschnitt 4 wird versucht, die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse anhand geeignet erscheinender Merkmale empirisch nachzuvollziehen. Dazu werden Länder gemäß ihrer jeweiligen Bankensysteme miteinander verglichen.
In Abschnitt 5 werden die zuvor formulierten Hypothesen überprüft, interpretiert und die Ergebnisse zusammengefasst. Zusätzlich erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit der Arbeit, in welcher Schwächen, Vorbehalte und alternative Herangehensweisen an die Thematik aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur volkswirtschaftlichen Bedeutung von Banken
- Neoklassischer Ansatz der Effizienzmarkthypothese
- Ansatz der Neuen Institutionenökonomik
- Transaktionskostenansatz
- Grundlagen der Prinzipal-Agent-Theorie
- Kapitalmärkte als markets for lemons
- Finanz- und Bankensysteme
- Finanzsysteme
- Bankensysteme
- Universalbankensystem
- Trennbankensystem
- Geschäftsfelder von Banken
- Formen der Unternehmensfinanzierung
- Modellierung der theoretischen Erkenntnisse
- Exkurs internationale Finanzmarktarchitektur
- Abgrenzung von Gütermärkten
- Krisen
- Finanzderivate
- Empirische Evidenz
- Zuordnung Bankensystem
- Indikatorenauswahl
- Ergebnis
- Überprüfen der Hypothesen
- Kritik und Vorbehalte
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Trennung von Investment- und Retailbanking. Sie analysiert die volkswirtschaftliche Bedeutung von Banken und untersucht die verschiedenen Ansätze zur Erklärung von Finanzmärkten und Bankensystemen. Die Arbeit beleuchtet die Problematik der Informationsasymmetrie und des Moral Hazards im Bankwesen und untersucht die Auswirkungen von verschiedenen Bankensystemen auf die Finanzmarktstabilität.
- Volkswirtschaftliche Bedeutung von Banken
- Informationsasymmetrie und Moral Hazard im Bankwesen
- Finanzmarktstabilität und Bankensysteme
- Universalbankensystem vs. Trennbankensystem
- Empirische Evidenz zur Trennung von Investment- und Retailbanking
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit dar und führt in die Thematik der Trennung von Investment- und Retailbanking ein. Kapitel 1 behandelt die volkswirtschaftliche Bedeutung von Banken und analysiert die Ansätze der Effizienzmarkthypothese und der Neuen Institutionenökonomik. Es wird auf die Problematik der Informationsasymmetrie und des Moral Hazards im Bankwesen eingegangen. Kapitel 2 betrachtet verschiedene Finanz- und Bankensysteme, die Geschäftsfelder von Banken und die Formen der Unternehmensfinanzierung. Die Arbeit modelliert die theoretischen Erkenntnisse und stellt Hypothesen auf. Kapitel 3 führt einen Exkurs in die internationale Finanzmarktarchitektur ein und beleuchtet die Herausforderungen der Finanzmarktstabilität. Kapitel 4 analysiert die empirische Evidenz zur Trennung von Investment- und Retailbanking, indem es verschiedene Indikatoren zur Bewertung der Finanzmarktstabilität einsetzt. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen, überprüft die aufgestellten Hypothesen und diskutiert Kritik und Vorbehalte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen wie Finanzmarktstabilität, Bankensysteme, Informationsasymmetrie, Moral Hazard, Universalbankensystem, Trennbankensystem, Effizienzmarkthypothese, Neue Institutionenökonomik, Transaktionskostenansatz, Prinzipal-Agent-Theorie und empirische Indikatoren zur Bewertung der Finanzmarktstabilität. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Trennung von Investment- und Retailbanking auf die Finanzmarktstabilität und die Rolle von Banken in der Volkswirtschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Universalbanken und Trennbanken?
Universalbanken bieten alle Finanzdienstleistungen unter einem Dach an, während Trennbankensysteme das Einlagengeschäft strikt vom Investmentbanking trennen.
Was versteht man unter "Moral Hazard" im Bankwesen?
Es beschreibt das Risiko, dass Banken riskante Geschäfte eingehen, weil sie darauf vertrauen, im Notfall vom Staat gerettet zu werden (Too big to fail).
Führt eine Trennung der Bankbereiche zu mehr Finanzmarktstabilität?
Die Arbeit zeigt, dass eine gesetzliche Trennung auf nationaler Ebene nicht zwingend zu einer höheren Stabilität führen muss, wie empirische Vergleiche belegen.
Welche Rolle spielt die Informationsasymmetrie?
Banken haben oft mehr Informationen über die Risiken ihrer Kredite als die Einleger oder der Markt, was zu Marktstörungen führen kann.
Was ist die neoklassische Effizienzmarkthypothese?
Sie geht davon aus, dass alle verfügbaren Informationen bereits in den Marktpreisen enthalten sind und Märkte daher stets effizient arbeiten.
- Quote paper
- Sebastian Reuther (Author), 2012, Zur Trennung von Retail- und Investmentbanking, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207072