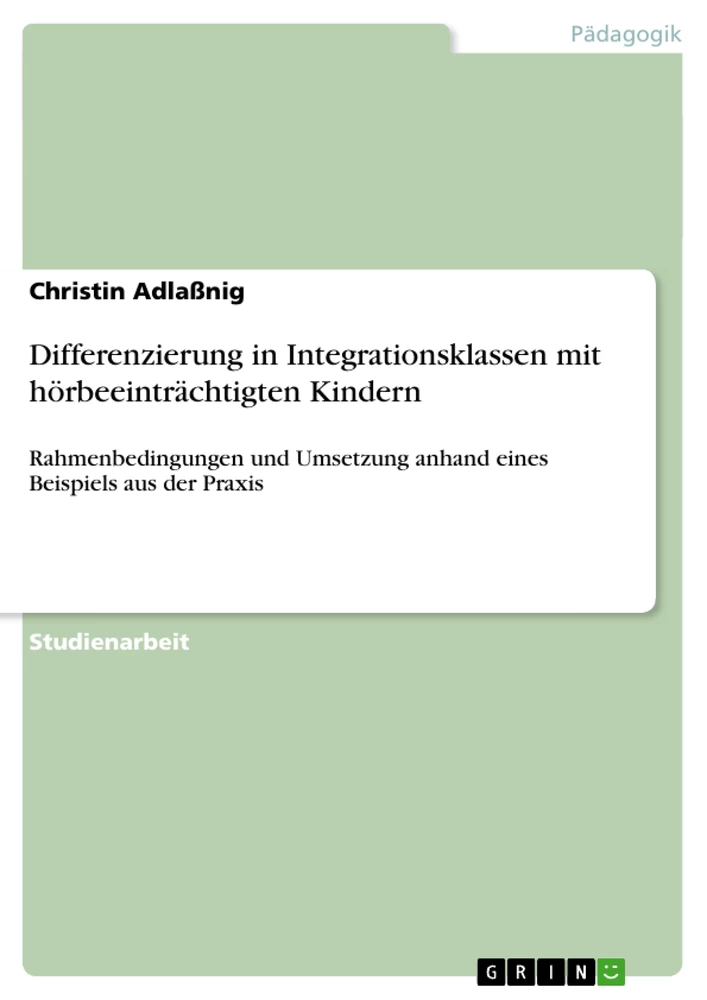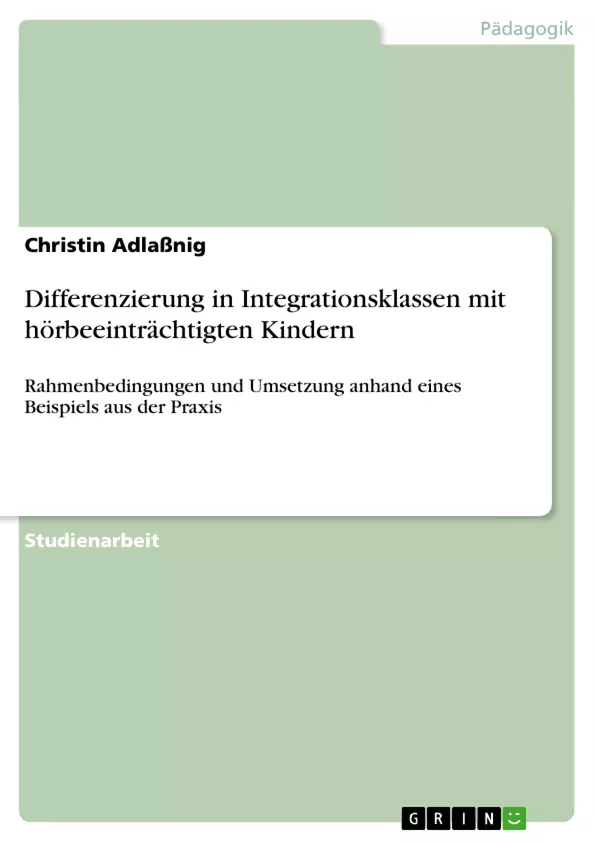Frontalunterricht und die Auffassung, dass es sich bei Schulklassen um homogene Einheiten von Lernenden mit in etwa gleichen Bedürfnissen und Voraussetzungen handelt, werden zusehends durch neuere Formen des offenen Unterrichts abgelöst, wobei die Lernprozesse der einzelnen Schüler/innen im Mittelpunkt der pädagogischen Betrachtungen stehen. Dies gilt im Besonderen für Integrationsklassen, in denen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelklassen gemeinsam mit nichtbehinderten Schülerinnen und Schülern unterrichtet werden.
Der theoretische Teil befasst sich mit den Rahmenbedingungen der Gehörlosenpädagogik. Dabei wird zunächst auf die historischen Dimensionen der Erziehung von Gehörgeschädigten, angefangen von deren ursprünglicher Ausschließung aus jeglichem Unterricht bis hin zur Segregation in eigenen Schulformen bzw. Institutionen bis hin zu dem modernen Diskurs über Integration und Inklusion im Regelschulwesen eingegangen.
Im Zusammenhang mit der gemeinsamen und inklusiven Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderungen, wie sie auch seit 1994 den Richtlinien der Vereinten Nationen entspricht, werden in dieser Arbeit vor allem Fragen, die sich aus einer differenzierten Betrachtungsweise von Schüler/innen ergeben, ausführlicher behandelt.
Inklusiver Unterricht, Differenzierung und Individualisierung gehen auch in Österreich einher mit kooperativem Lernen und der Koordination des Unterrichts durch ein sich ergänzendes Team von Lehrer/innen, dem sogenannten Teamteaching, das meist in Zweierteams erfolgt. Methoden des offenen Unterrichts und alternativ zum Ziffernnotensystem bestehende Formen der Leistungsbeurteilung unter Einbeziehung der Lernenden sind integrer Bestandteil des integrativen und differenzierenden Modells, das hier mit seinen wesentlichsten Merkmalen beschrieben wird.
Schließlich werden besondere Aspekte der Gehörlosenpädagogik unter Berück-sichtigung oralen, lautsprachlich orientierten und bilingualen Unterrichts erörtert.
Der praktische Teil in Abschnitt 7 soll an Hand des Faches Biologie und Umweltkunde demonstrieren, welche Möglichkeiten es zur Aufbereitung von Unterrichtsmaterialien im Rahmen eines offenen Stationentrainings mit Wahlmöglichkeiten gibt. Um diese Arbeit so praxisbezogen wie möglich zu gestalten, wurde eine Integrationsklasse „geschaffen“, die sich aus 24 Schüler/innen, davon 2 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und zwei gehörlose Kinder, zusammensetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der historische Rahmen der Hörbeeinträchtigtenpädagogik
- Fürsorge für Kranke und Behinderte in prähistorischer Zeit am Beispiel von mittelpaläolithischen Gesellschaftsformationen
- Behinderte im Vorderen Orient, in der Antike und im Mittelalter
- Die Anfänge der Behindertenpädagogik seit dem 16. Jahrhundert
- Gebärdensprache versus Oralismus - der Mailänder Kongress
- Gehörlosigkeit und Eugenik - von Graham Bell bis Hitler
- Die Gehörlosenpädagogik seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs am Beispiel der USA, Deutschlands und Österreichs
- Akzeptanz der Gebärdensprache
- Mehr Rechte für Behinderte, neue Unterrichtsmodelle
- Integrative Beschulungsmodelle für Beeinträchtigte
- Die Entstehung integrativer und inklusiver Unterrichtsformen
- Exkurs zum Begriff „Inklusion" - Definitionen
- Die derzeitige Situation von Integrationsklassen in Österreich
- Integrative Unterrichtsmodelle - Erklärung relevanter Begriffe
- Zum Thema sonderpädagogischer Förderbedarf (SPF)
- Zum Thema Teamteaching
- Zum Thema Integration
- Integrationsklasse
- Kooperative Klasse
- Klein- oder Förderklasse
- Stützlehrer/innen
- Zum Thema Kooperatives Lernen
- Zum Thema Wohlbefinden in der Schule
- Differenzierung und Individualisierung im Unterricht
- Was versteht man unter Differenzierung?
- Allgemeine Definitionen
- Äußere Differenzierung
- Innere Differenzierung
- Flexible Differenzierung
- Individualisierung
- Möglichkeiten der Umsetzung innerer Differenzierung in integrativen Schulklassen
- Grundformen des Unterrichts
- Qualitätskriterien für guten Unterricht
- Methoden der Unterrichtsgestaltung
- Freiarbeit
- Arbeit nach dem Wochenplan
- Stationenlernen (Lernzirkel)
- Sonstige Formen des differenzierenden Unterrichts
- Leistungsbewertung in einer differenzierenden Lernkultur
- Lernfortschrittsdokumentation (LFD) und Pensenbuch für die Grundschule
- Besondere Aspekte der Gehörlosenpädagogik
- Gebärdensprache und bilingualer Unterricht
- Gehörlosenpädagogik in der schulischen Realität
- Zusammenfassung
- Praxisteil: Stationenlernen am Beispiel des Themas „Unser Getreide“
- Arten von Materialien
- Rahmenbedingungen
- Beschreibungen der einzelnen Materialien
- Der Stationenplan
- Das BU - Buch: Schulstufe 7
- Die Karteikarten
- Die Arbeitsblätter: Der Hafer, der Roggen, der Weizen
- Klammerspiel: Lebensraum Acker
- Das Arbeitsblatt: „Getreide- ein wichtiges Nahrungsmittel“
- Das Arbeitsblatt: Das Getreide: „Versuche das richtige Wort zu finden,..."
- Das Arbeitsblatt: „Bei uns wachsen fünf Getreidesorten“
- Fladenbrot: Probiere das Rezept zu Hause aus
- Male das Bild an!
- Lege zu den beiden Abbildungen die richtigen Begriffe!
- Arbeite mit Hilfe des Internets!
- Plakate herstellen
- Lerne folgende Gebärden:
- Quiz im Internet...
- Beantworte die Fragen und baue das Puzzle zusammen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Gestaltung von Unterricht in Integrationsklassen, insbesondere mit dem Fokus auf hörbeeinträchtigte Kinder. Ziel ist es, den aktuellen Stand der Diskussion über inklusive Beschulungsmodelle zu beleuchten und die Herausforderungen der Differenzierung und Individualisierung im Unterricht zu analysieren. Dabei wird auf die Bedeutung von Kooperativem Lernen, Teamteaching und offenen Unterrichtsformen im Hinblick auf die Bedürfnisse aller Schüler/innen, inklusive derer mit sonderpädagogischem Förderbedarf, eingegangen.
- Historische Entwicklung der Gehörlosenpädagogik
- Integrative Beschulungsmodelle und Inklusion
- Differenzierung und Individualisierung im Unterricht
- Kooperatives Lernen und Teamteaching
- Besondere Aspekte der Gehörlosenpädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einem Überblick über die historische Entwicklung der Gehörlosenpädagogik, der die verschiedenen Phasen von Ausgrenzung, Segregation bis hin zu den modernen Ansätzen der Integration und Inklusion beleuchtet. Im Anschluss werden integrative Beschulungsmodelle und die derzeitige Situation von Integrationsklassen in Österreich näher betrachtet, wobei Begriffe wie sonderpädagogischer Förderbedarf (SPF), Teamteaching, Integrationsklassen, kooperative Klassen und Stützlehrer/innen erläutert werden.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Differenzierung und Individualisierung im Unterricht. Hier werden unterschiedliche Methoden der Unterrichtsgestaltung wie Freiarbeit, Arbeit nach dem Wochenplan und Stationenlernen vorgestellt. Die Arbeit diskutiert auch die Bedeutung von Lernfortschrittsdokumentation (LFD) und Pensenbuch für die Grundschule im Zusammenhang mit einer differenzierenden Lernkultur.
Im letzten Kapitel befasst sich die Arbeit mit besonderen Aspekten der Gehörlosenpädagogik, insbesondere mit der Bedeutung von Gebärdensprache und bilingualem Unterricht. Der praktische Teil der Arbeit demonstriert am Beispiel des Faches Biologie und Umweltkunde, wie Unterrichtsmaterialien im Rahmen eines offenen Stationentrainings mit Wahlmöglichkeiten aufbereitet werden können.
Schlüsselwörter
Gehörlosenpädagogik, Integration, Inklusion, Differenzierung, Individualisierung, kooperatives Lernen, Teamteaching, offener Unterricht, Stationenlernen, Gebärdensprache, bilingualer Unterricht, sonderpädagogischer Förderbedarf, Lernfortschrittsdokumentation.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Differenzierung in Integrationsklassen?
Differenzierung bedeutet, den Unterricht so zu gestalten, dass er den unterschiedlichen Bedürfnissen und Voraussetzungen aller Schüler gerecht wird, insbesondere bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.
Wie werden hörbeeinträchtigte Kinder integriert?
Die Integration erfolgt durch technische Hilfsmittel, Teamteaching (Regelschullehrer und Sonderschullehrer), Gebärdensprache sowie visuell aufbereitete Unterrichtsmaterialien.
Was ist Stationenlernen im Biologieunterricht?
Beim Stationenlernen (z. B. zum Thema Getreide) bearbeiten Schüler eigenständig verschiedene Aufgaben an Stationen. Dies ermöglicht individuelles Tempo und Wahlmöglichkeiten, was besonders inklusiv wirkt.
Welche Rolle spielt die Gebärdensprache im Unterricht?
In bilingualen Modellen wird Gebärdensprache als gleichwertige Sprache neben der Lautsprache genutzt, um den hörbeeinträchtigten Kindern den vollen Zugang zu Bildungsinhalten zu ermöglichen.
Was versteht man unter Teamteaching?
Teamteaching ist die Koordination des Unterrichts durch zwei Lehrkräfte, die sich ergänzen, um die individuelle Förderung in einer heterogenen Klasse sicherzustellen.
- Citation du texte
- Christin Adlaßnig (Auteur), 2012, Differenzierung in Integrationsklassen mit hörbeeinträchtigten Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207116