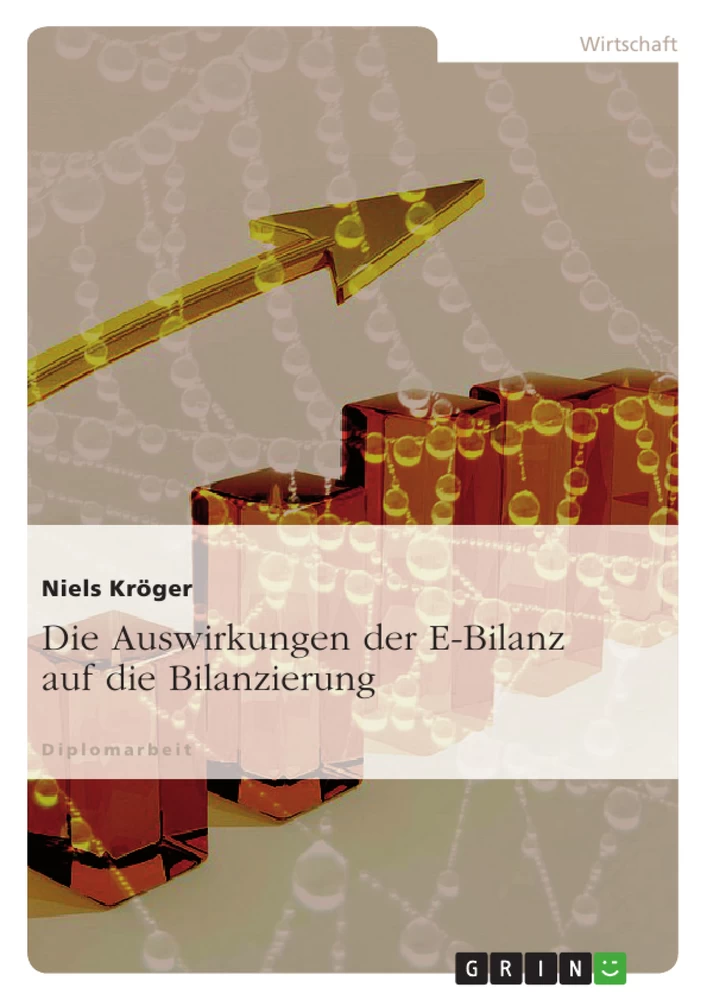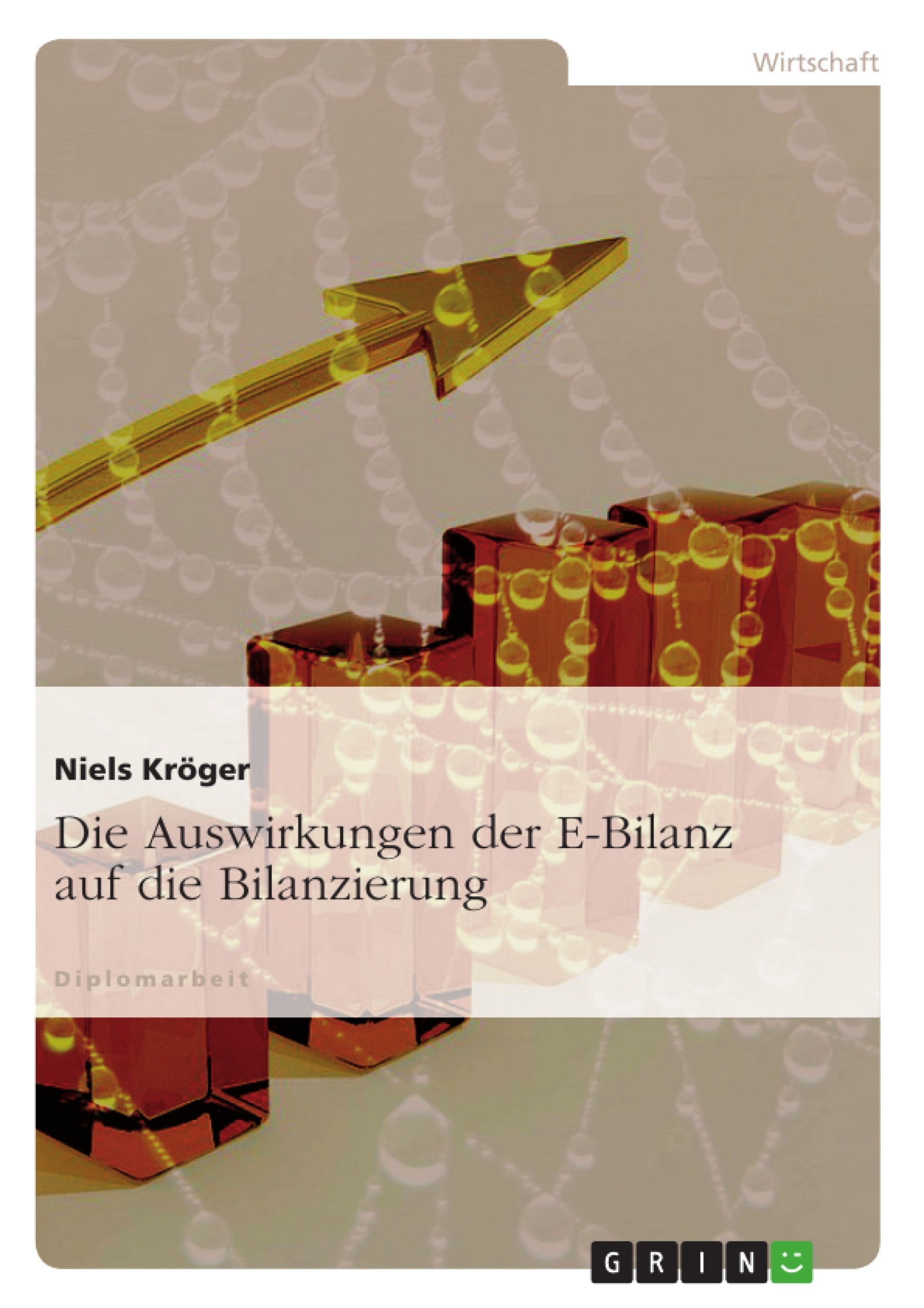Die Bilanzierungspraxis von deutschen Unternehmen unterlag in den letzten Jahrzehnten einem tiefgreifenden Wandel und es ist abzusehen, dass sich diese Entwicklung auch fortsetzen wird.
Wesentliche Auslöser für diese Entwicklungen waren und sind u. a. Harmonisierungsbestrebungen in der Europäischen Union (EU), die fortschreitende internationale Globalisierung von Wirtschaftsbeziehungen und die extremen Fortschritte in der Informationstechnologie mit deutlich sinkenden Kosten für die Verarbeitung, Speicherung und den Transport von Daten.
Die Harmonisierungsbestrebungen und die Globalisierung haben sowohl die EU als auch die nationalen Gesetzgeber veranlasst, die Transparenz und die Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen durch gesetzliche Regelungen zu fördern. Meilensteine dieser Entwicklung sind z. B. das Bilanzrichtliniengesetz und das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, die die Rechnungslegungsvorschriften im deutschen Handelsrecht ganz entscheidend geprägt haben.
Im deutschen Bilanzsteuerrecht fehlt eine vergleichbare Entwicklung und zum Teil wird von Experten die Ansicht vertreten, dass das Bilanzsteuerrecht aus dogmatischer Sicht nur als Torso angesehen werden kann. Neben dieser Entwicklung im Bilanzrecht hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten der Einsatz von modernen Informationstechnologien für die elektronische Kommunikation auf allen Ebenen massiv ausgeweitet. In fast allen Unternehmen ist es heute üblich mit Kunden, Mitarbeitern, Eigentümern oder mit der Öffentlichkeit im Allgemeinen elektronisch zu kommunizieren. Eigenständige Internet-Auftritte sind die Regel und elektronische Veröffentlichungen, z. B. von Geschäftsberichten oder Produktangeboten, aber auch die Mitarbeitersuche per Internet gehören zum Standardrepertoire der elektronischen Kommunikation.
Auch in der öffentlichen Verwaltung hat die elektronische Kommunikation seit langem Einzug gehalten. Aufgrund guter Erfahrungen mit dem Pilotprojekt BundOnline 2005 beschloss die Bundesregierung am 16. September 2006 das Programm E-Government 2.0 im Rahmen des Regierungsprogramms Zukunftsorientierte Verwaltung durch Innovation zu konkretisieren.
Von dem Programm E-Government 2.0 erwartet die Bundesregierung u. a. einen Abbau der Bürokratie, die Konsolidierung der Staatsfinanzen und die Handlungsfähigkeit des Staates durch eine innovative und effiziente Verwaltung zu verbessern.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Ziel der Arbeit
- 2 Bilanzierung und die gesetzlichen Grundlagen
- 2.1 Handelsrechtliche Bilanzierung.
- 2.1.1 Wichtige Entwicklungsstufen
- 2.1.1.1 Das Bilanzrichtliniengesetz
- 2.1.1.2 Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
- 2.1.2 Gesetzliche Grundlagen
- 2.1.2.1 Vorschriften für alle Kaufleute
- 2.1.2.2 Ergänzende Vorschriften für Kapitalgesellschaften
- 2.1.3 Ziele handelsrechtlicher Bilanzierungsvorschriften
- 2.1.4 Aussagekraft handelsrechtlicher Jahresabschlüsse
- 2.1.5 Bisherige Bilanzierungspraxis
- 2.2 Steuerrechtliche Bilanzierung..
- 2.2.1 Wichtige Entwicklungsstufen
- 2.2.2 Gesetzliche Grundlagen
- 2.2.3 Ziele steuerrechtlicher Bilanzierung..
- 2.2.4 Aussagekraft steuerrechtlicher Jahresabschlüsse
- 2.2.5 Bisherige Bilanzierungspraxis.
- 3 Die E-Bilanz als neue Steuerbilanz
- 3.1 Ziele
- 3.2 Gesetzliche Grundlagen__
- 3.2.1 Steuerbürokratieabbaugesetz
- 3.2.2 Einkommensteuergesetz
- 3.2.3 Einkommensteuerdurchführungsverordnung………………………
- 3.2.4 Abgabenordnung..
- 3.2.5 Steuerdaten-Übermittlungs-und Abrufverordnung...............
- 3.3 Persönlicher Anwendungsbereich
- 3.4 Sachlicher Anwendungsbereich
- 3.5 Zeitlicher Anwendungsbereich
- 3.6 Inhalt und Form
- 3.6.1 Datenformat der elektronischen Übermittlung….
- 3.6.2 Taxonomie als Ordnungsprinzip.
- 3.6.2.1 Kerntaxonomie
- 3.6.2.2 Branchentaxonomie
- 3.6.3 Wesentliche Bestandteile der Kerntaxonomie
- 3.6.3.1 Stammdatenmodul
- 3.6.3.2 Das Jahresabschlussmodul
- 3.6.4 Datenaufbau des Jahresabschlussmoduls
- 3.6.4.1 Mussfelder_
- 3.6.4.2 NIL-Werte
- 3.6.4.3 Auffangpositionen.
- 3.6.4.4 Datenübermittlung
- 3.6.5 Formen der Übermittlung...
- 4 Wesentliche Unterschiede zur bisherigen Steuerbilanz
- 4.1 Umfang der einzureichenden Unterlagen
- 4.2 Verschärfung von Berichtspflichten
- 4.3 Detailierungsgrad der zu übermittelnden Daten
- 4.3.1 Vergleich E-Bilanz zu HGB-Bilanz.
- 4.3.2 Vergleich E-GuV zu HGB-GuV
- 4.3.3 Vergleich beispielhafter Einzelpositionen
- 4.3.3.1 Umsatzerlöse
- 4.3.3.2 Sonstige Betriebliche Erträge
- 4.3.3.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen
- 5 Voraussichtliche Folgen der E-Bilanzierung.
- 5.1 Verhältnis Handelsbilanz zu E-Bilanz
- 5.2 Bilanzierungsprozess beim Steuerpflichtigen
- 5.2.1 Generelle Einflussfaktoren
- 5.2.2 Wahl der Übermittlungsform
- 5.2.3 Festlegen des Übermittlungsumfangs.
- 5.2.4 Organisation des Rechnungswesens
- 5.2.4.1 Umstellung des Kontenplans.
- 5.2.4.2 Taxonomiekonforme Buchungspraxis
- 5.2.4.3 Umstellung von EDV-Systemen_
- 5.2.4.4 Übernahme der Buchhaltungsdaten
- 5.2.5 Kosten der Umstellung..
- 5.2.5.1 Einmalige Kosten
- 5.2.5.2 Wiederkehrende Kosten
- 5.2.6 Langfristige Vorteile
- 6 Fazit
- 7 Anhang.
- 7.1 Bilanzaufbau gem. Kerntaxonomie im Vergleich zum HGB
- 7.2 GuV-Aufbau gem. Kerntaxonomie im Vergleich zum HGB
- 8 Literaturverzeichnis
- 8.1 Monographien
- 8.2 Zeitschriftenaufsätze
- 9 Verwaltungsanweisungsverzeichnis
- 10 Quellenverzeichnis.
- 11 Internetquellenverzeichnis.
- Einführung und rechtliche Rahmenbedingungen der E-Bilanz
- Inhaltliche und formale Anforderungen der E-Bilanz
- Vergleich der E-Bilanz mit der bisherigen Steuerbilanz
- Auswirkungen der E-Bilanz auf den Bilanzierungsprozess
- Notwendige Anpassungen im Rechnungswesen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit den Auswirkungen der E-Bilanz auf die Bilanzierung. Sie untersucht die neuen Anforderungen und Herausforderungen, die sich durch die Einführung der elektronischen Steuerbilanz für Unternehmen ergeben. Die Arbeit analysiert die gesetzlichen Grundlagen, die Inhalte und Formate der E-Bilanz sowie die Unterschiede zur bisherigen Steuerbilanz. Darüber hinaus werden die voraussichtlichen Folgen für den Bilanzierungsprozess sowie die notwendigen Anpassungen im Rechnungswesen beleuchtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen der Handels- und Steuerbilanzierung. Es werden die wichtigsten Entwicklungsstufen, die geltenden Vorschriften und die Ziele der Bilanzierung erläutert. Darüber hinaus wird die Aussagekraft handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Jahresabschlüsse sowie die bisherige Bilanzierungspraxis beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich der E-Bilanz als neue Steuerbilanz. Es werden die Ziele, die gesetzlichen Grundlagen, der Anwendungsbereich und die Inhalte und Formate der E-Bilanz beschrieben. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Taxonomie als Ordnungsprinzip für die elektronische Übermittlung der Bilanzdaten.
Kapitel 4 untersucht die wesentlichen Unterschiede zwischen der E-Bilanz und der bisherigen Steuerbilanz. Es werden die Unterschiede im Umfang der einzureichenden Unterlagen, in der Verschärfung von Berichtspflichten und im Detailierungsgrad der zu übermittelnden Daten analysiert. Die Analyse umfasst einen Vergleich der E-Bilanz und E-GuV mit den entsprechenden HGB-Abschlüssen sowie einen detaillierten Vergleich beispielhafter Einzelpositionen.
Kapitel 5 befasst sich mit den voraussichtlichen Folgen der E-Bilanzierung. Es werden die Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Handelsbilanz und E-Bilanz sowie auf den Bilanzierungsprozess beim Steuerpflichtigen untersucht. Die Analyse umfasst die generellen Einflussfaktoren, die Wahl der Übermittlungsform, die Festlegung des Übermittlungsumfangs und die Organisation des Rechnungswesens.
Schlüsselwörter
E-Bilanz, Steuerbilanz, Handelsbilanz, Bilanzierung, Jahresabschluss, Taxonomie, Steuerbürokratieabbaugesetz, Einkommensteuergesetz, Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, HGB, EDV-Systeme, Rechnungswesen, Kosten, Vorteile.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die wesentlichen Ziele der Einführung der E-Bilanz?
Die Hauptziele sind der Abbau von Bürokratie, die Konsolidierung der Staatsfinanzen und die Steigerung der Verwaltungseffizienz durch elektronische Datenübermittlung.
Was versteht man unter der "Taxonomie" im Kontext der E-Bilanz?
Die Taxonomie ist das Ordnungsprinzip für die elektronische Übermittlung, unterteilt in Kerntaxonomie und Branchentaxonomie, die festlegt, wie Datenfelder strukturiert sein müssen.
Wie unterscheidet sich die E-Bilanz von der bisherigen Steuerbilanz?
Es gibt einen deutlich höheren Detaillierungsgrad der zu übermittelnden Daten, verschärfte Berichtspflichten und einen größeren Umfang an Pflichtfeldern (Mussfelder).
Welche Anpassungen müssen Unternehmen im Rechnungswesen vornehmen?
Unternehmen müssen ihren Kontenplan umstellen, eine taxonomieskonforme Buchungspraxis einführen und ihre EDV-Systeme technisch anpassen.
Welche Gesetze bilden die Grundlage für die E-Bilanz?
Wichtige Grundlagen sind das Steuerbürokratieabbaugesetz, das Einkommensteuergesetz (EStG) und die Abgabenordnung (AO).
- Citation du texte
- Niels Kröger (Auteur), 2012, Die Auswirkungen der E-Bilanz auf die Bilanzierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207180