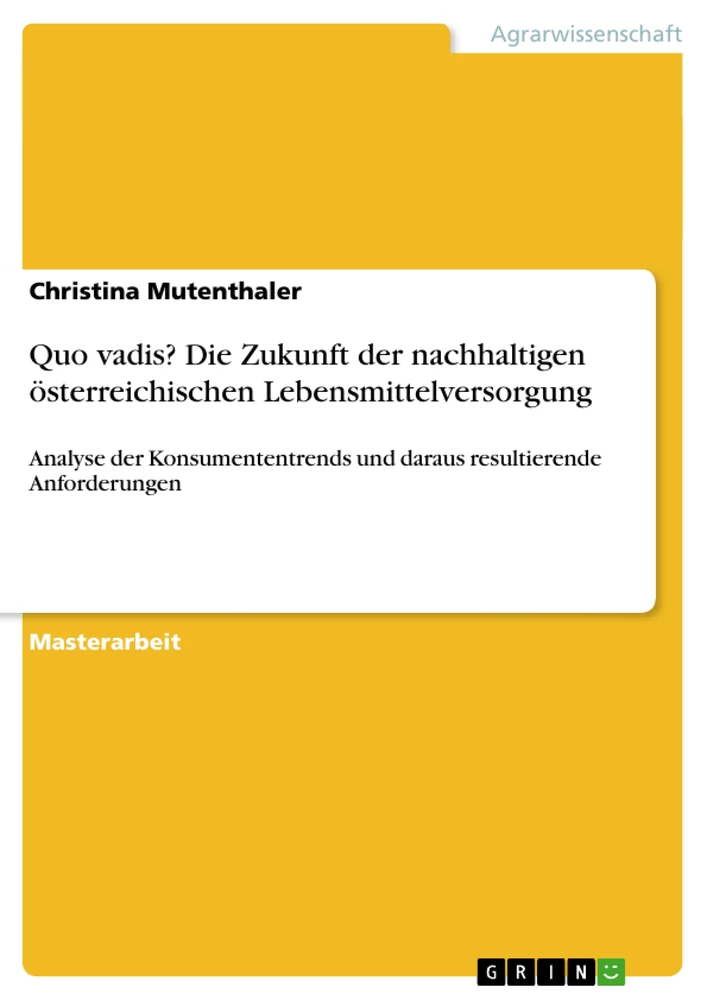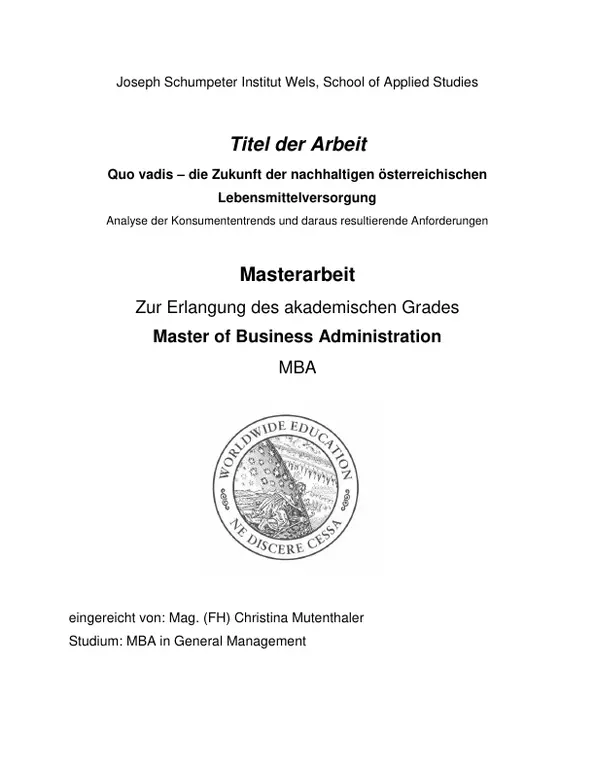Die Lebensmittelbranche hat in den letzten Jahrzehnten einen erheblichen Wandel durchlaufen. Dieser Wandel wird auch zukünftig stattfinden, da Trends, gesellschaftliche Entwicklungen und politische Rahmenbedingungen diese Branche entscheidend beeinflussen. Ziel dieser Arbeit war es Zukunftsperspektiven für die Lebensmittelversorgung zu entwickeln und entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Auf Basis eines Literaturstudiums wurde das Konsumentenverhalten im Detail erläutert und ein Überblick über den Status Quo der Lebensmittelbranche gegeben. Der empirische Teil dieser Arbeit gliederte sich in Sekundär- sowie in Primärforschung. Im Rahmen der Sekundärforschung wurden Studien, Berichte sowie Bücher gesichtet und die wichtigsten Entwicklungen der Lebensmittelbranche erörtert. Interessant war die Erkenntnis, dass sich viele Trends oftmals gegenseitig beeinflussen und meist aus den soziodemographischen Entwicklungen entstehen. Mittels Experteninterviews wurde ein Gesamtbild der zukünftigen Lebensmittelversorgung skizziert und Szenarien abgeleitet. Abschließend wurden die umfangreichen Status quo- und Trend-Analysen mit den Erkenntnissen aus den Interviews sowie den praktischen Erfahrungen des Autors kombiniert und strategische Empfehlungen für Politik, NGOs und Wirtschaft gegeben. Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die Lebensmittelversorgung Österreichs rasch auf Trends und Anforderungen reagieren kann; es müssen jedoch entsprechende gesellschafts- und agrarpolitische Maßnahmen gesetzt und Konsumententrends wie Gesundheit, Convenience oder Regionalität verstärkt aufgegriffen werden. Es bedarf u.a. Maßnahmen zur Änderung unserer Ernährungsgewohnheiten, spezielle Programme für Kinder, verpflichtende Vorgaben hinsichtlich regionaler, saisonaler und gesunder Mahlzeiten in Gemeinschaftsverpflegungen, nachvollziehbarere Herkunftsbezeichnungen sowie einer gesteigerten Wertschätzung gegenüber den Lebensmitteln. Aus Sicht der Betriebe sollte verstärkt Augenmerk auf Innovationen und Kooperationen gelegt werden. Weiters muss die Politik erfolgreiche GAP-Verhandlungen führen und eine klimafreundliche Produktion fördern. Alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette (Politik, Landwirtschaft, Verarbeitung, Handel, Gastronomie, Endkonsumenten) sind aufgefordert sich an den Maßnahmen zu beteiligen um eine nachhaltige Lebensmittelversorgung sicherstellen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1.1 Problemstellung der Arbeit
- 1.2 Zielsetzung der Arbeit
- 1.3 Aufbau und Methodik der Arbeit
- 1.4 Begriffserklärungen
- KONSUMENTENVERHALTEN
- 2.1 Begriffsdefinitionen
- 2.2 Konsumentenverhalten als Modell
- 2.3 Einflussfaktoren auf das Konsumentenverhalten
- 2.3.1 Kulturelle Faktoren
- 2.3.1.1 Kulturkreis
- 2.3.1.2 Subkultur
- 2.3.1.3 Soziale Schicht
- 2.3.2 Soziale Faktoren
- 2.3.2.1 Bezugsgruppen
- 2.3.2.2 Familie
- 2.3.2.3 Rollen und Status
- 2.3.3 Persönliche Faktoren
- 2.3.3.1 Alter und Lebensabschnitt
- 2.3.3.2 Beruf
- 2.3.3.3 Wirtschaftliche Verhältnisse
- 2.3.3.4 Persönlichkeit und Selbstbild
- 2.3.3.5 Lebensstil
- 2.3.4 Psychologische Faktoren
- 2.3.4.1 Emotionen
- 2.3.4.2 Motivation
- 2.3.4.3 Einstellungen
- 2.3.4.4 Wahrnehmung
- 2.3.4.5 Lernen
- 2.4 Kaufentscheidungsprozess
- 2.4.1 Problemerkennung
- 2.4.2 Informationssuche
- 2.4.3 Bewertung der Alternativen
- 2.4.4 Kaufentscheidung
- 2.4.5 Verhalten nach dem Kauf
- 2.5 Käuferrollen
- 2.6 Arten der Kaufentscheidung
- STATUS QUO DER LEBENSMITTELWIRTSCHAFT IN ÖSTERREICH
- 3.1 Stufen der Wertschöpfungskette
- 3.1.1 Landwirtschaft in Österreich
- 3.1.1.1 Agrarstruktur
- 3.1.1.2 Landwirtschaftliche Produktion
- 3.1.2 Lebensmittelherstellung und -verarbeitung in Österreich
- 3.1.2.1 Lebensmittelgewerbe
- 3.1.2.2 Lebensmittelindustrie
- 3.1.3 Lebensmittelvermarktung in Österreich
- 3.1.3.1 Direktvertrieb von Lebensmittel
- 3.1.3.2 Lebensmitteleinzelhandel
- 3.1.3.3 Lebensmittelgroßhandel
- 3.1.3.4 Außer-Haus-Verzehr
- 3.1.3.5 Lebensmittelaußenhandel
- 3.2 Lebensmittelpolitik - das österreichische Lebensmittelmodell
- 3.2.1 Lebensmittelrecht und -kontrollsysteme
- 3.2.1.1 Gesetzliche Grundlagen
- 3.2.1.2 Lebensmittelkontrollen
- 3.2.1.3 Qualitätsmanagementsysteme
- 3.2.2 Kennzeichnungs- und Zertifizierungssysteme im Überblick
- 3.2.3 Biologische Landwirtschaft
- EMPIRISCHER TEIL – FORSCHUNGSDESIGN
- 4.1 Sekundärforschung – Analyse bestehender Daten und Studien
- 4.2 Primärforschung – Durchführung von Experteninterviews
- 4.2.1 Art und Ablauf der Erhebung
- 4.2.2 Gestaltung und Struktur des Leitfadens
- 4.2.3 Datenaufbereitung und -analyse
- TRENDS UND ENTWICKLUNGEN IN DER LEBENSMITTELWIRTSCHAFT
- 5.1 Soziodemographische Entwicklungen
- 5.1.1 Bevölkerungsentwicklung - demographischer Wandel
- 5.1.2 Familien- und Haushaltsstruktur - neue Familien und Single-Haushalte
- 5.1.3 Einkommens- und Kaufkraftstruktur - weitere Polarisierung
- 5.1.4 Strukturelle geografische Entwicklungen – Verstädterung
- 5.1.5 Multikulturelle (Konsum-)Gesellschaft - Migrationsentwicklung
- 5.1.6 Steigendes Ausbildungsniveau – Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft
- 5.1.7 Steigende Erwerbstätigkeit der Frau – Frauenpower
- 5.1.8 Dynamische Arbeitswelt – flexible Arbeitszeiten und mehr Freizeit
- 5.2 Psychographische Entwicklungen
- 5.2.1 Wertewandel – Änderung der Normen und Verhaltensweisen
- 5.2.2 Best Agers - die wohlhabenden Gereiften
- 5.2.3 Frauenpower - die Zukunft ist weiblich
- 5.2.4 Internet - der zweite Wirklichkeitsfaktor und technologischer Fortschritt
- 5.2.5 Individualisierung - Pluralisierung
- 5.2.6 Gesundheit & Wellness & Self-Design – Zivilisationskrankheiten
- 5.2.7 Globalisierung – Internationalisierung
- 5.2.8 Entschleunigung – Streben nach Vereinfachung
- 5.2.9 Erlebnisse, Action - Abwechslung
- 5.3 Trends und Entwicklungen im Lebensmittelkonsumverhalten
- 5.3.1 Allgemeine Ernährungsgewohnheiten der Österreicher
- 5.3.1.1 Stellenwert des Essens
- 5.3.1.2 Speisepräferenzen
- 5.3.1.3 Kochgewohnheiten
- 5.3.1.4 Lebensmitteleinkauf - Einkaufsverhalten
- 5.3.1.5 Wichtigkeit von Produkteigenschaften - Kaufentscheidungsgründe
- 5.3.1.6 Zunahme des Außer-Haus-Konsums
- 5.3.2 Preissensibilität der Österreicher hinsichtlich Lebensmittel
- 5.3.3 Biologische Lebensmittel
- 5.3.4 Regionalität & Saisonalität
- 5.3.5 Food Trends
- 5.3.5.1 Convenience Food
- 5.3.5.2 Health Food
- 5.3.5.3 Functional Food
- 5.3.5.4 Ethic Food
- 5.3.5.5 Authentic Food
- 5.3.5.6 Sensual Food
- 5.3.5.7 Pure Food
- 5.4 Generelle Herausforderungen für die Lebensmittelwirtschaft
- 5.4.1 Klimawandel & Naturkatastrophen
- 5.4.2 Nahrungsmittelkrise & Hungersnot
- 5.4.3 Ressourcenknappheit & Energie & Biodiversität
- 5.4.4 Forschung & Entwicklung
- 5.4.5 Künftige Ausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
- HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN UND MAẞNAHMEN ZUR SICHERUNG EINER NACHHALTIGEN LEBENSMITTELVERSORGUNG ÖSTERREICHS
- 6.1 Maßnahmen für Politik und NGOs
- 6.2 Maßnahmen für die Wirtschaft und einzelne Angebotsträger
- Analyse des Konsumentenverhaltens im Bereich der Lebensmittel
- Bedeutung von Nachhaltigkeit und ethischen Aspekten im Konsum
- Identifizierung relevanter Trends und Entwicklungen in der Lebensmittelwirtschaft
- Bewertung der Herausforderungen für die nachhaltige Lebensmittelversorgung
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Politik, Wirtschaft und Konsumenten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Zukunft der nachhaltigen österreichischen Lebensmittelversorgung, wobei der Fokus auf die Konsumententrends und deren Einfluss auf die Anforderungen an die Lebensmittelwirtschaft gelegt wird. Die Arbeit untersucht den demographischen und psychographischen Wandel in Österreich und dessen Auswirkungen auf das Konsumverhalten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die Problemstellung der Arbeit, die Zielsetzung, der Aufbau und die Methodik sowie wichtige Begriffserklärungen erläutert werden. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Konsumentenverhalten im Allgemeinen, wobei die Begriffsdefinitionen, ein Modell des Konsumentenverhaltens sowie die wichtigsten Einflussfaktoren auf das Kaufverhalten vorgestellt werden. In Kapitel drei wird der Status quo der Lebensmittelwirtschaft in Österreich beleuchtet. Dabei werden die verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette, die Lebensmittelpolitik und wichtige Kennzeichnungssysteme sowie die biologische Landwirtschaft detailliert dargestellt.
Der empirische Teil der Arbeit befasst sich mit dem Forschungsdesign. Hier werden die Methoden der Sekundärforschung und der Primärforschung, insbesondere die Durchführung von Experteninterviews, erläutert. Kapitel fünf widmet sich den aktuellen Trends und Entwicklungen in der Lebensmittelwirtschaft, wobei sowohl soziodemographische als auch psychographische Entwicklungen und deren Einfluss auf das Lebensmittelkonsumverhalten analysiert werden.
Schlüsselwörter
Nachhaltige Lebensmittelversorgung, Konsumententrends, Lebensmittelwirtschaft, Österreich, Demographischer Wandel, Psychographische Entwicklungen, Konsumverhalten, Nachhaltigkeit, Biologische Landwirtschaft, Lebensmittelpolitik, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Trends beeinflussen die Lebensmittelversorgung in Österreich?
Zentrale Trends sind Gesundheit, Convenience, Regionalität, Saisonalität sowie biologische Landwirtschaft.
Welche soziodemographischen Entwicklungen spielen eine Rolle?
Der demographische Wandel, die Zunahme von Single-Haushalten, steigende Erwerbstätigkeit von Frauen und die Verstädterung beeinflussen das Konsumverhalten.
Welche Maßnahmen werden für die Politik empfohlen?
Empfohlen werden unter anderem verpflichtende regionale Mahlzeiten in Gemeinschaftsverpflegungen, bessere Herkunftsbezeichnungen und die Förderung klimafreundlicher Produktion (GAP).
Was sind „Best Agers“ im Kontext des Lebensmittelkonsums?
Es handelt sich um die kaufkräftige Gruppe der wohlhabenden Älteren, die spezifische Anforderungen an Qualität und Gesundheit stellen.
Wie reagiert die österreichische Landwirtschaft auf den Wandel?
Die Landwirtschaft muss verstärkt auf Innovationen, Kooperationen und Nachhaltigkeitszertifizierungen setzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
- Quote paper
- Christina Mutenthaler (Author), 2012, Quo vadis? Die Zukunft der nachhaltigen österreichischen Lebensmittelversorgung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207288