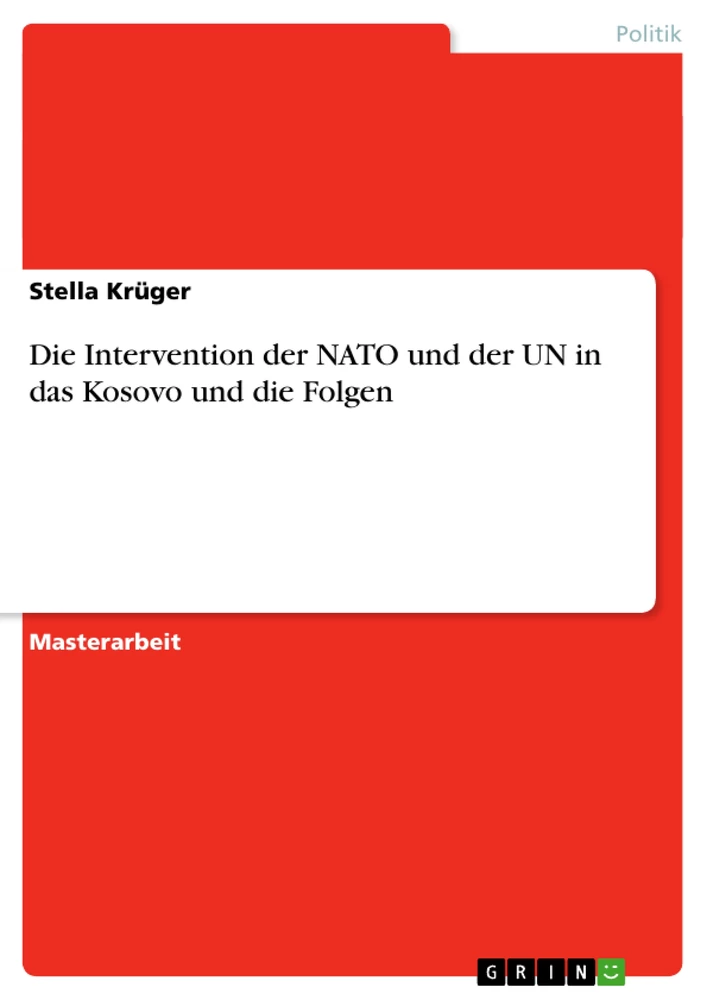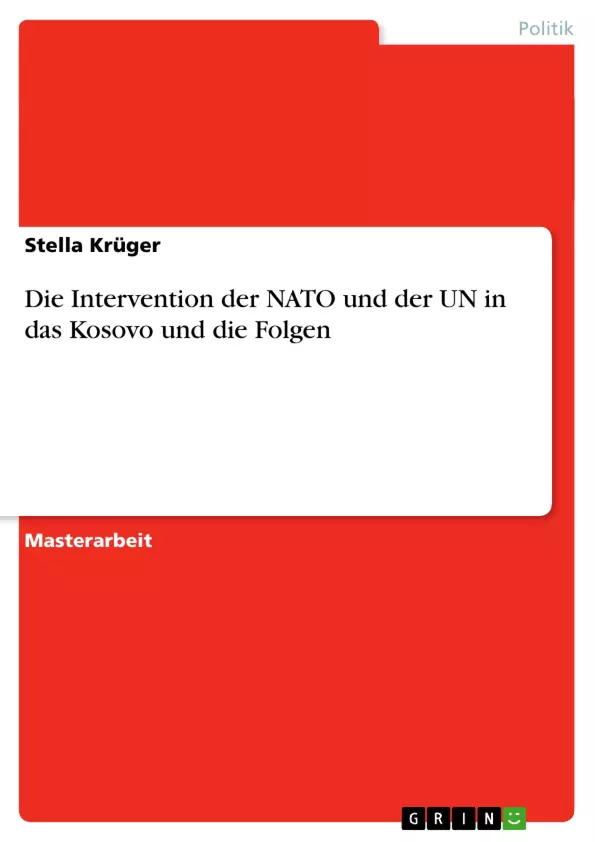Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der militärischen Intervention der NATO in das Kosovo, dem darauffolgenden Eingreifen der UN in der Post-Konflikt-Phase und den Folgen dieses internationalen Engagements.
Im März 1999 erfolgte die Intervention der NATO in das Kosovo. Grund für die Intervention waren die massiven Menschenrechtsverletzungen im Kosovo als Folge der gewaltsamen Auseinandersetzungen der serbischen Streitkräfte mit albanischen paramilitärischen Einheiten, vor allem der „Befreiungsarmee des Kosovo“ (UÇK). Der ethnische Konflikt zwischen Serben und Albanern in der Region Kosovo hatte sich bereits zu Beginn der 1990er Jahren angedeutet. Doch erst mit zunehmender Gewaltanwendung und Leid der Bevölkerung rückte das Kosovo in den internationalen Fokus. Das Eingreifen der Internationalen Gemeinschaft in das Kosovo unterscheidet sich dabei im Wesentlichen von dem Umgang mit anderen innerstaatlichen Konflikten, die seit Ende der Ost-West-Konfrontation zunehmend eskalieren. Die militärische Intervention der NATO in das Kosovo war die erste „humanitäre Intervention“, die ohne ein Mandat des UN-Sicherheitsrates erfolgte und somit gegen das Völkerrecht verstößt. Zudem unterschied sich die Form militärischen Eingreifens deutlich von vorangegangenen „humanitären Interventionen“ der UN, wie in Bosnien-Herzegowina und Somalia zu Beginn der 1990er Jahre. Die NATO führte die Intervention ausschließlich aus der Luft durch. Eine weitere Besonderheit ist die bis dato einzigartige Bandbreite an Post-Konflikt-Maßnahmen, die nach offizieller Beendigung der Kampfhandlungen im Juni 1999 durch die UN-Resolution 1244 eingeleitet wurden und die über bisherige Peacebuilding-Maßnahmen weit hinausgehen.
In dieser Arbeit geht es darum, explorativ einen Kriterienkatalog zu erstellen, anhand dessen der Erfolg der Maßnahmen im Kosovo hinsichtlich einer grundlegenden Sicherheit bewertet werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Der Sicherheitsbegriff: Sicherheit und militärische Intervention
- Wandel des Sicherheitsverständnisses
- Abgrenzung der sicherheitspolitischen von der friedenstheoretischen und entwicklungspolitischen Debatte
- Der „erweiterte Sicherheitsbegriff“
- ,,Human Security“
- Die militärische Intervention
- Der „,klassische Interventionsbegriff“
- Die,,humanitäre Intervention“
- ,,Responsibility to Protect“
- „Responsibility to React“
- ,,Responsibility to Rebuild“
- Zusammenfassung und Festlegung des Kriterienkataloges
- Die Intervention in das Kosovo und die Folgen
- Die historische Entwicklung des Kosovo-Konfliktes
- Die militärische Intervention der NATO in das Kosovo
- Berechtigter Anlass
- Rechtmäßigkeit der Absicht
- Rechtmäßige Autorität
- Nachvollziehbare Erfolgsaussichten
- Die militärische Intervention als Ultima-Ratio
- Verhältnismäßigkeit der Mittel
- Berücksichtigung einer „Responsibility to Rebuild“
- Kurze Zusammenfassung
- Die Sicherheitslage in der Post-Konflikt-Situation
- Grundlegende Sicherheit
- Schutz von Minderheiten
- Reform des Sicherheitssektors
- Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration
- Beseitigung von Minen
- Die Verurteilung von Kriegsverbrechern
- Weitere Problemfelder und die aktuelle Situation im Kosovo
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der militärischen Intervention der NATO im Kosovo und den Folgen des internationalen Engagements in der Post-Konflikt-Phase. Sie untersucht die Rechtmäßigkeit und die Folgen der NATO-Intervention sowie die Auswirkungen der durchgeführten Post-Konflikt-Maßnahmen.
- Der Wandel des Sicherheitsverständnisses im Kontext der Intervention
- Die Rechtfertigung der NATO-Intervention im Kosovo
- Die Auswirkungen der NATO-Intervention auf die Sicherheitslage im Kosovo
- Die Rolle der internationalen Gemeinschaft in der Post-Konflikt-Phase
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten für eine nachhaltige Friedenskonsolidierung im Kosovo
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel führt in das Thema ein und stellt den Sicherheitsbegriff sowie den Wandel des Sicherheitsverständnisses im Kontext von militärischen Interventionen dar.
- Das zweite Kapitel untersucht die verschiedenen Formen der militärischen Intervention, darunter der „klassische Interventionsbegriff“, die „humanitäre Intervention“ und das Konzept der „Responsibility to Protect“.
- Das dritte Kapitel analysiert die historische Entwicklung des Kosovo-Konfliktes, die NATO-Intervention und die darauf folgenden Post-Konflikt-Maßnahmen.
- Das vierte Kapitel behandelt die Sicherheitslage im Kosovo nach der Intervention, einschließlich der Herausforderungen für die Grundlegende Sicherheit und der Problemfelder in der aktuellen Situation.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselwörtern: Kosovo-Konflikt, NATO-Intervention, Humanitäre Intervention, Responsibility to Protect, Post-Konflikt-Situation, Sicherheitslage, Friedenskonsolidierung, Völkerrecht, Menschenrechte, ethnischer Konflikt.
Häufig gestellte Fragen
Warum intervenierte die NATO 1999 im Kosovo?
Grund waren massive Menschenrechtsverletzungen infolge des Konflikts zwischen serbischen Streitkräften und albanischen paramilitärischen Einheiten (UÇK).
War die NATO-Intervention völkerrechtlich legal?
Die Intervention erfolgte ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates und verstieß somit formal gegen das geltende Völkerrecht.
Was bedeutet der Begriff 'Responsibility to Protect'?
Es ist ein Konzept, das die internationale Gemeinschaft verpflichtet einzugreifen, wenn ein Staat seine Bevölkerung nicht vor schweren Verbrechen schützen kann oder will.
Welche Rolle spielte die UN nach den Kampfhandlungen?
Die UN-Resolution 1244 leitete umfangreiche Post-Konflikt-Maßnahmen ein, die weit über klassisches Peacebuilding hinausgingen.
Was sind die größten Herausforderungen für die Sicherheit im Kosovo heute?
Dazu gehören der Schutz von Minderheiten, die Entwaffnung und Reintegration ehemaliger Kämpfer sowie die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen.
- Citar trabajo
- Stella Krüger (Autor), 2009, Die Intervention der NATO und der UN in das Kosovo und die Folgen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207517