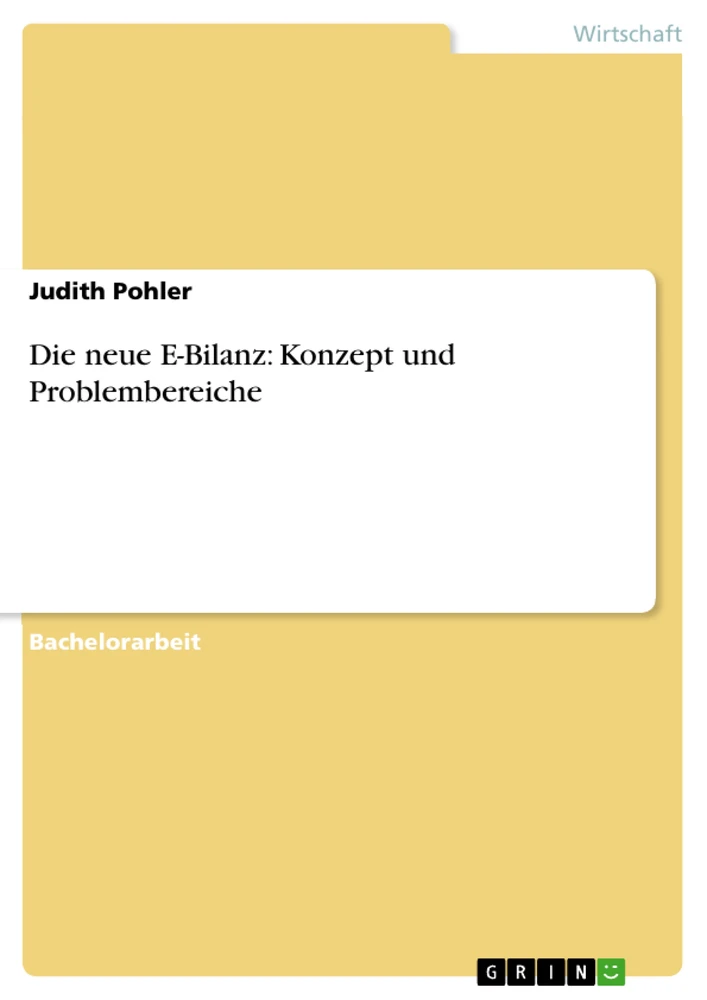Mit Einführung des § 5b EStG hat der Gesetzgeber im Zuge des
Steuerbürokratieabbaugesetzes vom 20.12.2008 bilanzierende Steuerpflichtige zur
Abgabe von Jahresabschlüssen auf dem elektronischen Weg verpflichtet. Bei § 5b
EStG handelt es sich um eine Ergänzung der verfahrensrechtlichen Regelungen der
Steuererklärungspflicht, die „einen wichtigen Baustein des Gesamtkonzepts zur
Modernisierung des Besteuerungsverfahrens darstellt“ und zu einer
Effizienzsteigerung in Form einer besseren und schnelleren Auswertung der Daten
sowie zu Kostenersparnis auf Seiten des Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung
führen soll. Der Inhalt der Regelung orientiert sich dabei an den §§ 18 Abs. 1 UStG
sowie 41a Abs. 1 EStG, aus denen eine Verpflichtung zur elektronischen
Übermittlung von Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen
hervorgeht. Gemäß § 51 Abs. 4 Nr. 1b EStG besteht seitens des BMF eine
Ermächtigung zur Bestimmung des Mindestumfangs der zu übermittelnden Daten,
was bei den Steuerpflichtigen herbe Kritik hervorgerufen hat, da rechtliche Zweifel
an dieser Praxis bestehen. Die technische Übermittlung des Datensatzes erfolgt
mittels XBRL (eXtensible Business Reporting Language), ein „weltweit anerkanntes
und häufig genutztes Verfahren zur standardisierten, elektronischen Übermittlung
von stark strukturierten Informationen“.
Obgleich die Einführung der E-Bilanz eine Reihe von Vorteilen - darunter die
Mehrfachnutzung von Datensätzen und somit Kosteneinspareffekten seitens der
Steuerpflichtigen und die Möglichkeit der Nutzung von Risikomanagementsystemen
„zur Bestimmung prüfungsrelevanter Fälle“ seitens der Finanzverwaltung - mit sich
bringt, geht von den Steuerpflichtigen eine massive Kritik in Bezug auf die
Einführung der E-Bilanz aus.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Konzept
- 2.1 Anwendungsbereich
- 2.1.1 Persönlicher Anwendungsbereich
- 2.1.2 Sachlicher Anwendungsbereich
- 2.2 Taxonomie
- 2.2.1 Definition
- 2.2.2 Aufbau
- 2.2.3 Positionseigenschaften
- 2.3 Übergangs- und Billigkeitsregelung
- 3. Vergleich zum E-Bilanz Projekt Österreich
- 3.1 Einführung der E-Bilanz in Österreich
- 3.2 Unterschiede zu Deutschland
- 4. Problembereiche
- 4.1 Aufwand und Kosten
- 4.2 Informationsmanagement
- 4.2.1 Art der Informationsvermittlung
- 4.2.2 FAQ
- 4.3 Unzulässige Mehrfacherhebung von Daten
- 4.3.1 Rechtswidrigkeit
- 4.3.2 Anschlussgeprüfte Unternehmen
- 4.4 Mindestumfang und Gliederungstiefe
- 4.4.1 Verletzung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
- 4.4.2 Konflikt mit der Ermächtigungsgrundlage
- 4.4.3 Zulässigkeit der Verwendung von NIL-Werten
- 4.4.4 Schwierigkeiten für die Unternehmen
- 4.4.4.1 Rechtsformspezifische Berichtspflichten und -erleichterungen
- 4.4.4.2 Ausländische Betriebsstätten
- 4.4.4.3 Unflexible Eingabemaske / technisch unsaubere Abfrage
- 4.5 Stetiger Anpassungsbedarf („last-minute“ Gesetzgebung)
- 4.6 Härtefallregelung
- 5. Fazit und kritische Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit analysiert das Konzept der elektronischen Bilanz (E-Bilanz) in Deutschland und beleuchtet die damit verbundenen Problembereiche. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der E-Bilanz zu vermitteln, die Implementierung in Deutschland zu bewerten und kritische Punkte zu identifizieren.
- Rechtlicher Rahmen der E-Bilanz
- Anwendungsbereich und Taxonomie der E-Bilanz
- Vergleich mit der E-Bilanz-Implementierung in Österreich
- Herausforderungen und Problembereiche der E-Bilanz
- Kritik und mögliche Verbesserungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor, erläutert die Relevanz der E-Bilanz und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der E-Bilanz, definiert den Anwendungsbereich und erklärt die Taxonomie. Dabei werden wichtige Bestandteile wie die Definition, der Aufbau und die Positionseigenschaften der E-Bilanz erläutert. Des Weiteren wird die Übergangs- und Billigkeitsregelung vorgestellt.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel vergleicht die E-Bilanz in Deutschland mit dem E-Bilanz Projekt in Österreich. Hier werden die Unterschiede in der Einführung und Umsetzung der E-Bilanz in beiden Ländern beleuchtet.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Problembereiche der E-Bilanz. Dabei werden Themen wie Aufwand und Kosten, Informationsmanagement, Unzulässige Mehrfacherhebung von Daten, der Mindestumfang und die Gliederungstiefe der E-Bilanz sowie der stetige Anpassungsbedarf und die Härtefallregelung behandelt.
Schlüsselwörter
E-Bilanz, elektronische Bilanz, Bilanzierung, Finanzverwaltung, Digitalisierung, Informationsmanagement, Rechtswidrigkeit, Mehrfacherhebung, Mindestumfang, Gliederungstiefe, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, Ermächtigungsgrundlage, NIL-Werte, Rechtsformspezifische Berichtspflichten, Ausländische Betriebsstätten, Gesetzgebung, Anpassungsbedarf, Härtefallregelung, Kritik, Analyse
- Citation du texte
- Judith Pohler (Auteur), 2012, Die neue E-Bilanz: Konzept und Problembereiche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207875