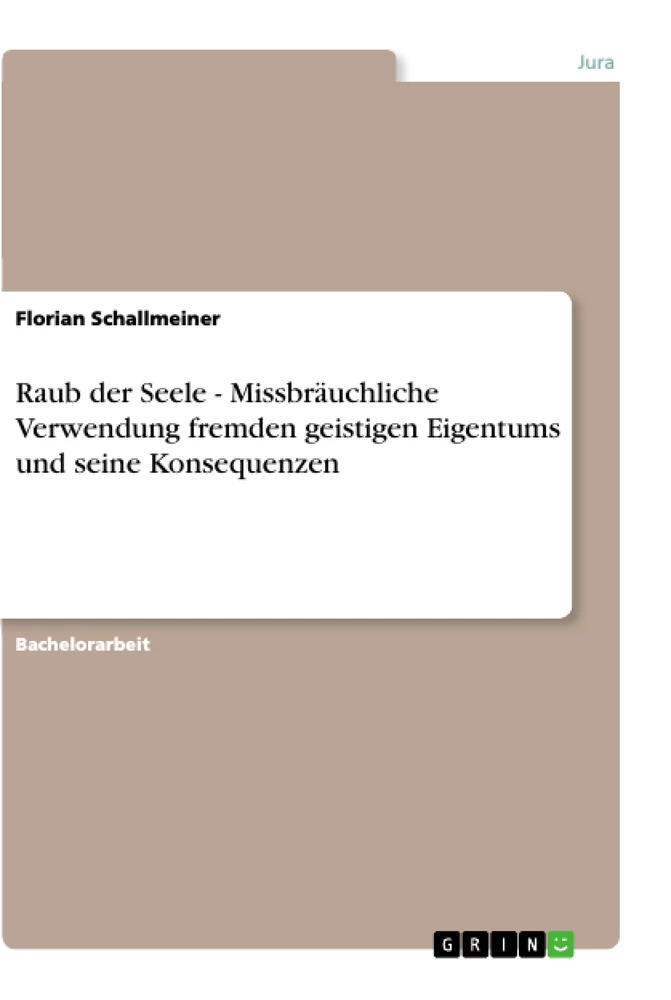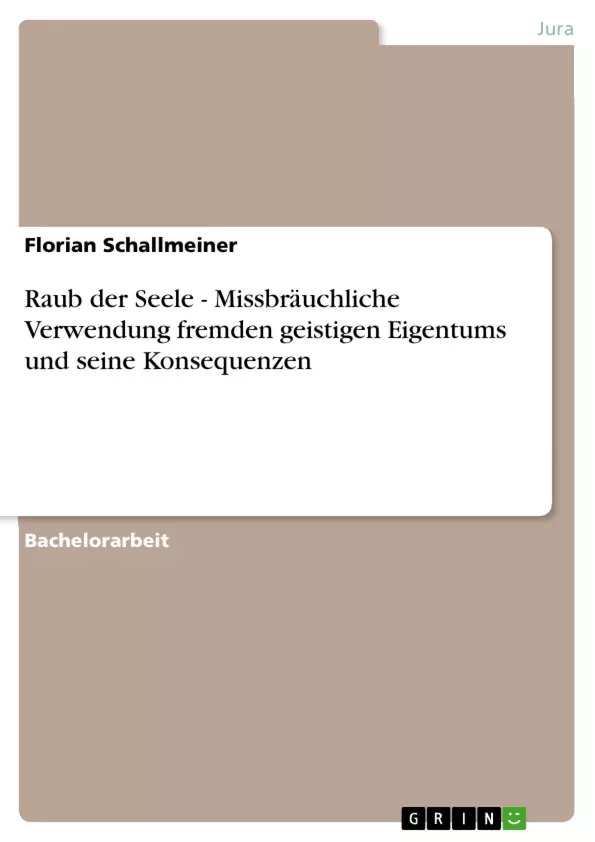Unsauber statt supersauber sollen, neben anderen, Ex-Finanzminister Mag. Karl-Heinz Grasser
und EU-Kommissar Dr. Johannes Hahn ihre Abschlussarbeiten verfasst haben. Ob sie alleine
auf Grund dessen Plagiatoren sind, ist dabei nicht gesagt, wie auch die Erhebungen der
jeweiligen Prüfungskommissionen zeigten.
Beiden wurde kein Fehlverhalten vorgeworfen, wenn auch der eine oder andere Zweifel bestehen
blieb. Dies trifft vor allem auf Dr. Johannes Hahn zu, dessen wissenschaftliche Leistung
nach heutigem Ermessen nicht zu einem erfolgreichen Abschluss und somit zur Erlangung
der Doktorwürde gereicht hätte. Die Zeiten ändern sich also in Bezug auf Toleranz und
Genauigkeit hinsichtlich der Grenzziehung zwischen gerade noch schlampiger Arbeitsweise
und vorsätzlicher Täuschungsabsicht, wie im Fall von Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg
nachgewiesen wurde.
Aber PolitikerInnen oder andere Personen des öffentlichen Lebens sind nur die prominente
Speerspitze dieser Form des wissenschaftlichen Betrugs. Vielmehr geht es in diesem Zusammenhang
um die breite Masse der Studierenden, welche durch das sogenannte „copy&paste“
fremdübernommene geistige Leistungen als eigene intellektuelle Errungenschaft ausgeben
und verbreiten.
Auch in Österreich erfreuen sich der Diebstahl fremden geistigen Eigentums und institutionalisiertes
Abschreiben immer größerer Beliebtheit und so machen es Prominente wie eingangs
erwähnt vor und laut statistischen Erhebungen rund 25% der österreichischen Studierenden
im wahrsten Sinne des Wortes nach. Ob dabei Ideen Dritter herangezogen werden, sich die
Übernahme auf Teile oder ganze Passagen wissenschaftlicher Arbeiten erstreckt oder man
sich gänzlich auf kostenpflichtige Helfer wie Ghostwriter verlässt, ist einerlei. Schlussendlich
verdankt man den akademischen Titel geistigen Anregungen und Arbeitsleistungen Anderer
und bereichert sich an deren Anstrengungen.
Die mediale Aufmerksamkeit, ausgelöst in Österreich durch die Doktorarbeiten von EUKommissar
Johannes Hahn sowie weiteren politischen ProtagonistInnen und vor allem der
Aufstieg und Fall des ehemaligen deutschen Bundeswirtschafts- und -verteidigungsministers
zu Guttenberg, haben das Augenmerk der Öffentlichkeit auf die Unart des Plagiierens gelenkt,
das freilich auch für ein Grundelement der Geisteswissenschaften steht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemhintergrund
- 1.2 Forschungsfrage und Aufbau der Arbeit
- 2. Methodologie des Plagiierens
- 2.1 Plagiat – Definition(en) und Hintergrund
- 2.2 Was ist ein Plagiat im weiteren Sinn?
- 2.3 „Anwendungsgebiete“ des Plagiierens
- 2.4 Plagiate im engeren Sinn
- 2.5 Erscheinungsformen des Plagiats
- 2.6 Probleme der Ein- und Abgrenzung
- 3. Das Plagiat und seine Geschichte(n)
- 3.1 Historie und Entstehung des Plagiats und Plagiierens
- 3.2 Verbreitung und Durchdringung des Diebstahls geistigen Eigentums
- 3.3 Motivationen und Gründe des Plagiierens
- 3.4 Möglichkeiten der Erkennung und Abwehr
- 4. Das Plagiat und seine Folgen
- 4.1 Gesetzliche Regelungen
- 4.2 Plagiieren für Anfänger
- 4.3 Plagiate aus zivil- und strafrechtlicher Perspektive
- 4.4 Das Urheberrecht
- 5. Plagiieren für Fortgeschrittene
- 5.1 Freiherr Karl-Theodor zu Guttenberg
- 5.2 Dr. Johannes Hahn
- 6. Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Plagiats, seine historischen Entwicklungen, seine verschiedenen Erscheinungsformen und seine Konsequenzen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Motivationen hinter plagiierenden Handlungen und der Diskussion der rechtlichen und ethischen Implikationen. Die Arbeit beleuchtet sowohl prominente Fälle als auch die breite Praxis des Plagiierens unter Studierenden.
- Definition und Abgrenzung von Plagiat
- Historische Entwicklung und Verbreitung von Plagiaten
- Motivationen und Gründe für Plagiate
- Rechtliche und ethische Folgen von Plagiaten
- Methoden der Plagiatserkennung und -prävention
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert den Problemhintergrund, indem sie prominente Fälle von Plagiaten in der Politik erwähnt und den Fokus auf die weitverbreitete Praxis des Plagiierens unter Studierenden lenkt. Sie formuliert die Forschungsfrage und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Einleitung verdeutlicht die Aktualität und Relevanz des Themas und hebt die zunehmende Bedeutung von wissenschaftlicher Integrität hervor.
2. Methodologie des Plagiierens: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Plagiats und differenziert zwischen verschiedenen Erscheinungsformen, vom wörtlichen Abschreiben bis zur Umformulierung fremder Texte. Es analysiert die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von zulässiger und unzulässiger Textübernahme und beleuchtet die verschiedenen „Anwendungsgebiete“ des Plagiierens. Die Komplexität der Thematik wird herausgestellt, und die methodischen Herausforderungen bei der Erkennung von Plagiaten werden angedeutet.
3. Das Plagiat und seine Geschichte(n): Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Plagiats, von seinen Anfängen bis zur heutigen Verbreitung. Es analysiert die gesellschaftlichen und technologischen Faktoren, die zur Zunahme von Plagiaten beigetragen haben. Weiterhin werden die Motive und Beweggründe von Plagiatoren untersucht und mögliche Methoden zur Erkennung und Prävention von Plagiaten diskutiert. Der Kapitel behandelt die historische Kontextualisierung des Plagiats und die Entwicklung der Wahrnehmung dieses Problems.
4. Das Plagiat und seine Folgen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Konsequenzen von Plagiaten, sowohl auf rechtlicher als auch auf ethischer Ebene. Es analysiert die gesetzlichen Regelungen zum Urheberrecht und zum geistigen Eigentum, sowie die zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen von Plagiaten. Die Bedeutung von wissenschaftlicher Integrität und die Notwendigkeit von Sanktionen werden betont. Es werden die verschiedenen rechtlichen und sozialen Folgen von Plagiaten detailliert dargestellt.
5. Plagiieren für Fortgeschrittene: Dieses Kapitel präsentiert Fallstudien von prominenten Personen, die wegen Plagiaten in ihren wissenschaftlichen Arbeiten aufgefallen sind. Anhand von Beispielen wie Karl-Theodor zu Guttenberg und Johannes Hahn werden die Mechanismen und Folgen von Plagiaten in hochrangigen Positionen beleuchtet. Die Analyse zeigt die unterschiedlichen Reaktionen und Konsequenzen aufdeckte, die von der öffentlichen Meinung und von Institutionen ausgelöst wurden.
Schlüsselwörter
Plagiat, Plagiieren, Urheberrecht, geistiges Eigentum, wissenschaftliche Integrität, wissenschaftliches Arbeiten, Zitierweise, Forschungsethik, Konsequenzen, Fallstudien, Rechtliche Regelungen, Prominente Fälle, Studierende.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Methodologie des Plagiierens"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert umfassend das Phänomen des Plagiats. Sie untersucht seine historischen Entwicklungen, verschiedenen Erscheinungsformen, Konsequenzen und die dahinterstehenden Motivationen. Ein besonderer Fokus liegt auf den rechtlichen und ethischen Implikationen sowie auf prominenten Fällen und der Praxis des Plagiierens unter Studierenden.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) stellt den Problemhintergrund und die Forschungsfrage vor. Kapitel 2 ("Methodologie des Plagiierens") definiert Plagiat, differenziert zwischen verschiedenen Formen und analysiert die Schwierigkeiten der Abgrenzung. Kapitel 3 ("Das Plagiat und seine Geschichte(n)") beleuchtet die historische Entwicklung, Verbreitung und die Motive hinter Plagiaten. Kapitel 4 ("Das Plagiat und seine Folgen") befasst sich mit den rechtlichen und ethischen Konsequenzen, inklusive Urheberrecht und Sanktionen. Kapitel 5 ("Plagiieren für Fortgeschrittene") präsentiert Fallstudien prominenter Personen, z.B. Guttenberg und Hahn. Kapitel 6 (Resümee und Ausblick) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Definition von Plagiat wird verwendet?
Die Arbeit bietet eine differenzierte Betrachtung des Plagiatsbegriffs. Es wird zwischen verschiedenen Erscheinungsformen unterschieden, vom direkten Abschreiben bis zur Umformulierung fremder Texte. Die Komplexität der Definition und die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von zulässiger und unzulässiger Textübernahme werden explizit thematisiert.
Welche historischen Aspekte werden behandelt?
Kapitel 3 untersucht die historische Entwicklung des Plagiats von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. Es werden gesellschaftliche und technologische Faktoren analysiert, die zur Zunahme von Plagiaten beigetragen haben. Die Arbeit beleuchtet die historische Kontextualisierung des Problems und die Entwicklung seiner Wahrnehmung.
Welche Motivationen für Plagiate werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Motivationen hinter plagiierenden Handlungen. Diese werden in verschiedenen Kapiteln untersucht, sowohl im Kontext der historischen Entwicklung als auch im Zusammenhang mit den verschiedenen Erscheinungsformen des Plagiats. Es wird untersucht, welche Gründe dazu führen, dass Personen fremde Texte als eigene ausgeben.
Welche rechtlichen und ethischen Folgen werden diskutiert?
Kapitel 4 befasst sich ausführlich mit den rechtlichen und ethischen Konsequenzen von Plagiaten. Es werden die gesetzlichen Regelungen zum Urheberrecht und geistigen Eigentum erläutert, sowie die zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen dargestellt. Die Bedeutung von wissenschaftlicher Integrität und die Notwendigkeit von Sanktionen werden hervorgehoben.
Werden konkrete Fallbeispiele genannt?
Ja, Kapitel 5 präsentiert Fallstudien prominenter Personen, die wegen Plagiaten in ihren wissenschaftlichen Arbeiten aufgefallen sind. Die Beispiele von Karl-Theodor zu Guttenberg und Johannes Hahn dienen der Illustration der Mechanismen und Folgen von Plagiaten in hochrangigen Positionen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Plagiat, Plagiieren, Urheberrecht, geistiges Eigentum, wissenschaftliche Integrität, wissenschaftliches Arbeiten, Zitierweise, Forschungsethik, Konsequenzen, Fallstudien, rechtliche Regelungen, prominente Fälle, Studierende.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler, Lehrende und alle, die sich mit wissenschaftlichem Arbeiten, Urheberrecht und Forschungsethik auseinandersetzen. Sie ist auch für Personen von Interesse, die sich für die rechtlichen und gesellschaftlichen Folgen von Plagiaten interessieren.
- Quote paper
- Magister Florian Schallmeiner (Author), 2013, Raub der Seele - Missbräuchliche Verwendung fremden geistigen Eigentums und seine Konsequenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207900