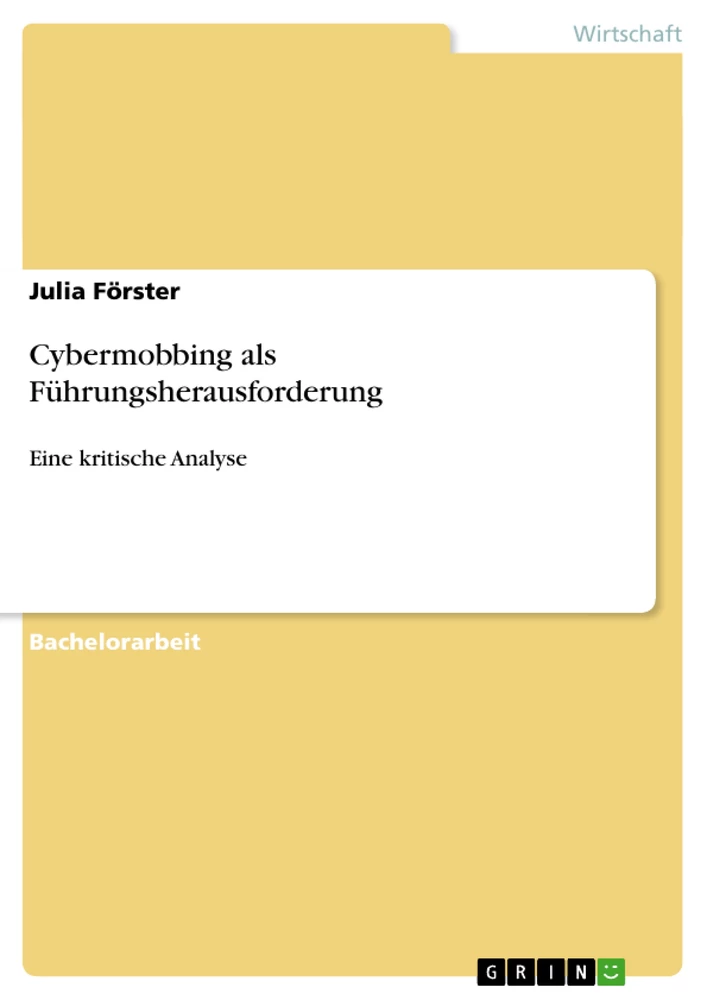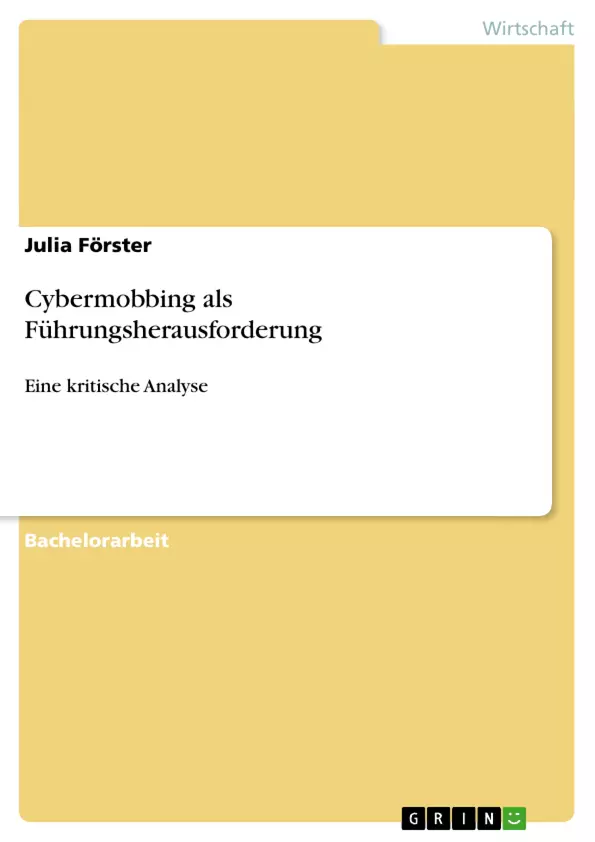Schätzungen zufolge sind rund 1-1,5 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland täglich Opfer von Mobbinghandlungen am Arbeitsplatz. Experten gehen davon aus, dass viele Arbeitnehmer darüber schweigen, dass sie Opfer von Mobbing sind. Daher gibt es keine genauen Zahlen darüber, wie viele Arbeitnehmer tatsächlich als Opfer von einem Mobbingkonflikt betroffen sind. Die Dunkelziffer liegt vermutlich höher als die statistisch ermittelten Zahlen. Hinzu kommt eine spezielle Form des Mobbings, das Cybermobbing, bei dem Mobbinghandlungen unter der Nutzung von Kommunikationstechnologien stattfinden. Das Phänomen des Cybermobbing ist in Deutschland zwar nicht unbekannt, wird jedoch selten als auftretender Konflikt in der Arbeitswelt thematisiert. Über die von Cybermobbing betroffenen Arbeitnehmer in Deutschland gibt es weder Schätzungen noch Statistiken. Konflikte sind jedoch überall dort unvermeidlich, wo Menschen zusammenkommen und können sich negativ auswirken, wenn sie nicht gelöst werden. Am Arbeitsplatz auftretende und länger anhaltende Konflikte können nachweislich zu diversen Krankheiten beim Opfer führen. Eine schlechtere Arbeitsleistung des Opfers ist eine weitere Auswirkung, die ein ungelöster Konflikt mit sich bringen kann. Dadurch ergeben sich auch negative Auswirkungen auf das Unternehmen. Dies stellt Führungskräfte bei der Mediennutzung von Mitarbeitern vor eine besondere Herausforderung. Sie sind gezwungen, sich mit dem Thema Cybermobbing am Arbeitsplatz auseinanderzusetzen, entstandene Konflikte zu lösen und präventive Maßnahmen zu ergreifen, um Cybermobbing weitgehend zu unterbinden und langfristig den Erfolg des Unternehmens zu sichern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Klärung des Begriffs Mobbing
- 2.1.1 Definition des Begriffs Mobbing
- 2.1.2 Abgrenzung des Begriffs Cybermobbing
- 2.2 Ursachen von Cybermobbing am Arbeitsplatz
- 2.3 Entstehung von Cybermobbing am Arbeitsplatz
- 2.4 Folgen von Cybermobbing
- 2.4.1 Folgen für den Mitarbeiter
- 2.4.2 Folgen für das Unternehmen
- 3. Untersuchungsrahmen
- 3.1 Mentales Modell
- 3.2 Methodik
- 4. Untersuchung
- 4.1 Präventive Maßnahmen von Führungskräften
- 4.1.1 Schaffung eines guten Betriebsklimas/Klare Arbeitsorganisation
- 4.1.2 Aufklärung der Mitarbeiter über Cybermobbing
- 4.1.3 Teamarbeit
- 4.1.4 Betriebsvereinbarungen/Sanktionen
- 4.1.5 Einrichten einer Anlaufstelle
- 4.1.6 Mitarbeiterbefragungen/Mitarbeitergespräche
- 4.1.7 Online-Vernetzung der Führungskraft
- 4.1.8 Tracking
- 4.2 Interventionsmaßnahmen von Führungskräften
- 4.2.1 Betriebsversammlung
- 4.2.2 Ehrliche Gespräche
- 4.2.3 Beobachtungen
- 4.2.4 Rechtliches Vorgehen/Sanktionen
- 4.2.5 Einschränkungen der Mediennutzung/Sperren
- 4.2.6 Versetzung an einen medienfreien Arbeitsplatz
- 5. Ergebnisse
- 5.1 Zusammenfassung
- 5.2 Limitation
- 5.3 Implikation für die Forschung
- 5.4 Implikation für die Praxis
- 5.5 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema Cybermobbing am Arbeitsplatz und analysiert die Rolle der Führungskraft in diesem Zusammenhang. Das Hauptziel der Arbeit ist es, die Handlungsmöglichkeiten von Führungskräften im Umgang mit Cybermobbing zu untersuchen. Dabei wird sowohl auf präventive als auch auf intervenierende Maßnahmen eingegangen. Die Arbeit soll ein besseres Verständnis für die Herausforderungen von Cybermobbing am Arbeitsplatz schaffen und praktikable Lösungsansätze für Führungskräfte liefern.
- Definition und Abgrenzung von Cybermobbing
- Ursachen und Folgen von Cybermobbing am Arbeitsplatz
- Rolle der Führungskraft bei der Prävention und Intervention von Cybermobbing
- Mögliche Maßnahmen zur Unterbindung von Cybermobbing am Arbeitsplatz
- Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten für Führungskräfte im Kontext von Cybermobbing
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung führt in die Thematik von Cybermobbing am Arbeitsplatz ein und stellt die Problemstellung sowie die Zielsetzung der Arbeit dar.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen von Mobbing und Cybermobbing erläutert, einschließlich der Definitionen, Ursachen und Folgen. Es wird auf die Bedeutung des Begriffs und die Entwicklung des Phänomens eingegangen.
- Kapitel 3: Das dritte Kapitel beschreibt den Untersuchungsrahmen der Arbeit, einschließlich des mentalen Modells und der Methodik.
- Kapitel 4: In diesem Kapitel werden die präventiven und intervenierenden Maßnahmen von Führungskräften im Umgang mit Cybermobbing am Arbeitsplatz untersucht. Es werden verschiedene Ansätze und Strategien vorgestellt, die von Führungskräften ergriffen werden können, um Cybermobbing zu verhindern oder zu bekämpfen.
Schlüsselwörter
Cybermobbing, Arbeitsplatz, Führungskraft, Prävention, Intervention, Konfliktmanagement, Betriebsklima, Teamarbeit, Mediennutzung, Sanktionen, Unternehmenskultur, Arbeitsrecht, Mitarbeiterbefragungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Mobbing und Cybermobbing am Arbeitsplatz?
Cybermobbing findet unter Nutzung von Kommunikationstechnologien statt. Es ist oft schwerer greifbar, da es zeitlich und räumlich nicht auf den physischen Arbeitsplatz begrenzt ist.
Welche Folgen hat Cybermobbing für Unternehmen?
Neben den gesundheitlichen Folgen für die Opfer führt Cybermobbing zu schlechterer Arbeitsleistung, einem gestörten Betriebsklima und langfristig zu wirtschaftlichen Einbußen für das Unternehmen.
Wie können Führungskräfte Cybermobbing präventiv verhindern?
Zu den Maßnahmen gehören die Schaffung eines guten Betriebsklimas, Aufklärung der Mitarbeiter, klare Arbeitsorganisation, Betriebsvereinbarungen und das Einrichten von Anlaufstellen.
Welche Interventionsmöglichkeiten gibt es bei akuten Fällen?
Führungskräfte können ehrliche Gespräche führen, rechtliche Schritte einleiten, Sanktionen verhängen oder im Extremfall die Mediennutzung einschränken bzw. Versetzungen veranlassen.
Warum ist die Dunkelziffer bei Mobbing so hoch?
Viele Betroffene schweigen aus Scham oder Angst vor weiteren Repressalien. Experten schätzen, dass 1-1,5 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland betroffen sind, die statistische Erfassung jedoch lückenhaft ist.
- Citation du texte
- Julia Förster (Auteur), 2012, Cybermobbing als Führungsherausforderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208078