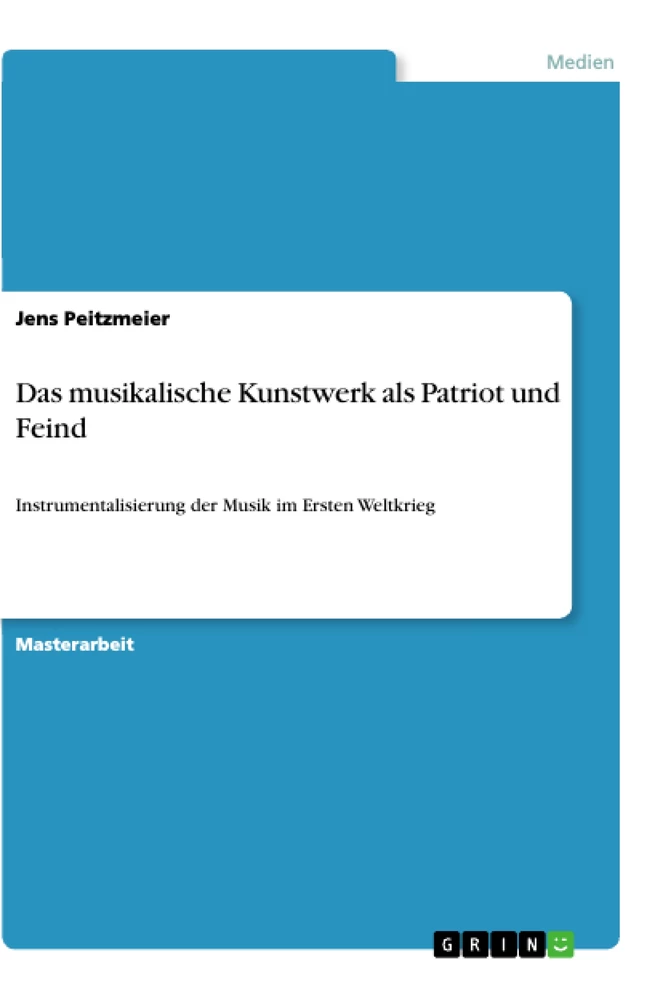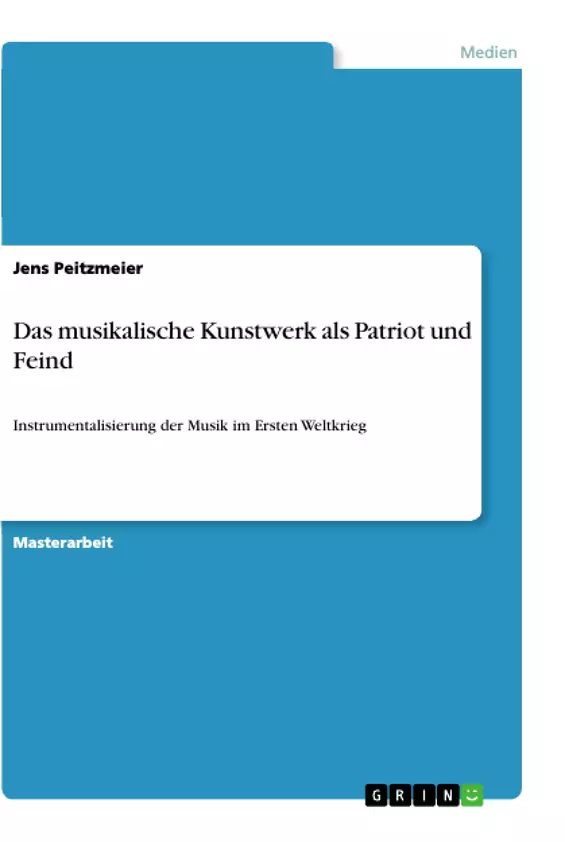Der Erste Weltkrieg gehört zu den einschneidensten Ereignissen der deutschen und der europäischen Geschichte, er gilt als der erste ,totale‘ Krieg und stellt zweifelsohne einen Wendepunkt in der Geschichte medialer Kriegsführung und propagandistischer Beeinflussung dar. Neben einer „wahre[n] Flut von literarischen Reflexionen“ - als Reaktion auf den Krieg von Schriftstellern und anderen Intellektuellen hervorgebracht - veränderte sich mehr oder weniger schlagartig auch der Umgang mit Musik in Konzert und journalistischer Betrachtung. Mit Ausnahme der Popularmusik-Forschung zählt der Erste Weltkrieg in der Musikwissenschaft jedoch immer noch - besonders im Vergleich zum ,Dritten Reich‘ und zum Zweiten Weltkrieg - zu den wenig erforschten Gebieten. Dies ist insbesondere angesichts der Erkenntnisse über die Formen und Mittel der Propaganda im ausgehenden Kaiserreich erstaunlich, gehört doch aus heutiger Sicht gerade die Musik zweifelsohne zu den einfachsten Möglichkeiten medialer Beeinflussung.
Die vorliegende Arbeit soll einen kleinen Beitrag zur Aufarbeitung dieser musikwissenschaftlichen ,Lücke‘ leisten. Neben einer möglichst genauen Beschreibung des deutschen Musiklebens von 1914 bis 1918, seines Umfanges, des Konzert-, und Opernrepertoires sowie eventueller Unterschiede zu der unmittelbar vorangegangenen Zeit soll anhand einer Vielzahl von Artikeln aus der musikalischen Fachpresse untersucht werden, in welchem Umfang und mit welchen Zielsetzungen sich die zeitgenössischen Intellektuellen theoretisch mit der Funktionalisierung, Politisierung und Instrumentalisierung von Musik befasst haben. Eine grobe Einordnung dieser Funktionalisierung der Musik während des Ersten Weltkriegs in die Geschichte der Musikinstrumentalisierung im 20. Jahrhundert soll abschließend vorgenommen werden und kann dazu dienen, ein an sich zunächst singuläres und neues Phänomen innerhalb einer größeren Entwicklung von mittlerweile fast einhundert Jahren wahrzunehmen und sich so in seiner Bedeutung neu zu erschließen.
Neben den primär betrachteten großen Städten und Metropolen des Reiches spielte sich Kultur auch in kleineren Orten und Mittelzentren ab. Wegen deren seltener Erwähnung in den großen Fachpublikationen ist eine Erforschung des Musiklebens kleinerer Städte jedoch verhältnismäßig schwierig, wird am Beispiel der Stadt Osnabrück dennoch - in kleinem Umfange - vorgenommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Zielsetzungen dieser Arbeit
- Zur Quellenlage
- Politik, Propaganda, Kultur und Musik zu Beginn des 20. Jahrhunderts
- Politik, Gesellschaft und Propaganda im ausgehenden Kaiserreich
- Zu Kultur und Musik um 1914 - eine Bestandsaufnahme
- Das Musikleben in Deutschland zwischen 1914 und 1918
- Allgemeine Betrachtungen
- Opernwesen
- Engelbert Humperdinck: Die Marketenderin
- Konzerte und Liederabende
- Allgemeine Betrachtungen
- „Beethoven und kein Ende“ - Komponistenverehrung im Ersten Weltkrieg
- Volks-, Vaterlands- und Soldatenlieder
- Felix Weingartner: Ouvertüre, Aus ernster Zeit' op. 56
- Hugo Kaun: Symphonie Nr. 1,An mein Vaterland' op. 22
- Kirchenkonzerte, Kantaten und oratorische Aufführungen
- Das Osnabrücker Musikleben zwischen 1914 und 1918
- Theaterwesen
- Kirchenkonzerte
- Sinfonische, kammermusikalische und andere Konzerte
- Weitere musikalisch relevante Artikel
- Das Deutschtum und der Umgang mit dem Feind in der musikalischen Fachpresse 1914-1918
- Anfeindungen gegen das Ausland, Gegendarstellungen und Reaktionen auf ausländische Anfeindungen
- „Sprachreinigung“ - der Umgang mit den Fremdwörtern
- Die Nationalhymnendebatte
- Die „richtige“ Fassung der Wacht am Rhein
- Weitere Meldungen und Diskurse
- Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit setzt sich zum Ziel, die Instrumentalisierung von Musik im Ersten Weltkrieg zu untersuchen. Der Fokus liegt dabei auf dem deutschen Musikleben zwischen 1914 und 1918, insbesondere auf dem Konzert- und Opernrepertoire, der patriotischen Musik und der Rolle der musikalischen Fachpresse.
- Die Instrumentalisierung von Musik im Ersten Weltkrieg
- Das deutsche Musikleben im Ersten Weltkrieg
- Die Rolle der musikalischen Fachpresse
- Die Entwicklung von Feindbildern und die Verbreitung von Propaganda durch Musik
- Die Nutzung von Musik zur Mobilisierung und zur Stärkung des Nationalgefühls
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die die Zielsetzung und die Quellenlage erläutert. Anschließend werden die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen des Ersten Weltkriegs beleuchtet, mit besonderem Fokus auf die Rolle der Musik im ausgehenden Kaiserreich. Kapitel 3 analysiert das Musikleben in Deutschland während des Krieges, einschließlich Opernaufführungen, Konzerten, Liederabenden und Kirchenmusik. Dabei wird auch die Instrumentalisierung von Musik durch die Propaganda untersucht. Kapitel 4 widmet sich dem Musikleben in Osnabrück während des Krieges. Kapitel 5 analysiert die Rolle der musikalischen Fachpresse und den Umgang mit dem Feind in der Musik.
Schlüsselwörter
Musik, Erster Weltkrieg, Propaganda, Instrumentalisierung, Deutschtum, Feindbild, Fachpresse, Nationalismus, Musikgeschichte, Oper, Konzert, Kirchenmusik.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde Musik im Ersten Weltkrieg instrumentalisiert?
Musik diente als Mittel der Propaganda, zur Stärkung des Nationalgefühls und zur Diffamierung des „Feindes“ in Konzerten und der Fachpresse.
Was war die „Sprachreinigung“ in der Musik?
Während des Krieges gab es Bestrebungen, ausländische Fachbegriffe aus der Musiksprache zu entfernen und durch deutsche Begriffe zu ersetzen.
Welche Rolle spielten Komponisten wie Beethoven im Krieg?
Klassische Komponisten wurden als Symbole des „deutschen Geistes“ verehrt und ihre Werke in einen patriotischen Kontext gestellt.
Wie sah das Musikleben in Osnabrück zwischen 1914 und 1918 aus?
Die Arbeit bietet eine Fallstudie zum Osnabrücker Theaterwesen, zu Kirchenkonzerten und sinfonischen Aufführungen während der Kriegsjahre.
Was war Gegenstand der Nationalhymnendebatte?
In der musikalischen Fachpresse wurde intensiv über die „richtige“ Fassung von Liedern wie „Die Wacht am Rhein“ und deren Eignung als nationale Symbole diskutiert.
- Quote paper
- Jens Peitzmeier (Author), 2012, Das musikalische Kunstwerk als Patriot und Feind, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208447