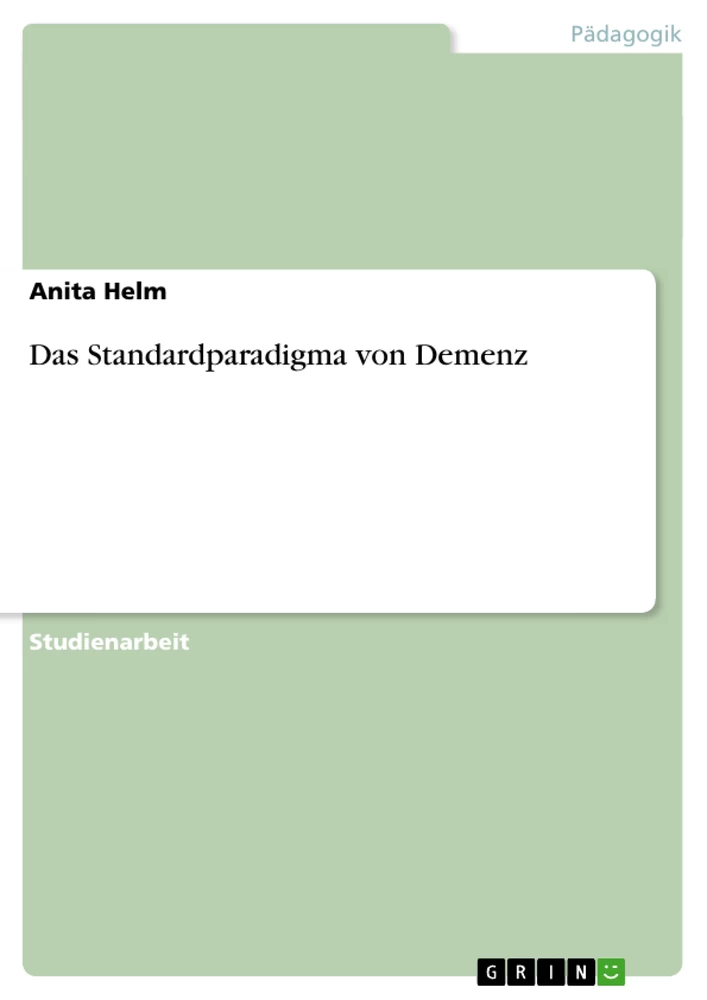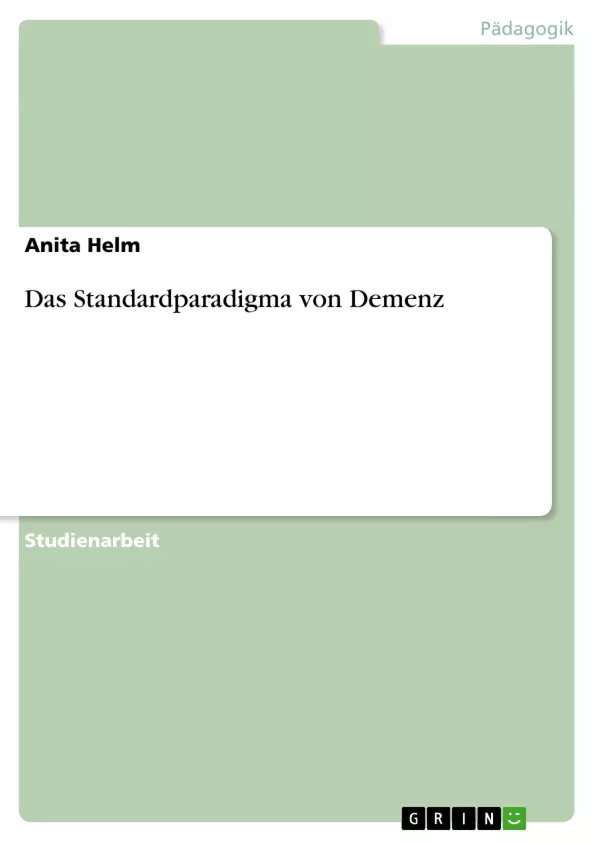Der Begriff „Standardparadigma“ wurzelt in der gängigen Hypothese der Demenz, dass ein Faktor oder Faktoren X zu neuropathischen Veränderungen und diese zu Demenz führen. Alle geistigen und emotionalen Symptome wären demnach ausschließlich das direkte Ergebnis einer Reihe katastrophaler Veränderungen im Gehirn, die zum Absterben von Hirnzellen führen und somit zu Demenz. Diese Degeneration wäre irreversibel, und führt ausschließlich zu einer Verschlechterung des gesamten Zustandes einer Person. Bei dieser weit verbreiteten Auffassung handelt es sich jedoch nur um eine vereinfachte, lineare Vorstellung von Demenz.
Der zweite Aspekt, auf den der Titel „Das Standardparadigma von Demenz“ verweisen soll ist, dass infolge der Etikettierung von Demenz als neuropathologische Krankheit, eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Mensch mit Demenz ausschließlich als „Kranker“ etikettiert wird und so unter Umständen nicht länger als vollwertige, individuelle Person gilt. Diese Sichtweisen, Vorstellungen und Bilder in unseren Köpfen über Demenz, tragen viel dazu bei, wie wir einem Menschen mit Demenz begegnen, ihn behandeln und ihn bewerten und so wiederum dazu, wie sich solch ein Mensch selber bewertet. Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit die Themen Etikettierung und Demenz zusammengeführt, um zu untersuchen, wie groß der Einfluss dieser Vorstellungen in unseren Köpfen auf einen Menschen mit Demenz sein kann. Zudem wird die Ursache, dieser negativen, vereinfachten Sichtweise von Demenz, vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Normen und Werte hinterfragt. Denn alles Verhalten bezieht seine Bedeutung aus denjenigen Definitionsprozessen, in die es verstrickt ist.
Weiterhin soll untersucht werden, dass aufgrund der Legitimation einer ausschließlich organischen Grundlage von Demenz, der effizienten Pflege einer Person mit Demenz kein Platz eingeräumt wird. Folglich soll in dieser Arbeit Demenz ent-pathologisiert werden. Sie soll untersuchen, warum Demenz nicht als Teil unseres menschlichen Daseins akzeptiert wird, sondern sich eine Dynamik dahingehend zeigt, Menschen mit schwerer körperlicher oder seelischer Behinderung (Abweichung) zu depersonalisieren und aus der Welt der Personen auszugrenzen. Es geht darum ein weites Verständnis von Etikettierungsprozessen und Demenz zu erhalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Etikettierungs-Ansatz
- 1.2 Das Problem des Relativismus.
- 1.3 Zuschreibungsaspekt
- 1.4 Versuch einer Definition von Abweichung.
- 1.5 Etikettierung und ihre Auswirkungen in interpersonalen Beziehungen ……………………….
- 1.5.1 Stereotypenbildung ....
- 1.5.2 Retrospektive Interpretation
- 1.5.3 Verhandeln
- 1.5.4 Relative Machtposition........
- 1.5.5 Rollendruck
- 1.6 Etikettierung und Organisation.
- 2. Der Begriff des Personseins
- 2.1 Die Einzigartigkeit von Personen …...\li>
- 2.2 Personsein und Verkörperung
- 3. Die Definition von Demenz..
- 3.1 Die Dialektik von Demenz.
- 3.2 Persönlichkeitsveränderungen bei Demenz..
- 3.3 Körperliche Zustände, die eine Demenz verstärken..
- 4. Das Standardparadigma der Demenz
- 4.1 Abwehrmechanismen in der Demenzpflege
- 4.2 Maligne, bösartige Sozialpsychologie.
- 5. Die positive Arbeit an der Person.......
- 6. Die für- und versorgende Organisation
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, das "Standardparadigma" der Demenz zu hinterfragen und eine breitere Perspektive auf diese Erkrankung zu entwickeln. Sie untersucht, wie Etikettierungsprozesse und gesellschaftliche Reaktionen auf Abweichung die Wahrnehmung und Behandlung von Menschen mit Demenz beeinflussen. Die Arbeit strebt nach einer Ent-Pathologisierung von Demenz und einer Stärkung des Personseins von Menschen mit Demenz.
- Die Auswirkungen von Etikettierungsprozessen auf die Wahrnehmung und Behandlung von Menschen mit Demenz
- Die Bedeutung des Personseins und die Herausforderung der Depersonalisierung in der Demenzpflege
- Die kritische Analyse des "Standardparadigmas" der Demenz und die Suche nach einem positiveren Verständnis
- Die Rolle von sozialen und gesellschaftlichen Faktoren bei der Entstehung und Bewältigung von Demenz
- Die Bedeutung von "positiver Arbeit" und einer fördernden Organisation in der Demenzpflege
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das "Standardparadigma" der Demenz in Frage, welches diese als reine Folge von Hirnschädigungen betrachtet, und betont die Notwendigkeit, auch soziale und gesellschaftliche Faktoren zu berücksichtigen.
- 1. Etikettierungs-Ansatz: Dieses Kapitel untersucht die theoretischen Grundlagen des Etikettierungs-Ansatzes und beleuchtet seine Relevanz für das Verständnis von Abweichung und sozialen Reaktionen.
- 2. Der Begriff des Personseins: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Verständnis von Personsein und der Bedeutung der individuellen Einzigartigkeit in der Demenzpflege.
- 3. Die Definition von Demenz: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Aspekte der Demenzdefinition und untersucht die Bedeutung der Dialektik, Persönlichkeitsveränderungen und körperlicher Faktoren.
- 4. Das Standardparadigma der Demenz: Dieses Kapitel kritisiert das "Standardparadigma" der Demenz und beleuchtet die negativen Auswirkungen auf die Wahrnehmung und Behandlung von Menschen mit Demenz.
- 5. Die positive Arbeit an der Person: Dieses Kapitel beschreibt die Bedeutung von "positiver Arbeit" in der Demenzpflege, die auf die individuellen Bedürfnisse und Stärken des Menschen mit Demenz eingeht.
- 6. Die für- und versorgende Organisation: Dieses Kapitel diskutiert die Rolle der Organisation in der Demenzpflege und die Notwendigkeit einer fördernden und unterstützenden Umgebung.
Schlüsselwörter
Demenz, Etikettierung, Personsein, Standardparadigma, Abweichung, positive Arbeit, Demenzpflege, soziale Reaktionen, gesellschaftliche Normen, Personenzentrierung, Ent-Pathologisierung
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Standardparadigma“ der Demenz?
Die vereinfachte, lineare Vorstellung, dass ausschließlich neuropathologische Veränderungen im Gehirn für alle Symptome der Demenz verantwortlich sind.
Was bedeutet „Ent-Pathologisierung“ von Demenz?
Demenz nicht nur als rein organische Krankheit zu sehen, sondern als Teil des menschlichen Daseins zu akzeptieren und soziale Faktoren einzubeziehen.
Welchen Einfluss hat die „Etikettierung“ auf Demenzkranke?
Durch das Etikett „Kranker“ droht die Depersonalisierung, bei der der Mensch nicht mehr als vollwertige, individuelle Person wahrgenommen wird.
Was ist „maligne Sozialpsychologie“ in der Pflege?
Ein Umfeld, das durch unbewusste Abwehrmechanismen und negative Interaktionen das Personsein des Demenzkranken untergräbt.
Wie sieht eine „positive Arbeit an der Person“ aus?
Sie fokussiert auf die Stärken und die Einzigartigkeit des Individuums, um dessen Personsein trotz kognitiver Einschränkungen zu erhalten.
- Quote paper
- Diplompädagogin Anita Helm (Author), 2009, Das Standardparadigma von Demenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208637