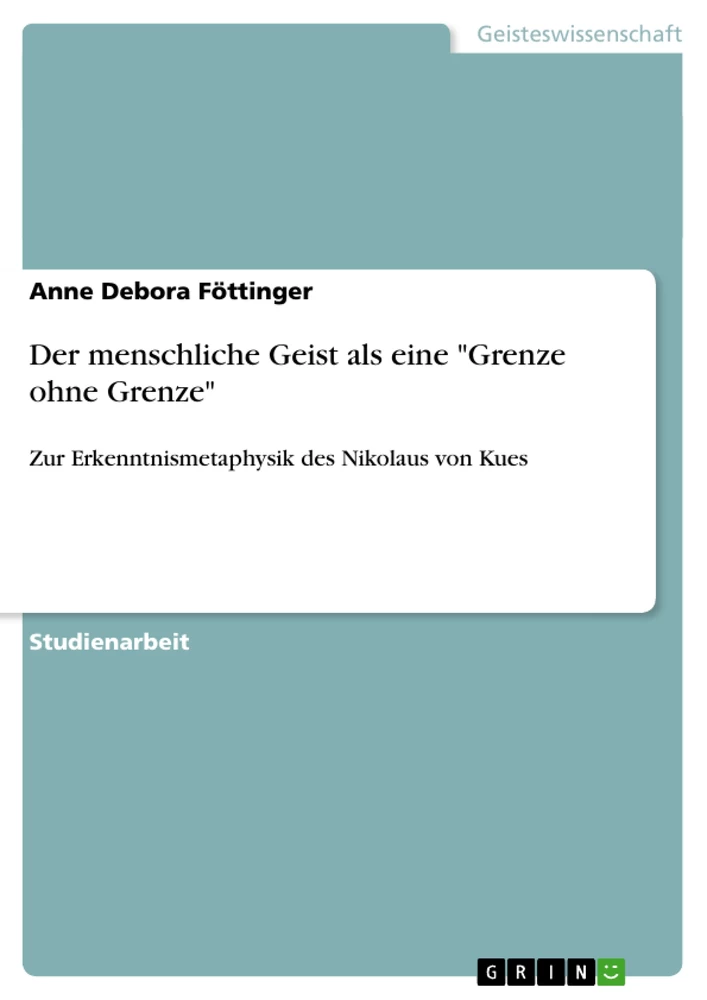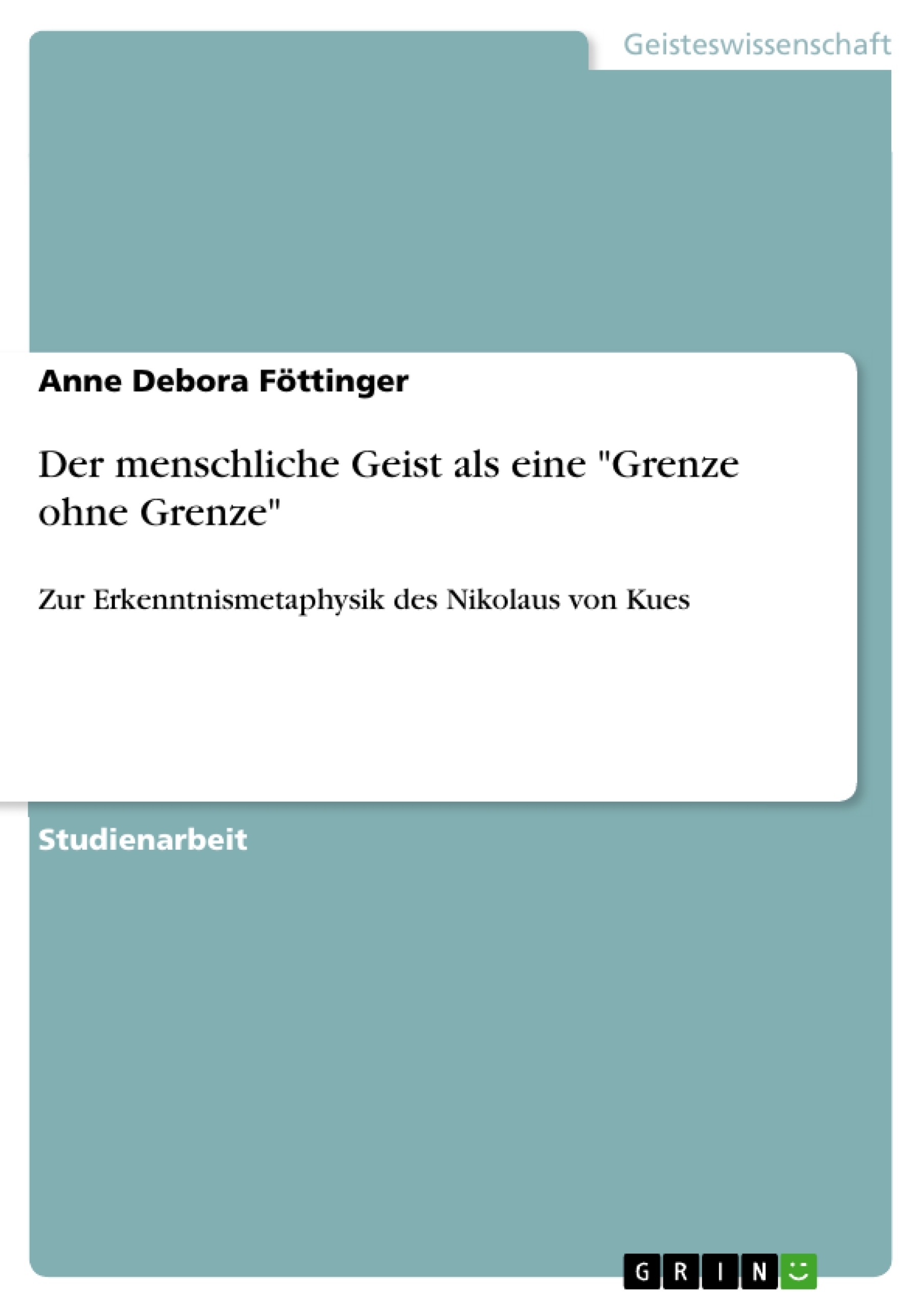„Es gibt ohne Zweifel eine Erfahrung, die der Mensch mit all seinen Erfahrungen macht: ihr Entstehen und Vergehen, ihre Vergänglichkeit, ihr Eingebundensein in eine Zeit, deren Hauptmerkmal das ständige Übergehen von einem Noch-nicht in ein Nicht-mehr ist (…): die Erfahrung also einer Zeit, die vergeht, insofern endlich ist.“
Diese Grunderfahrung der Endlichkeit spiegelt sich auf besondere Weise in den geistigen und kulturellen Erzeugnissen wieder. Sie sprechen vom steten Versuch des Menschen, sich aus seiner sinnlichen Weltbefangenheit herauszulösen und die ihm endlich gesetzten Grenzen zu überschreiten. In diesem Bestreben des menschlichen Geistes, sich zu einer Gegenwärtigkeit ohne Entstehen und Vergehen - man könnte sagen: zum Unendlichen - hinzubewegen, liegt seine Ohnmacht und besondere Auszeichnung zugleich.
Auch die Schriften des Philosophen und Theologen Nikolaus Cusanus (1405-1464) können als ein Zeugnis menschlichen Strebens nach dem Unendlichen gelten. Sie fragen vor allem nach den Möglichkeiten und Grenzen menschlichen Erkennens im Hinblick auf eine Gotteserkenntnis. In welchem Verhältnis steht der Menschen zu Gott, zur Welt und zu sich selbst? Wie ist eine Erkenntnis des Endlichen, der vergänglichen Zeit als vergänglich überhaupt möglich?
In einer symbol- und bilderreichen Sprache versucht Cusanus ein Denken zu vermitteln, durch welches das gegenseitige Wechselverhältnis der endlich-bedingten Grenzsituation des menschlichen Daseins und ihrem Unendlichkeits-Horizont zum Ausdruck gebracht werden soll. Eine Antwort auf die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen natürlicher Gotteserkenntnis ist zunächst in seiner Lehre der docta ignorantia und dessen philosophischer Methode, der coincidentia oppositorum zu sehen. Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung steht die Erkenntnismetaphysik des Cusanus. Sie beruht auf der ontologischen Einsicht, dass aller menschlichen Erkenntnis der Begriff des „Einen“, d.h. der absoluten Wahrheit voranliegt. Trotz dieser als unüberwindbar angenommenen Voraussetzung vertritt Cusanus keineswegs ein starres Welt- und Gottesbild. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Die Philosophie der „docta ignorantia“ und ihre Denkmethode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Untersuchung zielt darauf ab, die Erkenntnismetaphysik des Nikolaus Cusanus zu analysieren. Im Mittelpunkt steht seine Lehre von der "docta ignorantia" und der "coincidentia oppositorum".
- Die "docta ignorantia" als Methode der Gotteserkenntnis
- Das Prinzip der "coincidentia oppositorum" und seine Bedeutung
- Das Verhältnis von endlicher und unendlicher Erkenntnis
- Die Rolle des Verstandes und der Vernunft in der cusanischen Philosophie
- Cusanus' Verhältnis zur mittelalterlichen Scholastik und zur Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die zentrale Thematik der Arbeit ein: das menschliche Streben nach dem Unendlichen und die Grenzen menschlichen Erkennens, insbesondere im Hinblick auf Gotteserkenntnis. Sie positioniert die Schriften des Nikolaus Cusanus als ein Zeugnis dieses Strebens und kündigt die Untersuchung seiner Erkenntnismetaphysik an, die auf dem Begriff des "Einen" als absoluter Wahrheit basiert. Die Einleitung betont Cusanus' innovative Verbindung traditioneller scholastischer Gedanken mit Ansätzen des modernen, subjektzentrierten Denkens. Sie hebt seine dynamische und aktive Auffassung menschlicher Erkenntnis hervor und deutet die Bedeutung der "docta ignorantia" und der "coincidentia oppositorum" an.
I. Die Philosophie der „docta ignorantia“ und ihre Denkmethode: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit Cusanus' "docta ignorantia" und der "coincidentia oppositorum" als zentralen Elementen seiner Philosophie. Es beschreibt die Entstehung dieser Einsichten und ihre Bedeutung für die Gotteserkenntnis. Die "coincidentia oppositorum", das Zusammenfallen von Gegensätzen, wird als Grundgedanke präsentiert, der in allen Schriften Cusanus' wiederkehrt. Das Kapitel analysiert die Herausforderungen und Interpretationsschwierigkeiten des Begriffs der Koinzidenz, insbesondere im Kontext der Erfassung des Absoluten. Es wird die Frage diskutiert, inwiefern das absolute "Eine" der Erkenntnis zugänglich ist und wie Cusanus die Möglichkeiten und Grenzen der Gotteserkenntnis beschreibt. Die Rolle der negativen Theologie und die Unterscheidung zwischen Verstand und Vernunft im cusanischen Denken werden ebenfalls beleuchtet, mit einer detaillierten Erläuterung der Grenzen der Verstandeserkenntnis und der Notwendigkeit eines übergreifenden Vernunftgebrauchs zur Annäherung an das Absolute. Die Zusammenfassung der Kapitel verdeutlicht die enge Verknüpfung von Gotteserkenntnis und dem menschlichen Streben nach Wahrheit.
Schlüsselwörter
Nikolaus Cusanus, docta ignorantia, coincidentia oppositorum, Erkenntnismetaphysik, Gotteserkenntnis, Unendlichkeit, Endlichkeit, Verstand, Vernunft, mittelalterliche Scholastik, Moderne, Negatives Theologie, absolutes „Eine“.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Erkenntnismetaphysik des Nikolaus Cusanus
Was ist der Gegenstand dieser Untersuchung?
Diese Arbeit analysiert die Erkenntnismetaphysik des Nikolaus Cusanus, insbesondere seine Lehren von der „docta ignorantia“ (gelehrte Unwissenheit) und der „coincidentia oppositorum“ (Zusammenfallen der Gegensätze).
Welche Zielsetzung verfolgt die Untersuchung?
Die Untersuchung zielt darauf ab, Cusanus' Gotteserkenntnis, das Verhältnis von endlicher und unendlicher Erkenntnis, die Rolle von Verstand und Vernunft in seinem Denken sowie sein Verhältnis zur mittelalterlichen Scholastik und zur Moderne zu beleuchten.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die „docta ignorantia“ als Methode der Gotteserkenntnis, das Prinzip der „coincidentia oppositorum“ und seine Bedeutung, das Verhältnis von endlicher und unendlicher Erkenntnis, die Rolle von Verstand und Vernunft und Cusanus' Positionierung zwischen Mittelalter und Moderne.
Was ist die „docta ignorantia“?
Die „docta ignorantia“ ist ein zentrales Element in Cusanus' Philosophie. Sie beschreibt die Einsicht in die Grenzen menschlichen Erkennens im Angesicht des Unendlichen (Gottes) und die Erkenntnis, dass wahres Wissen in der Anerkennung dieser Grenzen liegt. Es ist ein gelehrtes, bewusstes Nichtwissen, das den Weg zur Annäherung an das Absolute ebnet.
Was bedeutet „coincidentia oppositorum“?
Die „coincidentia oppositorum“ beschreibt das Zusammenfallen von Gegensätzen im Absoluten. Dieser Grundgedanke durchzieht Cusanus' Werk und verdeutlicht, dass im göttlichen Sein scheinbare Widersprüche aufgehoben sind. Die Erfassung dieses Prinzips stellt eine große Herausforderung dar.
Wie beschreibt Cusanus das Verhältnis von Verstand und Vernunft?
Cusanus unterscheidet zwischen der beschränkten Erkenntnisfähigkeit des Verstandes und der übergreifenden Vernunft, die eine Annäherung an das Absolute ermöglicht. Der Verstand stößt an seine Grenzen, während die Vernunft über diese Grenzen hinausgeht und eine intuitive Erkenntnis ermöglicht.
Wie positioniert sich Cusanus im Kontext von Mittelalter und Moderne?
Cusanus verbindet traditionelle scholastische Gedanken mit Ansätzen des modernen, subjektzentrierten Denkens. Seine Philosophie stellt eine Brücke zwischen Mittelalter und Moderne dar und beeinflusst die Entwicklung des Denkens in beiden Epochen.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Nikolaus Cusanus, docta ignorantia, coincidentia oppositorum, Erkenntnismetaphysik, Gotteserkenntnis, Unendlichkeit, Endlichkeit, Verstand, Vernunft, mittelalterliche Scholastik, Moderne, negative Theologie, absolutes „Eine“.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, die die Thematik einführt, gefolgt von Kapiteln, die sich eingehend mit der „docta ignorantia“ und der „coincidentia oppositorum“ befassen. Sie bietet Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter zur besseren Orientierung.
- Citation du texte
- Anne Debora Föttinger (Auteur), 2008, Der menschliche Geist als eine "Grenze ohne Grenze", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208695