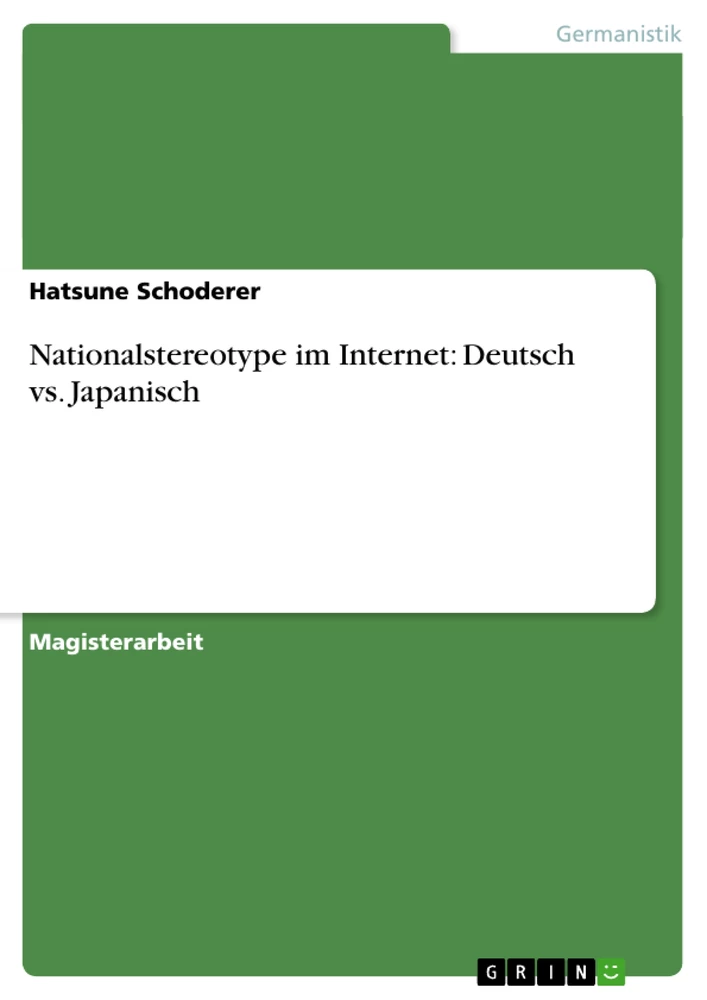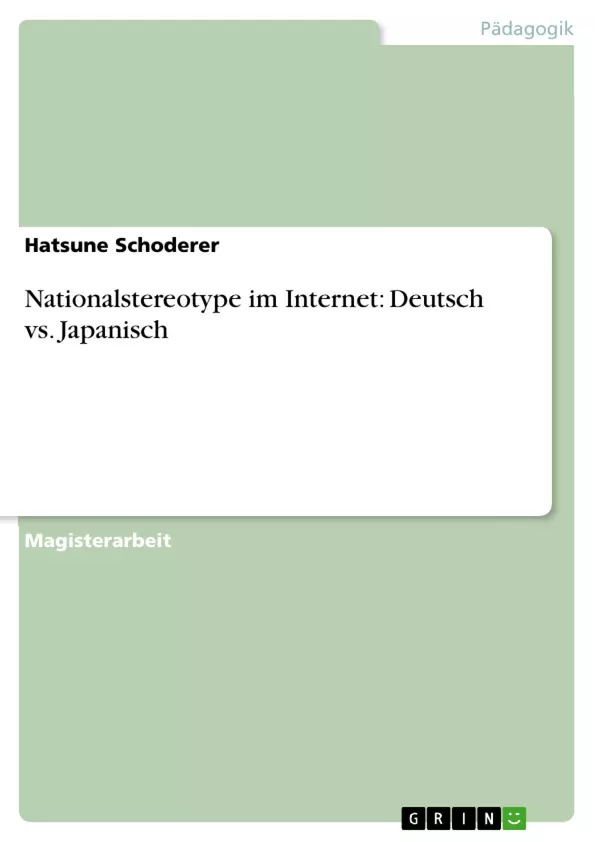In den vergangenen Jahren haben sich Informations- und Kommunikationswesen durch das Internet wesentlich verändert. Die computervermittelte Kommunikation ermöglicht allen den Informations- und Meinungsaustausch mit einer unbegrenzten Zahl von Fremden. Besonders die Japaner scheinen gern zu der neuen Kommunikationsmöglichkeit zu greifen. „Die Japaner sagen viel ohne Worte.“ Die traditionelle japanische Kultur des Schweigens bedeutet aber selbstverständlich nicht, dass die Japaner kein Bedürfnis haben, ihre Meinungen zu äußern und mit anderen auszutauschen. Was die Kommunikation mit dem Ausland betrifft, haben viele Japaner immer das Gefühl, dass sie von der Welt nicht verstanden werden.
Die Beziehung zwischen Deutschland und Japan ist in ihrer gemeinsamen Geschichte mit einigen Ausnahmen stets freundschaftlich gewesen. Viele japanische Touristen besuchen jährlich Deutschland. Ihre Ziele sind heute nicht nur das Schloss Neuschwanstein oder das Oktoberfest, sondern auch das Fußballspiel. Fußball gewinnt in Japan immer mehr begeisterte Fans. Von deutscher Seite interessiert sich die jüngere Generation der Deutschen immer mehr für Manga und Anime bzw. die japanische Popkultur, die nicht nur von Manga und Anime, sondern auch von Musik, Filmen oder Fernsehserien usw. vertreten wird. Aber wie ist die Beziehung zwischen beiden Ländern wirklich? Wie nahe stehen die beiden Völker? Was denken die Japaner über die Deutschen und was denken die Deutschen über die Japaner?
Um einander bei der interkulturellen Kommunikation besser zu verstehen, ist bewusster und kritischer Umgang mit den Stereotypen notwendig. Somit stellt sich meine zentrale Frage: „Was für Stereotype haben die Deutschen und die Japaner von den anderen?“, ferner: „Auf welche Art und Weise gehen sie mit den Stereotypen um?“
In der vorliegenden Arbeit versuche ich, die Stereotype aus dem Internet herauszufinden. Da im Internet wegen der Anonymität, die es den Nutzern zur Verfügung stellt, viel spontanere Kommunikationen stattfinden, gehe ich davon aus, dass das Internet für die Stereotypenforschung verwendbar ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Beziehungen zwischen Deutschland und Japan
- 2.1 Geschichte
- 2.2 „Einseitige Liebe“
- 2.3 Fremdsprachenpolitik in Japan
- 3 Grundlagen der Stereotypenforschung
- 3.1 Zum Begriff des Stereotyps
- 3.2 Die sprachlichen Erscheinungsformen des Stereotyps
- 4 Recherche
- 4.1 Suchkriterien
- 4.2 Internet
- 4.2.1 Foren
- 4.2.2 Blogs
- 4.2.3 Vlogs
- 4.2.4 Witze-Sammlungen
- 4.3 Zur Methode
- 4.4 Suchmaschinen und Suchmasken
- 4.4.1 Deutsche Suchmaschinen und Suchmasken
- 4.4.2 Japanische Suchmaschinen und Suchmasken
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Darstellung der Stereotype über die Japaner
- 5.1.1 „Die spinnen, die Japaner“
- 5.1.2 Freundlichkeit
- 5.1.3 Höflichkeit
- 5.1.4 „Die Japaner arbeiten sich zu Tode“
- 5.1.5 Gesamtübersicht der Stereotype über die Japaner
- 5.1.6 Ein anderes Stereotyp: „Sex in Japan“
- 5.2 Darstellung der Stereotype über die Deutschen
- 5.2.1 Ernsthaftigkeit
- 5.2.2 Genauigkeit
- 5.2.3 „Die Deutschen sind groß“
- 5.2.4 Fleiß
- 5.2.5 Gesamtübersicht der Stereotype über die Deutschen
- 5.2.6 Ein anderes Stereotyp: „Die Japaner und die Deutschen sind ähnlich“
- 6 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der Analyse von Nationalstereotypen, die im Internet über die Deutschen und Japaner verbreitet werden. Ziel ist es, die Inhalte dieser Stereotype zu untersuchen und deren Entstehung und Verbreitung im digitalen Raum zu beleuchten.
- Die historischen Beziehungen zwischen Deutschland und Japan
- Die Rolle von Stereotypen in der interkulturellen Kommunikation
- Die Verwendung des Internets als Forschungsfeld für Stereotypenforschung
- Die Analyse von Stereotypen über die Deutschen und Japaner im Internet
- Die Auswirkungen von Stereotypen auf die Wahrnehmung und das Verständnis der jeweiligen Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit bietet eine Einführung in die Thematik und stellt die Forschungsfrage nach den Stereotypen, die Deutsche und Japaner voneinander haben, sowie den Forschungsansatz vor. Kapitel zwei beleuchtet die historischen Beziehungen zwischen Deutschland und Japan und geht insbesondere auf die „einseitige Liebe“ der Japaner zu Deutschland ein, die sich in einem Ungleichgewicht der kulturellen Austauschbeziehungen widerspiegelt. Kapitel drei befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Stereotypenforschung, definiert den Begriff „Stereotyp“ und analysiert dessen sprachliche Erscheinungsformen.
Kapitel vier erläutert die Vorgehensweise bei der Recherche, die sich auf die Analyse von Online-Kommunikationsformen wie Foren, Blogs, Vlogs und Witze-Sammlungen konzentriert. Die Suchmethode und die verwendeten Suchmaschinen und Suchmasken werden detailliert dargestellt. Kapitel fünf präsentiert die Ergebnisse der Recherche und analysiert die wichtigsten Stereotype über Japaner und Deutsche, die im Internet gefunden wurden. Schlussendlich werden die Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselbegriffe Nationalstereotype, interkulturelle Kommunikation, Internet, Online-Kommunikation, Deutschland, Japan, Medien, Geschichte, Kultur, Forschung, Methode, Analyse, Ergebnisse.
Häufig gestellte Fragen
Welche Stereotype haben Deutsche über Japaner?
Häufige Stereotype sind extreme Höflichkeit, Freundlichkeit, die Annahme, dass Japaner "sich zu Tode arbeiten" und die Wahrnehmung Japans als technologisch "verrücktes" Land.
Was denken Japaner typischerweise über Deutsche?
Japaner assoziieren mit Deutschen oft Ernsthaftigkeit, Genauigkeit (Pünktlichkeit), Fleiß und die physische Eigenschaft, dass Deutsche besonders groß seien.
Warum ist das Internet ein gutes Feld für die Stereotypenforschung?
Wegen der Anonymität kommunizieren Nutzer im Internet (Foren, Blogs, Vlogs) oft spontaner und ungefilterter, was den Zugriff auf tief verwurzelte Klischees und Vorurteile erleichtert.
Gibt es Ähnlichkeiten zwischen Deutschen und Japanern?
Ja, ein verbreitetes Stereotyp in beiden Kulturen ist die Annahme, dass sich Deutsche und Japaner in ihren Werten wie Fleiß, Disziplin und Ordnung sehr ähnlich seien.
Was bedeutet die "traditionelle japanische Kultur des Schweigens" im Internet?
Obwohl Japaner oft als schweigsam gelten, nutzen sie das Internet intensiv, um Meinungen auszutauschen, da sie oft das Gefühl haben, von der Welt nicht verstanden zu werden.
- Citar trabajo
- Hatsune Schoderer (Autor), 2008, Nationalstereotype im Internet: Deutsch vs. Japanisch, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208763