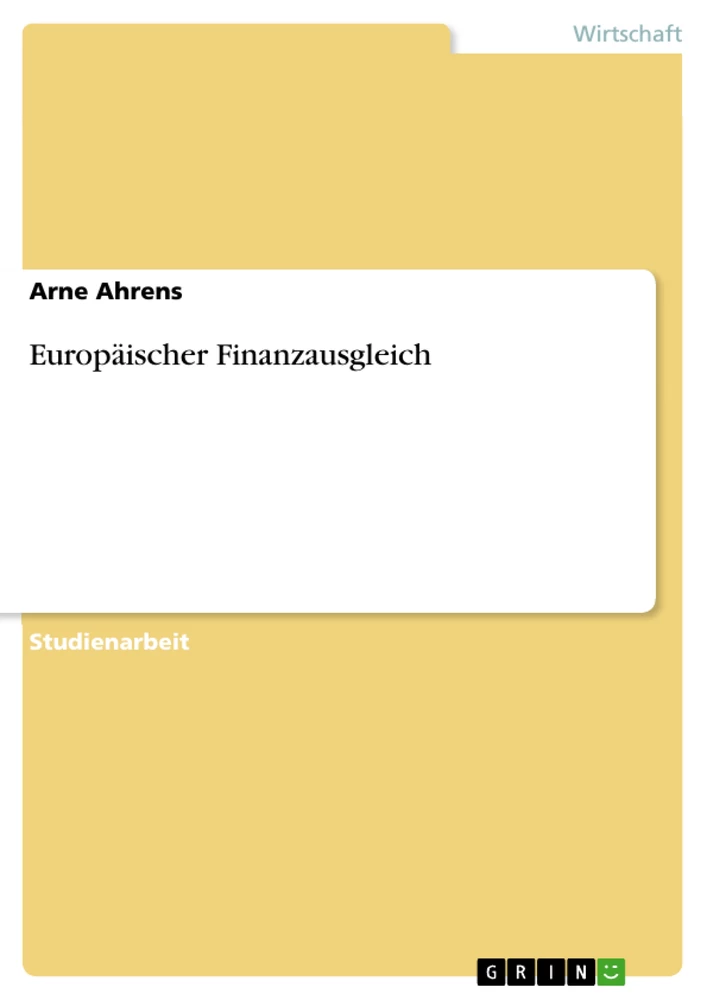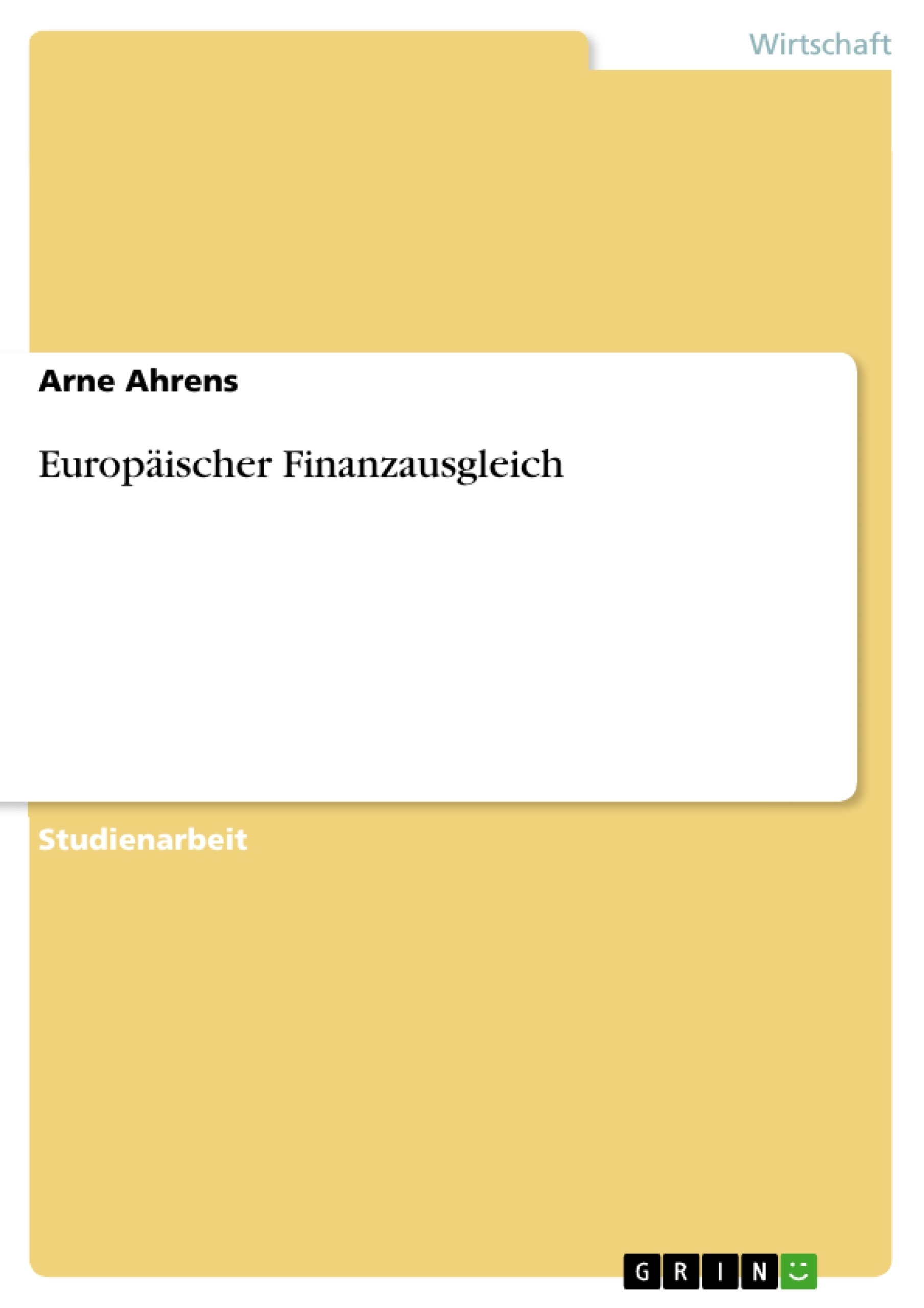Am 9.März 2003 hat Malta per Referendum dem Beitritt zur Europäischen Union zugestimmt. Malta ist damit das erste der 10 EU-Beitrittsländer, das diesen Schritt vollzogen hat. Der Beitritt dieser 10 Länder ist zum 1.Mai 2004 geplant. Das Europa der 25 rückt näher.
Damit rückt auch der europäische Finanzausgleich, als ein Feld der EU-Politik, stärker in den Mittelpunkt des Interesses. In dieser Arbeit wird versucht das Finanzausgleichssystem der EU etwas näher zu betracht en und kritisch zu bewerten. Außerdem wird gefragt, ob ein Finanzausgleich für die EU zu begründen ist. Daran schließt sich die Frage an, ob dieser eher zentral oder dezentral angelegt sein sollte.
Zu Beginn in Abschnitt 1 wird ein kurzer Überblick über den Finanzausgleich im Allgemeinen gegeben. Abschnitt 2 hat anschließend den Zweck den Blick auf die EU von heute zu werfen und sein System des Finanzausgleichs darzustellen und Defizite aufzuzeigen. In Abschnitt 3 wird die theoretische Rechtfertigung eines Finanzausgleichs herausgearbeitet. Reformansätze, die nicht nur auf Grund der EU-Osterweiterung drängen, werden in Abschnitt 4 angeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Finanzausgleich - ein Überblick
- Darstellung des derzeitigen europäischen Finanzausgleichs
- Einnahmeseite
- traditionelle Eigenmittel
- Mehrwertsteuer-Eigenmittel
- Bruttosozialprodukt-Eigenmittel
- Ausgabenseite
- Strukturfonds
- Kohäsionsfonds
- gemeinsame Agrarpolitik
- Defizite des derzeitigen europäischen Finanzausgleichs
- Rechfertigung eines Finanzausgleichs
- räumliche externe Effekte
- Spillover-Effekte
- Mobilitätsinduzierte Externe Effekte
- interregionales Ausgleichsziel
- Ausgestaltung der Kompetenzen
- Reformansätze
- Verbesserungen im bestehenden System
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Finanzausgleichssystem der Europäischen Union im Kontext der bevorstehenden Osterweiterung. Ziel ist es, das derzeitige System zu analysieren, seine Defizite aufzuzeigen und die theoretische Rechtfertigung eines Finanzausgleichs zu beleuchten. Außerdem werden Reformansätze diskutiert, die sowohl die Effizienz als auch die Gerechtigkeit des Systems verbessern könnten.
- Analyse des derzeitigen europäischen Finanzausgleichssystems
- Identifizierung von Defiziten des bestehenden Systems
- Theoretische Rechtfertigung eines Finanzausgleichs in der EU
- Diskussion von Reformansätzen für ein effektiveres und gerechteres System
- Bewertung der Rolle des Finanzausgleichs im Kontext der EU-Osterweiterung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des europäischen Finanzausgleichs im Kontext der bevorstehenden EU-Osterweiterung dar. Kapitel 1 gibt einen kurzen Überblick über den Begriff des Finanzausgleichs im Allgemeinen und differenziert zwischen verschiedenen Arten des internationalen Finanzausgleichs. Kapitel 2 beschreibt das aktuelle Finanzausgleichssystem der EU, analysiert dessen Einnahmen- und Ausgabenseite sowie die Defizite des Systems. Kapitel 3 beleuchtet die theoretische Rechtfertigung eines Finanzausgleichs, insbesondere die Rolle räumlicher externer Effekte und das interregionale Ausgleichsziel. Schließlich werden in Kapitel 4 Reformansätze für das Finanzausgleichssystem der EU diskutiert, die sowohl die Effizienz als auch die Gerechtigkeit des Systems verbessern könnten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Kernaspekte des europäischen Finanzausgleichs und vermeidet dabei eine detaillierte Darstellung der finalen Schlussfolgerungen, um Spoiler zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Europäischer Finanzausgleich, EU-Osterweiterung, Defizite, Rechtfertigung, Reformansätze, räumliche externe Effekte, interregionales Ausgleichsziel, Effizienz, Gerechtigkeit, Kohäsionspolitik, Strukturfonds, Kohäsionsfonds, Gemeinsame Agrarpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des europäischen Finanzausgleichs?
Das System zielt darauf ab, wirtschaftliche Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu verringern und durch Umverteilung (z. B. Strukturfonds) den sozialen und regionalen Zusammenhalt zu fördern.
Wie setzen sich die Einnahmen der EU für den Finanzausgleich zusammen?
Die Einnahmen basieren auf traditionellen Eigenmitteln (Zöllen), Mehrwertsteuer-Eigenmitteln und vor allem auf Beiträgen, die sich am Bruttonationaleinkommen (BNE) der Mitgliedstaaten orientieren.
Was sind die größten Kritikpunkte am aktuellen EU-Finanzsystem?
Kritisiert werden oft die mangelnde Transparenz, die hohe Komplexität der Beitragsberechnung und die starke Fokussierung auf die Gemeinsame Agrarpolitik zulasten zukunftsorientierter Investitionen.
Welche Rolle spielt die EU-Osterweiterung für den Finanzausgleich?
Die Erweiterung um zehn neue Länder im Jahr 2004 erhöhte den Druck auf das System massiv, da die neuen Mitglieder deutlich ärmer waren und somit den Bedarf an Kohäsions- und Strukturmitteln steigerten.
Was versteht man unter "Spillover-Effekten" in diesem Kontext?
Spillover-Effekte sind räumliche externe Effekte, bei denen Maßnahmen in einem Land positive oder negative Auswirkungen auf Nachbarstaaten haben. Sie dienen als theoretische Rechtfertigung für einen zentral gesteuerten Finanzausgleich.
- Citation du texte
- Arne Ahrens (Auteur), 2003, Europäischer Finanzausgleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20877