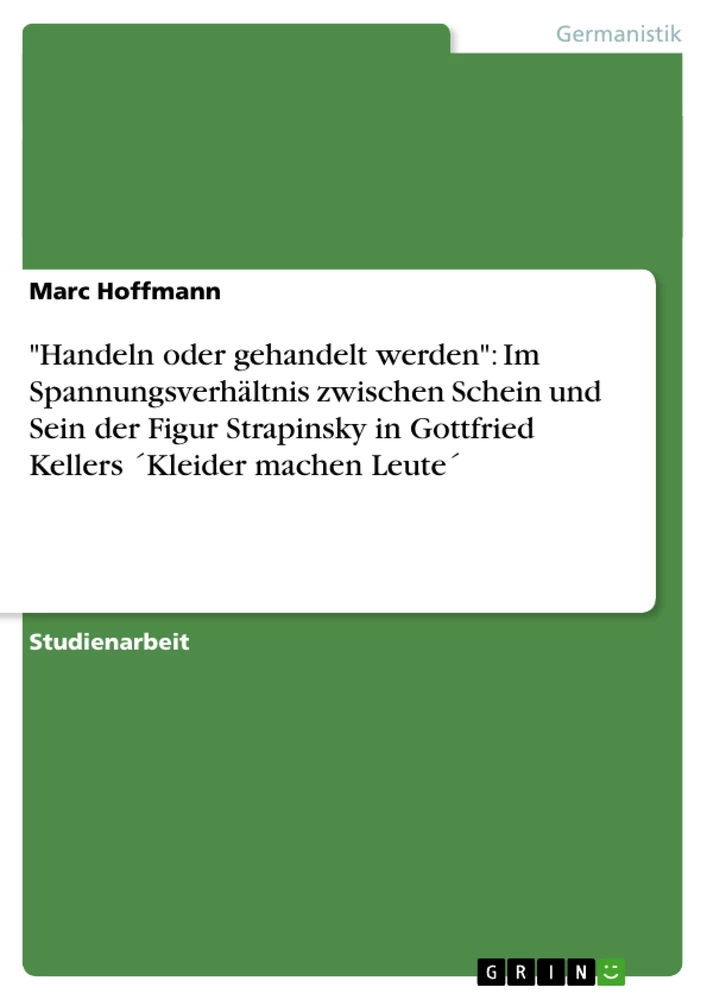Der Schneidergeselle Wenzel wird in der Goldacher Gesellschaft mit seinem Mantel durch einen Zufall für einen polnischen Grafen gehalten. Dass die äußere Erscheinung eines Menschen nicht immer zu Tage tritt, wie sie eigentlich ist, zeigt uns der Autor. Der Leser wird in einen Zustand versetzt, bei dem er den Signifikanten nicht mehr in Beziehung zum Signifikat, dem wirklich Seienden findet.
Im Folgen werde ich der Frage nachgehen, inwiefern der Schneidergeselle durch die Gesellschaft in die Rolle eines Grafen versetzt wird. Handelt ihn die Gesellschaft aufgrund seines Scheins oder wirkt Strapinsky aktiv und individuell in der Spannung zwischen Schein und Sein, vielleicht auch mithilfe einer Macht an dem Verlauf der Novelle mit?
Bei der Analyse werde ich zunächst auf die Figur Strapinsky eingehen und seine Entwicklung herausarbeiten. Anschließend untersuche ich die Stadt und das soziale Umfeld Strapinskys, sowie dessen Liebesbeziehung zu Nettchen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Strapinskys Auftreten
- II.1. Strapinskys Charakterisierung
- II.2. „Motivation von hinten“
- III. Die Scheinwelt
- IV. Die Gesellschaft
- V. Nettchen als Fortuna
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Figur Strapinsky in Gottfried Kellers Novelle „Kleider machen Leute“ im Hinblick auf das Spannungsverhältnis zwischen Schein und Sein. Die Analyse beleuchtet, inwieweit Strapinskys Handeln von der Gesellschaft beeinflusst wird und wie er selbst aktiv in die Ereignisse eingreift. Die Rolle des Zufalls und die Bedeutung von äußeren Erscheinungen für die soziale Wahrnehmung werden ebenfalls betrachtet.
- Die Charakterisierung Strapinskys und seine Entwicklung
- Das Spannungsverhältnis zwischen Schein und Sein in der Novelle
- Die Rolle der Goldacher Gesellschaft und ihre Wahrnehmung Strapinskys
- Nettchens Bedeutung und ihre Funktion als Katalysator der Handlung
- Die Darstellung von Glück und Zufall
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Novelle „Kleider machen Leute“ ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis von Strapinskys aktivem Handeln und der Beeinflussung durch die Gesellschaft im Spannungsfeld von Schein und Sein. Der weite Mantel Strapinskys wird als Symbol des Scheins und der sozialen Projektion eingeführt. Die Arbeit kündigt die Analyse von Strapinskys Charakter, der Gesellschaft Goldachs und seiner Beziehung zu Nettchen an.
II. Strapinskys Auftreten: Dieses Kapitel analysiert zunächst Strapinskys äußere Erscheinung und seinen Charakter. Sein gepflegtes Aussehen, trotz Armut, wird als Ausdruck seines Strebens nach Individualität und Schönheit gedeutet. Der Bezug auf seine Erziehung und seine zurückhaltende Art unterstreichen, dass er keinen Wunsch nach sozialem Aufstieg hat. Der zweite Teil des Kapitels beleuchtet die "Motivation von hinten" im Sinne von Ajouri, die darauf hindeutet, dass Strapinskys Handeln durch das Zusammentreffen mit Nettchen und eine Art glückliche Fügung beeinflusst wird.
III. Die Scheinwelt: Dieses Kapitel untersucht die Goldacher Gesellschaft und wie deren Wahrnehmung und Handlungen Strapinskys Schein und Sein beeinflussen. Die Stadt Goldach selbst wird als idyllische Scheinwelt dargestellt, in der die Bürger mehr an Unterhaltung als an der Wahrheit interessiert sind. Strapinsky gerät in eine Scheinwelt, in der er sich selbst seine eigene Realität konstruiert, die sich mit seinen Sehnsüchten verbindet. Der "Kreuzweg" wird als symbolische Darstellung der Wahl zwischen Schein und Sein interpretiert.
IV. Die Gesellschaft: Dieses Kapitel beschreibt die Goldacher Gesellschaft als passiv und amüsiert, die Strapinsky als Projektionsfläche ihrer Langeweile und Sehnsüchte nutzt. Die Bürger interpretieren Strapinskys äußere Erscheinung und Verhalten, ohne die Wahrheit hinter dem Schein zu erforschen. Sie nehmen ihn als Graf wahr, genießen die dadurch entstandene Abwechslung und fördern durch ihr Verhalten weiter den Schein.
V. Nettchen als Fortuna: Dieses Kapitel fokussiert auf die Beziehung zwischen Strapinsky und Nettchen, wobei Nettchen als Personifikation der Fortuna gesehen wird. Nach der Entlarvung Strapinskys und seinem Rückzug in die Verzweiflung, ist es Nettchen, die aktiv die Initiative ergreift und ihn wiederfindet. Sie repräsentiert hier die Kraft, den Schein zu durchbrechen und Strapinsky zu seinem wahren Sein zurückzuführen, indem sie aktiv sein Glück lenkt und seine weitere Entwicklung mitprägt.
Schlüsselwörter
Gottfried Keller, Kleider machen Leute, Wenzel Strapinsky, Schein und Sein, Bürgerlicher Realismus, soziale Wahrnehmung, Individuum und Gesellschaft, Fortuna, Glück, Zufall, Anpassung, Identität.
Häufig gestellte Fragen zu Gottfried Kellers "Kleider machen Leute" - Strapinsky-Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Figur Wenzel Strapinsky in Gottfried Kellers Novelle "Kleider machen Leute" mit besonderem Fokus auf das Spannungsverhältnis zwischen Schein und Sein. Sie untersucht, wie Strapinskys Handlungen von der Gesellschaft beeinflusst werden und wie er selbst aktiv in die Ereignisse eingreift. Die Rolle des Zufalls und die Bedeutung äußerer Erscheinungen für die soziale Wahrnehmung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche Themen werden behandelt?
Die Analyse beleuchtet die Charakterisierung Strapinskys und seine Entwicklung, das Spannungsverhältnis zwischen Schein und Sein in der Novelle, die Rolle der Goldacher Gesellschaft und ihre Wahrnehmung Strapinskys, Nettchens Bedeutung und ihre Funktion als Katalysator der Handlung sowie die Darstellung von Glück und Zufall.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel über Strapinskys Auftreten (inklusive seiner "Motivation von hinten"), ein Kapitel über die Scheinwelt Goldachs, ein Kapitel über die Goldacher Gesellschaft und ein Kapitel über Nettchens Rolle als Fortuna. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der relevanten Aspekte der Novelle im Hinblick auf die Forschungsfrage.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie verhält sich Strapinskys aktives Handeln im Spannungsfeld von Schein und Sein zur Beeinflussung durch die Gesellschaft?
Wie wird Strapinsky charakterisiert?
Strapinsky wird als Figur dargestellt, die trotz Armut ein gepflegtes Äußeres pflegt und dadurch ein Streben nach Individualität und Schönheit ausdrückt. Er wird als zurückhaltend beschrieben und zeigt keinen expliziten Wunsch nach sozialem Aufstieg. Seine Handlungen werden teilweise durch glückliche Zufälle und Begegnungen, insbesondere mit Nettchen, beeinflusst ("Motivation von hinten").
Welche Rolle spielt die Goldacher Gesellschaft?
Die Goldacher Gesellschaft wird als passiv und amüsiert dargestellt. Sie nutzt Strapinsky als Projektionsfläche für ihre Langeweile und Sehnsüchte, interpretiert seine äußere Erscheinung ohne die Wahrheit zu suchen und trägt durch ihr Verhalten zum Fortbestand des Scheins bei.
Welche Bedeutung hat Nettchen?
Nettchen wird als Personifikation der Fortuna interpretiert. Sie ist es, die nach Strapinskys Entlarvung aktiv wird, ihn wiederfindet und seine weitere Entwicklung mitprägt. Sie repräsentiert die Kraft, den Schein zu durchbrechen und Strapinsky zu seinem wahren Sein zurückzuführen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gottfried Keller, Kleider machen Leute, Wenzel Strapinsky, Schein und Sein, Bürgerlicher Realismus, soziale Wahrnehmung, Individuum und Gesellschaft, Fortuna, Glück, Zufall, Anpassung und Identität.
Welche Symbole werden verwendet?
Der weite Mantel Strapinskys dient als Symbol für Schein und soziale Projektion. Der "Kreuzweg" wird als symbolische Darstellung der Wahl zwischen Schein und Sein interpretiert.
Wo finde ich die Kapitelzusammenfassungen?
Die Kapitelzusammenfassungen finden sich im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" der Arbeit. Dort werden die Kernaussagen jedes Kapitels prägnant dargestellt.
- Quote paper
- Marc Hoffmann (Author), 2009, "Handeln oder gehandelt werden": Im Spannungsverhältnis zwischen Schein und Sein der Figur Strapinsky in Gottfried Kellers ´Kleider machen Leute´, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208786