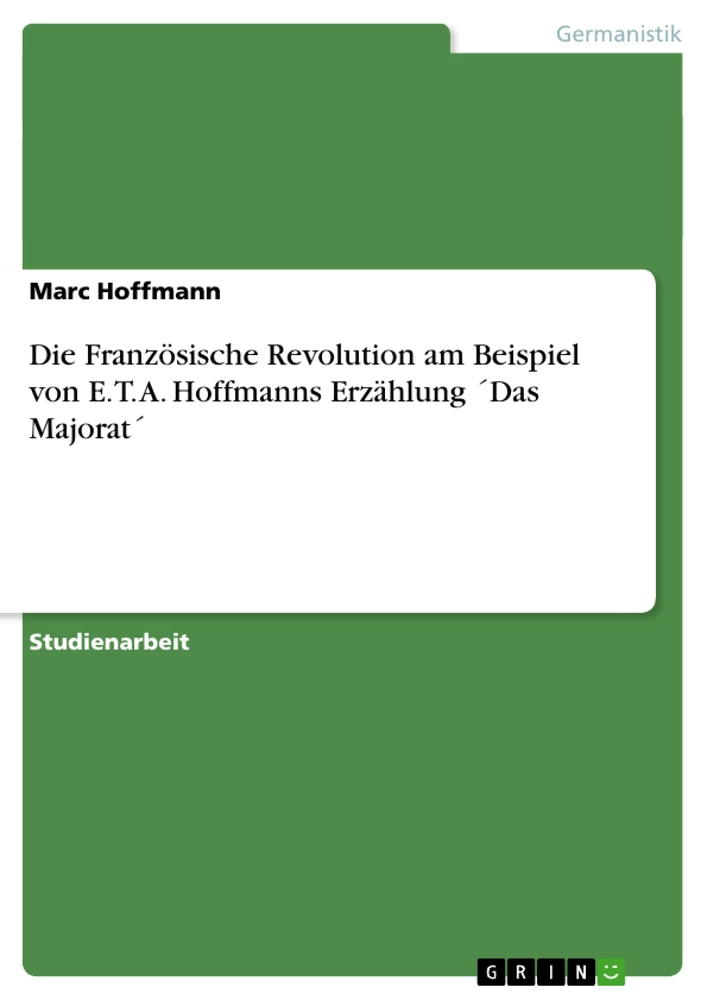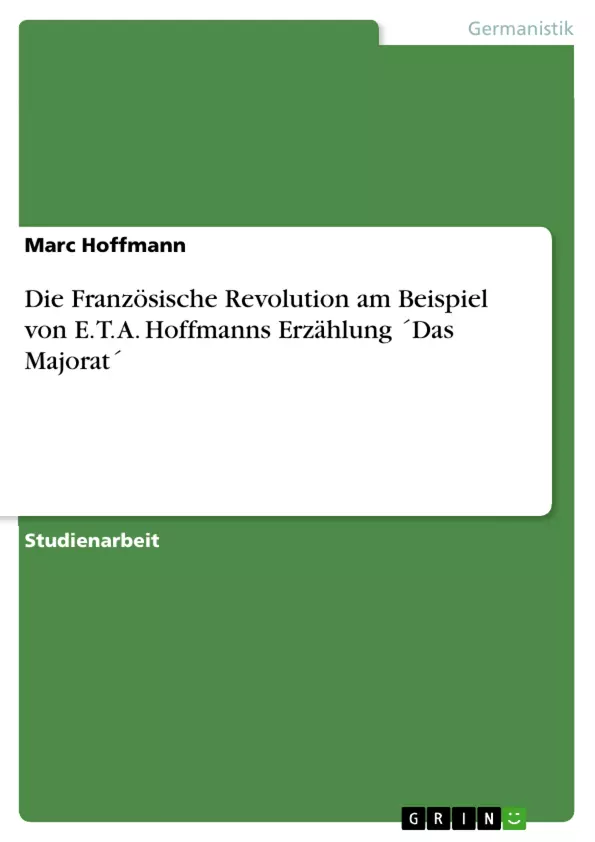Die Katastrophen in Preußen, mit der Niederlage in Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806 und die daraus resultierende Krise in dem geteilten Staatsareal zwischen dem von Napoleon geschlossenen Rheinbund ohne Preußen, führen in den Jahren 1807 bis 1822 zu ausgiebigen Reformen. Als Konsequenz hat diese „defensive Modernisierung“ im Rahmen von Reformationen, anstelle einer Revolution, nachwirkend den Umschwung der Adelsgesellschaft alteuropäischer Art durch eine bürgerliche Eigentümergesellschaft der fortschrittlicheren Art vorangetrieben. „Das alte Siegel“ , das auf der starren Weitergabe der Familienehre vom Vater auf den ältesten Sohn beruht, ist im Schwanken. In diesem Rahmen sind auch die vielen zeitgenössigen Diskussionen, zum Beispiel über die Werte der Fideikommisse und Majorate zu betrachten. Die daraus resultierenden Erbschaftsdebatten beherrschen das politische Geschehen um die Wende des 18. Jahrhunderts. Das hohe Interesse vieler Autoren an diesem Themenkomplex zeigt sich an der Menge von literarischen Umsetzungen, vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, welche die Problematik des Fideikommisses beinhalten.
Gegenstand der Analyse wird sein, inwiefern sich die Kollektivsymbolik „[...] die nach der bleibenden Bedeutung der Französischen Revolution fragt [...]“ noch im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts bei E.T.A. Hoffmanns „Das Majorat“ herausarbeiten lässt. Ich werde mich auch mit der Darstellung der Krise befassen, die sich zwischen dem Adel und dem Bürgertum spürbar macht und den Konflikt der Generation behandeln
Zum besseren Verständnis werde ich eine kurze Ergänzung in Bezug auf den Fideikommiss geben.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der Fideikommiss und das Majoratwesen
- III. 1. Das Stammschloss, Natur und Astrologie
- III. 2. Spuk und Schauer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Das Majorat“ im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Umwälzungen in Preußen nach der napoleonischen Zeit. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Krise zwischen Adel und Bürgertum sowie dem Konflikt der Generationen im Spannungsfeld zwischen dem traditionellen Fideikommisswesen und den Reformen des 19. Jahrhunderts.
- Die Symbolik des Fideikommisses und des Majoratswesens als Ausdruck der alten Ordnung.
- Der Konflikt zwischen Adel und Bürgertum im Spiegel der Erzählung.
- Die Darstellung des Generationenkonflikts und des Wandels der gesellschaftlichen Werte.
- Die Verwendung von Symbolen wie Schloss, Natur und Astrologie zur Veranschaulichung der Krise.
- Die Rolle des Unheimlichen und des Schauers in der Erzählung.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der Erzählung, die Reformen in Preußen nach 1806 und die damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen. Sie thematisiert die Diskussionen um das Fideikommiss und das Majoratssystem und kündigt die Analyse von E.T.A. Hoffmanns „Das Majorat“ an, insbesondere im Hinblick auf die Kollektivsymbolik und den Konflikt zwischen Adel und Bürgertum.
II. Der Fideikommiss und das Majoratwesen: Dieses Kapitel erläutert das Fideikommiss- und Majoratssystem in Preußen. Es beschreibt die langsame Entmachtung der Majorate durch Reformen, die auf die Französische Revolution zurückzuführen sind. Der Fokus liegt auf dem Konflikt zwischen dem traditionellen, unveränderlichen System des Fideikommisses und den Bestrebungen nach Modernisierung und wirtschaftlicher Liberalisierung. Die Kritik am Fideikommiss als Ausdruck einer starren, der gesellschaftlichen Entwicklung entgegenwirkenden Ordnung wird dargestellt, unter Bezugnahme auf Denker wie Maximilien de Robespierre und Autoren wie Achim von Arnim.
III. 1. Das Stammschloss, Natur und Astrologie: Dieser Abschnitt analysiert die symbolische Bedeutung des Stammschlosses „R..sitten“ (Rossitten) als Repräsentant des verfallenden feudalen Systems. Der verfallene Zustand des Schlosses, insbesondere der eingestürzte Gerichtsaal, symbolisiert das Unwirksamwerden der alten Machtstrukturen. Die Beschreibung der umliegenden, unfruchtbaren Natur kontrastiert mit den blühenden Bauerndörfern und unterstreicht den Gegensatz zwischen dem alten Adel und dem aufstrebenden Bürgertum. Die Jagdgesellschaft des Barons wird als Zeichen eines möglichen Wandels und einer Annäherung des Adels an die Natur und die Werte des Bürgertums interpretiert. Die astronomischen Interessen des Ahnherrn Roderich werden als Versuch der Kontrolle der Zukunft gedeutet, die jedoch durch den Einsturz des Turms scheitert, und als Symbol für den unabwendbaren Verfall.
III. 2. Spuk und Schauer: Das Kapitel konzentriert sich auf die Darstellung des Unheimlichen und des Schauers in der Erzählung. Die Beschreibung der vorbeiziehenden Wolken, die den jungen V. durchbeben, wird als Metapher für den gesellschaftlichen Wandel und die Unsicherheit der Zeit interpretiert. Die Atmosphäre des Schlosses und die „Riesen“, die der junge V. zu sehen glaubt, symbolisieren die nachrevolutionäre Situation und die Angst vor den Umbrüchen.
Schlüsselwörter
Fideikommiss, Majorat, Preußen, Französische Revolution, Adel, Bürgertum, Generationenkonflikt, gesellschaftlicher Wandel, Reformen, Kollektivsymbolik, E.T.A. Hoffmann, Symbolismus, Natur, Schloss, Astrologie, Unheimliches, Schauer.
Häufig gestellte Fragen zu E.T.A. Hoffmanns "Das Majorat"
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Diese Arbeit analysiert E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Das Majorat“ im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Umwälzungen in Preußen nach der napoleonischen Zeit. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Krise zwischen Adel und Bürgertum sowie dem Konflikt der Generationen im Spannungsfeld zwischen dem traditionellen Fideikommisswesen und den Reformen des 19. Jahrhunderts.
Welche Themen werden behandelt?
Die Analyse behandelt die Symbolik des Fideikommisses und des Majoratswesens, den Konflikt zwischen Adel und Bürgertum, den Generationenkonflikt und den Wandel gesellschaftlicher Werte. Besondere Aufmerksamkeit wird der Verwendung von Symbolen wie Schloss, Natur und Astrologie sowie der Rolle des Unheimlichen und des Schauers gewidmet.
Welche Kapitel umfasst die Analyse?
Die Analyse gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zum Fideikommiss und Majoratssystem, ein Kapitel zum Stammschloss, Natur und Astrologie sowie ein Kapitel zu Spuk und Schauer. Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext und die Zielsetzung der Arbeit. Die weiteren Kapitel analysieren spezifische Aspekte der Erzählung im Hinblick auf die dargestellten Konflikte und den gesellschaftlichen Wandel.
Wie wird das Fideikommiss- und Majoratssystem dargestellt?
Das Kapitel zum Fideikommiss- und Majoratssystem erläutert dieses System in Preußen und beschreibt seine langsame Entmachtung durch Reformen nach der Französischen Revolution. Es analysiert den Konflikt zwischen dem traditionellen, unveränderlichen System und den Bestrebungen nach Modernisierung und wirtschaftlicher Liberalisierung, wobei auch die Kritik an diesem System im Kontext der Zeit beleuchtet wird.
Welche Rolle spielen Symbole in der Erzählung?
Das Stammschloss wird als Symbol des verfallenden feudalen Systems interpretiert, die Natur als Kontrast zum aufstrebenden Bürgertum. Die astronomischen Interessen des Ahnherrn werden als Versuch der Kontrolle der Zukunft gedeutet, der jedoch scheitert. Der Verfall des Schlosses und der unfruchtbare Zustand der umliegenden Natur symbolisieren den Niedergang der alten Ordnung.
Wie wird das Unheimliche und der Schauer dargestellt?
Das Kapitel zu Spuk und Schauer konzentriert sich auf die Darstellung des Unheimlichen in der Erzählung. Die Beschreibung der Naturereignisse und die Visionen des Protagonisten werden als Metapher für den gesellschaftlichen Wandel und die damit verbundene Unsicherheit interpretiert. Die Atmosphäre des Schlosses und die „Riesen“ symbolisieren die nachrevolutionäre Situation und die Angst vor den Umbrüchen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Analyse?
Schlüsselwörter sind: Fideikommiss, Majorat, Preußen, Französische Revolution, Adel, Bürgertum, Generationenkonflikt, gesellschaftlicher Wandel, Reformen, Kollektivsymbolik, E.T.A. Hoffmann, Symbolismus, Natur, Schloss, Astrologie, Unheimliches, Schauer.
- Citar trabajo
- Marc Hoffmann (Autor), 2013, Die Französische Revolution am Beispiel von E. T. A. Hoffmanns Erzählung ´Das Majorat´, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208789